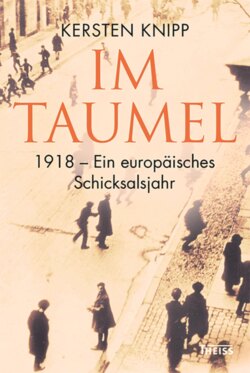Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 25
Galizische Zwietracht
ОглавлениеDoch nicht nur kulturell, auch politisch wurden die Habsburger Länder unruhig. Den Auftakt machten die Polen. Als sich im Juli 1830 die Franzosen gegen König Karl X. und seine Vorlieben für die Wiedereinrichtung der Adelsherrschaft erhoben, ließen sich zunächst die Bürger von Warschau von den Aufständen inspirieren. Warschau war damals Hauptstadt des sogenannten Kongresspolens, eines auf dem Wiener Kongress geschaffenen Königreichs mit eigener Nationalversammlung, das aber vom russischen Zaren regiert wurde. Als dieser 1830 polnische Truppen zum Kampf im Ausland verpflichten wollte, verweigerten sich die Bürger diesem Ansinnen. Im November kam es zum Aufstand, der bald auch auf andere Städte des Königreichs übersprang. Der Zar verlangte die Kapitulation der Aufständischen, woraufhin diese ihn im Januar 1831 für abgesetzt erklärten. In Erwartung einer entschiedenen russischen Reaktion hatten die Aufständischen bald ein Heer von 100.000 Soldaten ausgehoben. Doch gegen die gut ausgerüsteten Truppen aus Moskau hatten die Freiheitskämpfer keine Chance. Bald folgten erste Prozesse gegen die Revolutionäre. Zahlreiche Rebellen flohen ins Ausland, vor allem nach Frankreich. „Stützen von Despoten mittels Bajonetten/Stiften eines Brandes, einer Metzelei/Fremde Staaten ringsum zu überfallen/Untertanen zu berauben, Fremde kosen“: So sah der polnische Nationaldichter und Exilant Adam Mickiewicz die von Zar Nikolaus I. betriebene Politik.49
Auch in Galizien versuchte der Adel im Schwung der liberalen Winde zu segeln und dafür auch die Bauern zu gewinnen. Vergeblich: Diesen war klar, dass die Grundherren vieles im Sinne haben mochten, nur nicht, die Landbevölkerung aus dem Zwangsdienst zu entlassen. Seit jeher sahen sie sich Drohungen und Gewalt der Grundherren gegenüber, hatten mit dem aufgezwungenen Frondienst und in materieller Unsicherheit leben müssen. Die Macht des Adels ging so weit, dass er in einigen Regionen die Bauern sogar dazu zwang, einen Teil des auf seinen Gütern produzierten Alkohols zu kaufen.50
In den russisch besetzten Gebieten konnten die Bauern auf Unterstützung durch den Zaren nicht rechnen, weshalb sie sich an keinen Aufständen beteiligten. In den österreichisch besetzten Gebieten Galiziens hatte die kaiserliche Ordnung zumindest ein Minimum an Rechtsstaatlichkeit geschaffen. So waren bereits seit dem späten 18. Jahrhundert, dank der unter Maria Theresia und Joseph II. durchgesetzten Reformen, Leibeigenschaft und körperliche Zucht verboten. Sich zusammen mit dem Adel gegen den Kaiser zu erheben, kam den Bauern dort darum nicht in den Sinn. Warum im Namen der Nation auf Verbündete setzen, unter denen sie im Gegenteil seit Jahrhunderten zu leiden hatten?
So stieß der polnische Nationalismus rasch an seine Grenzen. „Unsere Bauern“, beklagte Zdzislaw Zamoyski, einer der Unabhängigkeitskämpfer des Jahres 1831, die Situation in Galizien, „sind zwar auf polnischem Boden geboren und sprechen ausschließlich Polnisch. Trotzdem vermögen sie nicht zu verstehen, dass sie ein Pole sind. Schlimmer noch: Für sie sind die Begriffe ‚Pole‘ und ‚Feind‘ identisch. Der ‚Pole‘ ist für die Bauern der Herr, den sie verachten – und der zugleich Macht und juristische Verfügungsgewalt über sie hat, dem sie durch das Feudalrecht verpflichtet sind.“51 Auch höherer Bildung für ihre Landsleute können sie nichts abgewinnen. Warum sollten sie das tun, höhnen 1840 Mitglieder des galizischen Landtags – damit würden sie doch nur dazu beitragen, die Bauern weiter gegen sie aufzuhetzen.52
Als 1846 Aufständische in der – damals noch freien – Stadt Krakau einen weiteren Aufstand gegen das Kaiserreich zu entfachen versuchten, verweigerten sich die Bauern wiederum. Schließlich erhoben sie sich dann doch – aber nicht gegen Habsburg, sondern gegen die Grundbesitzer. Rund 1000 Menschen starben, gut 400 Gutshöfe wurden verbrannt. Zwar schlugen österreichische Truppen den Aufstand am Ende nieder. Doch dafür verlangte Metternich einen Preis: Der galizische Adel hätte sich seinen Anordnungen fortan zu fügen. Wenn nicht, sei jederzeit mit weiteren Bauernaufständen zu rechnen. Den kalkulierten Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche pflegte Habsburg auch in den kommenden Jahren. So verbot Franz Graf von Stadion, der Statthalter von Galizien, Ende April 1848 den Robot, den Zwangsdienst, den die Bauern für die Gutsherren zu leisten hatten. Wenige Tage später erging dann ein Erlass, der polnischen Emigranten die Rückkehr nach Galizien untersagte. Daraufhin erhoben sich die Bürger Krakaus ein weiteres Mal. Nach Zusammenstößen im Zentrum der Stadt bombardierte das österreichische Militär die Stadt. Die Aufständischen – die auch dieses Mal vergeblich auf den Beistand der Bauern gehofft hatten – gaben sich geschlagen.