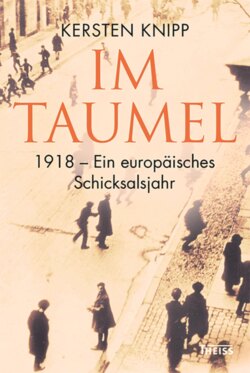Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 31
„Das Jahr X“
ОглавлениеSo sind es wenige Menschen, die die Tradition durch die Revolution zu bewahren suchen. Agitationen gehen vor allem von Serbien aus. Dortige Nationalisten versuchen, die im „Völkerkerker“ gefangenen Slawen zum Aufstand zu bewegen. Die Agitationen richten sich auch gegen Ungarn, dessen Regierung eine viel rigorosere Minderheitenpolitik als die Österreicher betreibt. Entsprechend leichter lassen sich die Angehörigen dieser Minderheiten aufwiegeln. Der Einsatz ist für beide Seiten hoch: In Bosnien, Kroatien, Slawonien und der Vojvodina leben zwei Millionen Serben, in Siebenbürgen, Bessarabien und der Bukowina leben vier Millionen Rumänen. Einmal in offenen Widerstand gegen die Zentralverwaltung in Budapest gebracht, bilden sie für den Bestand des Reiches eine durchaus ernst zu nehmende Gefahr. Auch in Bosnien und Herzegowina bemühen sich serbische Nationalisten, die Bürger für einen Aufstand zu gewinnen.
1908 verschärfte sich die Lage dramatisch. In jenem Jahr hatten sich in Istanbul die „Jungtürken“ genannten Reformer erhoben. Der Aufstand erforderte die gesamte Aufmerksamkeit des Sultans. Die Gelegenheit schien aus österreichischer Sicht günstig, und so entschloss sich Außenminister Alois Lexa von Aehrenthal, die beiden völkerrechtlich weiterhin zum Osmanischen Reich gehörenden Provinzen Bosnien und Herzegowina dem Habsburgerreich militärisch einzugliedern. Der Schritt beunruhigte die europäischen Großmächte; zugleich zerrüttete er das Verhältnis zu Russland. Denn vorausgegangen waren der Annexion geheime Absprachen zwischen Wien und Moskau. Das Zarenreich hatte der Eingliederung zugestimmt – unter der Bedingung, dass Österreich es im Gegenzug bei der international zustimmungspflichtigen Öffnung der Dardanellen für seine russische Flotte unterstützen würde. Doch die diplomatische Schützenhilfe aus Österreich fiel geringer aus als erhofft, woraufhin die Stimmung in Russland spürbar abkühlte. Auch die übrigen europäischen Staaten reagierten nervös. Die Entente cordiale, das Bündnis des „herzlichen Einvernehmens“, zu dem sich Frankreich und Großbritannien 1904 zusammengefunden hatten und dem sich drei Jahre später auch Russland anschloss, gewann in den Augen seiner Mitglieder an immer größerer Notwendigkeit. Die Feinde – Österreich und Ungarn sowie Deutschland – waren ausgemacht. Der Entschluss, sich gegen sie zu wappnen, festigte sich.
Zugleich erzürnte die Annexion die ohnehin bereits aufgewühlten slawischen Nationalisten zusätzlich. Zu den zwei Millionen Südslawen in den von Wien beherrschten Ländern – sie machen knapp acht Prozent der Habsburger Bevölkerung aus – kamen nun noch zwei Millionen weitere hinzu. Immer vehementer forderten die Vertreter der „Südslawen“ eine Föderation, die ihr Gebiet als gleichberechtigtes Drittes neben Österreich und Ungarn umfasse. Doch dieses Ansinnen lehnte vor allem Franz Ferdinand, der Thronfolger Franz Joseph I., ab. „Hätten die Slawen die gleichen Mitspracherechte in solch zentralen Fragen bekommen, wäre es ihnen in der Folge möglich geworden, sich in manchen Angelegenheiten mit den Ungarn gegen Österreich zu einigen oder durch geschicktes Lavieren beide Seiten gegeneinander auszuspielen. Nicht zuletzt bestand die Gefahr, dass sie den Kaiser auf diese Art und Weise hätten erpressen können.“76
Der gescheiterte Föderalismus-Plan spielte den südslawischen Nationalisten in die Hände. Die Unruhen nahmen zu, und im Verlauf des Jahres 1912 gingen die Menschen auch in den bosnischen Städten auf die Straße. Die nationalistischen Regungen, die so lange auf sich hatten warten lassen, brachen sich nun Bahn – insbesondere nachdem der für Bosnien und Herzegowina zuständige Gouverneur Graf Slavko Cuvaj die Verfassung aufheben ließ und auf der Grundlage von Notstandsgesetzen regierte. „Die südslawische Idee, bzw. die Idee der serbo-kroatischen Verbrüderung“, notierte ein österreichischer Informant, „ist nunmehr zur vollsten Herrschaft gelangt und … nicht nur das Losungswort aller Bevölkerungsschichten in politischer, sondern auch in kultureller und wirtschaftlicher Beziehung. Dies gilt nicht nur für Kroatien und Slavonien, sondern auch für Bosnien und die Hercegovina und ganz besonders für Dalmatien, wo direkt ein revolutionärer, antimonarchistischer Geist platzgegriffen hat.“77 Zunehmend dachten die Nationalisten auch über gewalttätige, genauer: terroristische Aktionen nach. Deren Ziel war es nicht so sehr, die Habsburger Herrschaft unmittelbar zu stürzen, sondern die Beziehungen zwischen Peripherie und Zentrum durch gezielte Attentate eskalieren zu lassen. Allein durch einen offenen Aufstand, so das Kalkül, ließe sich die südslawische Unabhängigkeit erzwingen. Zu diesem Zweck, notierte der bosnische Nationalist Miloš Pjanic im August 1913, bräuchte es Personen, die kühn genug wären, ein entsprechendes Attentat tatsächlich durchzuführen. Die Chancen, dass sich entsprechende Kandidaten finden ließen, seien gut, war er überzeugt. „Und was dann?“, fragte er, um selbst die Antwort zu geben: „Dann wird das Jahr X geboren sein.“78 Dieses Jahr X ließ nicht lange auf sich warten. Im Juni 1914 tötete der gerade 19 Jahre alte Gavrilo Princip, Mitglied des Geheimbundes Mlada Bosna („Junges Bosnien“) Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo. Wenige Wochen später folgten seinen Schüssen zahllose weitere: Europa stolperte in den Krieg. Das Habsburgerreich, das über Jahrhunderte gewachsene multi-kulturelle Großprojekt, sollte ihn nicht überleben. Der Nationalismen, die sich Bahn brachen, wurde es nicht mehr Herr.