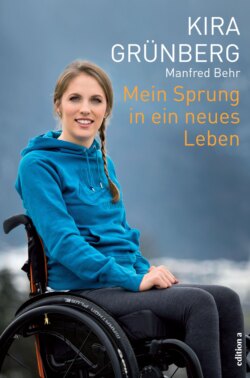Читать книгу Mein Sprung in ein neues Leben - Kira Grünberg - Страница 6
War’s das?
ОглавлениеHinter der Tür wartet das große, schwarze Loch. Bedrückend und ein wenig bedrohlich. Stickig heiß im Sommer, kalt und zugig im Winter. Heimstätte für Spinnen und anderes Getier. Kein Ort, an dem man länger als unbedingt nötig verweilen möchte. Aber so sind alte Dachböden nun mal. Auf unserem lehnen, unter all dem Gerümpel, von dem niemand so genau zu sagen vermag, warum es hier und nicht auf irgendeiner Mülldeponie vor sich hin gammelt, in einer dunklen Ecke zwei Krücken. Wir nennen sie ehrfurchtsvoll „die Familienkrücken“.
Meine Mutter Karin ist als Erste mit ihnen durch die Gegend gehumpelt. Vor gut und gern zwölf Jahren, nachdem sich ihre Achillessehne beim Sprinttraining mit einem lauten Schnalzer verabschiedet hatte. Seither mussten die Gehbehelfe für meinen Opa (Knieersatzgelenk) und meine Schwester Brit herhalten. Ab 15. Juli 2015 war schließlich ich für vier Tage die Nutznießerin. Weil mich, so wie Brit bereits dreimal, ein lädiertes Außenband im oberen Sprunggelenk zur Schonung nötigte.
Das Malheur war bei der Hürdengymnastik passiert, eine Übungsfolge, bei der man die Hindernisse eng aneinanderreiht und sie mit raumgreifenden Schritten aus dem Stand überwindet. Der Schmerz, als ich mit der Außenkante des rechten Fußes über die Hürde rollte, verhieß nichts Gutes. Zumal auch das Eintauchen in einen Kübel mit kaltem Wasser keine Linderung brachte. Ich war auf die Diagnose „Bänderriss“ gefasst, als ich in der Praxis von Dr. Christian Hoser, meinem langjährigen medizinischen Begleiter, Freund der Familie und sogar zeitweiligen Trainingspartner (der Masters-Mehrkämpfer überwindet mit dem Stab Höhen von vier Metern!) vorstellig wurde. Ein Röntgenbild und eine Ultraschalluntersuchung später war es ärgerliche Gewissheit: Ligamentum fibulotalare anterius gerissen, Ligamentum fibulocalcaneare eingerissen. Klingt unheilvoll, war es auch.
Von der Leichtathletik-WM im Olympiastadion von Peking trennten mich nur noch sechs, vom Limitschluss nur mehr vier Wochen. Anspruchsvolle 4,50 Meter hatte der Internationale Leichtathletikverband IAAF als Richtmarke festgesetzt, fünf Zentimeter über meiner Anfang März in Prag erzielten Bestleistung. Das versetzte mich keineswegs in Panik. Ich hatte die Leistungen der internationalen Konkurrenz stets im Auge behalten, war mir sicher, dass man am Ende auf mich als erste oder zweite Nachrückerin zurückgreifen würde, um das angepeilte Feld von 30 Athleten aufzufüllen. Ich aber wollte mich aus eigener Kraft qualifizieren und das idente Olympialimit gleich mit abhaken.
Also switchte ich noch am gleichen Tag in den Therapiemodus, ließ mir von Dr. Hoser eine Schiene verpassen – eine kleinere für untertags, eine größere für die Nachtlagerung – und wählte die Nummer des Physiotherapeuten meines Vertrauens. Klaus Ullmann hatte meine müden Knochen, Muskeln und Sehnen noch jedes Mal auf Vordermann gebracht, und das von meinem 14. Lebensjahr an. Er ließ mich auch diesmal nicht hängen, beorderte mich zwecks Akutbehandlung an dem gleichen Abend zu einem Gasthof in Rum, wo er einen Teil des Skisprung-Nationalteams um sich geschart hatte. Die Lymphdrainagen an diesem und dem nächsten Tag sorgten dafür, dass die Schwellung keine allzu imposanten Ausmaße annahm.
Den Rest besorgten die Sporttherapie Huber in Rum, die sich des Stabilisationstrainings annahm – und ich. Bei jeder Gelegenheit lagerte ich die Beine hoch, pappte Topfen auf die schmerzenden Körperstellen, schmierte Salben drauf, legte Verbände an. Und veranlasste meinen Vater Frithjof, unseren 5,5 mal 2,5 m kleinen Pool mit Wasser zu befüllen. Für meine nächste Therapieeinheit: Aquapaddling, auf der Luftmatratze liegend, während mir die Sonne auf den Rücken schien. So eine Zwangspause hatte zweifellos auch ihre guten Seiten. Zumal sich ihr Ende früher ankündigte als befürchtet. Vielleicht lag es an den netten Genesungswünschen, die mir das österreichische Team von der Leichtathletik-U20-EM im schwedischen Eskilstuna übermittelt hatte. Die Botschaft blieb für zwei Wochen der letzte Eintrag in meiner Facebook-Aktivitätenliste. Und sie war nicht schlecht gewählt:ihrer zeitlosen Aktualität wegen.
An diesem 18. Juli, drei Tage nach dem Bänderriss, entledigte ich mich der „Familienkrücken“, ließ sie vorsichtshalber aber noch nicht in dem schwarzen Loch hinter der Dachbodentür verschwinden. Meinem Manager Tom Herzog schickte ich als Beweis meiner zurückkehrenden Fitness ein Selfie-Video, das meine Füße zeigte, wie sie sich ohne jede Unsicherheit, ohne jedes Wackeln Schritt für Schritt vorwärts bewegten. Mussten sie auch, denn ein paar Stunden später waren sie einer beachtlichen Belastungsprobe ausgesetzt. Wir hatten Papa zum 57er eine Paintball-Session geschenkt, die es einen Tag nach dem Geburtstag einzulösen galt. Dr. Hoser hatte mir für den Spaß grünes Licht gegeben. „Solange du die Schiene trägst und nur robbst, sollte es kein Problem geben.“ Die Schiene habe ich artig getragen, und gerobbt bin ich auch. Ab und zu zumindest. Und überhaupt: Das Band war ohnehin schon gerissen. Was sollte denn noch Schlimmeres passieren?
Der Zustand des Sprunggelenks verbesserte sich trotzdem stetig, und exakt eine Woche nach dem Fehltritt wagte ich mich wieder in die WUB-Trainingshalle in Innsbruck. Das Krafttraining für den Oberkörper hatte ich ohnehin nie unterbrochen, jetzt aber schreckte ich, geschützt durch eine schnittige Aircast-Schiene, auch vor ersten Trainingssprüngen nicht zurück. Von einem Sprungkasten zwar, aber immerhin. Der ersparte mir die Belastung des Anlaufs, denn die zwei Schritte reichen problemlos, um viele technische Komponenten des Sprunges durchzuspielen. Am übernächsten Tag, dem 24. Juli, war ich noch ein wenig kecker, ließ die Schiene Schiene sein und bestritt das Training lediglich mit einem getapten Sprunggelenk. Auch diese Belastungsprobe verlief zu meiner vollsten Zufriedenheit. Worauf ich einen weiteren Tag später auf den Kasten verzichtete und meinem rekonvaleszenten Bein den Anlauf auf dem Betonboden mit aufgelegten Tartan-Läufern zumutete. Nicht die vollen 16 Schritte, wie ich sie seit dieser Saison zwecks Geschwindigkeitsmaximierung in Wettkämpfen praktizierte, aber zumindest die Hälfte. Und zwei Tage später schon zwei Drittel. Üblicherweise beinhaltete mein Trainingsprogramm nur zwei Stabeinheiten pro Woche, doch nach dem Bänderriss galt es, verlorenes Terrain zurückzuerobern, das richtige Gefühl aufzubauen. Meine Taktik schien zu greifen, die Sprünge fühlten sich jedenfalls richtig vielversprechend an, und so war meine Entscheidung alsbald in Stein gemeißelt. Die Union Leichtathletik Gala am 1. August auf der Linzer Gugl sollte Schauplatz meines Comebacks, im Idealfall meines erfolgreichen Limitversuches sein. Kein schlechter Boden für mich, hatte ich doch dort 2014 den österreichischen Freiluftrekord zwischenzeitlich auf 4,41 Meter geschraubt.
An meiner unmittelbaren Wettkampfvorbereitung hatte ich über viele Jahre herumexperimentiert, bis sich schlussendlich ein ganz simples Timing als für mich am zweckmäßigsten herauskristallisiert hatte: drei Tage vor dem Tag X das letzte Training, rund 24 Stunden davor eine kurze Krafteinheit, um den Muskeltonus und damit die nötige Spritzigkeit für den Ernstfall aufzubauen. So wollte ich es auch diesmal wieder handhaben – bis mir mein Vater per Anruf eröffnete, berufsbedingt einen Tag länger in der Schweiz bleiben zu müssen. Ein unbedeutendes Detail, wäre mir Papa nicht mein ganzes Stabhochsprungleben lang als Coach zur Seite gestanden. Das Abschlusstraining ohne ihn zu bestreiten kam so gar nicht infrage. Es musste also am Morgen des 30. anstatt des 29. Juli über die Bühne gehen. Keine große Affäre, ich war erfahren und selbstsicher genug, um mich von so einer kleinen außerplanmäßigen Änderung nicht ansatzweise aus der Ruhe bringen zu lassen. Wir waren schon viele Male von meinem bevorzugten Timing abgewichen – wetterbedingt zum Beispiel, oder weil wir sehr spät am Wettkampfort angekommen waren, ich aber noch die Stabhochsprunganlage austesten wollte.
Der Tag, der mein Leben so tiefgreifend und nachhaltig verändern sollte, begann denkbar unspektakulär. Wie üblich riss mich mein Wecker um 6.15 Uhr aus einem tiefen, ungestörten Schlaf, in den 55 Minuten bis zum Verlassen des Hauses galt es, die Trainingstasche zu packen, Morgentoilette, Frühstück (wie so oft Hirse mit Obst und Nüssen) und einen kurzen Check, was der befreundete Teil der Welt über Nacht so alles auf Facebook abgesondert hatte, unterzubringen. Mein erster Weg führte mich zum mittlerweile sechsten Mal seit dem Außenbandriss zur Sporttherapie Huber, wo die für mich zuständige Physiotherapeutin bereits in den Startlöchern scharrte. Auf dem Weg zu ihr hatte ich mich bei meiner Dienststelle, dem Heeres-Leistungssportzentrum 06, gemeldet. Vizeleutnant Walter Hechenberger, der Kommandant des HLSZ in Innsbruck, schätzte es über alle Maßen, die zu genehmigende telefonische Standeskontrolle zwischen 7.45 und 8.00 Uhr entgegenzunehmen.
Als ich das Therapiezentrum in Rum Richtung Innsbruck verließ, kündigte sich ein eher unfreundlicher, windiger Julitag an, der kälteste in diesem Jahrhundertsommer 2015. Eine undurchdringliche Wolkenschicht hing schwer über dem Inntal, kein Wunder, dass sich auch die Temperatur nicht aus der Reserve locken ließ. Nicht einmal über die 15-Grad-Grenze. Früher hätte ich mich auf eine erfrischende Trainingseinheit auf dem Sport-Campus der Universität Innsbruck einstellen müssen, doch seit 2013 stand uns Leichtathleten mit der WUB-Halle (auf dem Areal der früheren Wagnerschen Universitäts-Druckerei) eine provisorische, aber durchaus passable Indoor-Homebase zur Verfügung, die 2016 durch einen Neubau ersetzt wurde. Ich nützte die Möglichkeit weidlich aus, nicht nur bei Schlechtwetter. Die Halle steigerte signifikant die Trainingseffizienz. Keine abgebrochenen Sprungversuche wegen plötzlich auftretender Windböen, keine Ablenkung, kein aufwendiges Hin- und Hertransportieren des 20 Kilo schweren Trainingsequipments, zu dem auch mehrere der rund zwei Kilo schweren Stäbe gehörten. All das hatte ich in der Halle jederzeit griffbereit.
Als ich um 9.15 Uhr eintraf, herrschte in der Trainingsstätte erwartungsgemäß keinerlei Betrieb. Die Sportkollegen fanden sich zumeist erst nachmittags und abends ein, viele hatten ihre Wettkampfsaison ohnedies schon beendet, andere befanden sich bereits auf Urlaub. Störte mich nicht im Geringsten, ich fühlte mich fit, war motiviert, freute mich auf das Training und einen Nachmittag ohne jegliche Termine und Verpflichtungen. Fernsehen, Candy Crush auf dem Handy spielen, Müßiggang, die Batterien aufladen – so und nicht anders wäre der Tag vor der Abreise nach Linz in weiterer Folge verlaufen. Ich begann mit meinem Aufwärmprogramm: Dehnen, Laufübungen, Lauf-ABC. Letzteres beinhaltete unter anderem koordinative Übungen, seitliches Übersteigen, Skipping und Hopserläufe. Während des Warm-ups trudelten meine Eltern ein. Auch meine Mutter hatte längst einen fixen Part innerhalb des Teams eingenommen. Sie war während der Trainings für das Videomanagement zuständig, zeichnete jeden meiner Sprünge auf. Als Hilfestellung für unmittelbare Korrekturen und als Instrument profunder Analysen in der Nachbereitung. Papa wiederum konzentrierte sich zur Gänze auf die Trainingsgestaltung und die Ausführung meiner Versuche.
Am Beginn jeder Einheit stand ein Austausch hinsichtlich der abzuarbeitenden Trainingsinhalte. Papa hatte mich zu einer mündigen Athletin erzogen, die viel hinterfragte, die den Nutzen dieses oder jenes Elementes begreifen wollte. Und die auch mal zu diskutieren anfing, wenn ihr der tiefere Sinn dieser oder jener Übung verborgen blieb. An diesem 30. Juli gab es nichts zu diskutieren. Im Fokus stand, mich an die Wettkampfsprünge heranzutasten, ein positives Gefühl abzuspeichern, mich optimal vorzubereiten. Der Schlüssel dazu: ein paar gelungene Vorübungen. Ich begann mit vier Schritten Anlauf, verwendete dafür einen starren Stab, an dem man nach dem Absprung mehr oder minder nur dranhängt, landete wie geplant einmal auf den Füßen, einmal im Sitzen, einmal auf dem Rücken und einmal auf dem Bauch. Alles im grünen Bereich, keine Wiederholungen nötig. In der Folge war ausgemacht, nach jeweils zwei gut gelungenen Versuchen die Anlauflänge um vier Schritte zu erhöhen. Beginnend mit acht, dann zwölf, bis zu meiner damals maximalen Schrittzahl von 16.
Ich wählte einen weichen Stab, der sich auch mit nur acht Schritten vortrefflich biegen lässt, begann mit der Vorbereitung auf den Sprung, sprühte ein wenig Klebeharz auf die Hände, um mehr Grip zu erhalten, und richtete mir das Schweißband am linken Handgelenk, um die obligatorischen blauen Flecken zu vermeiden. Dann setzte ich mich in Bewegung. Ein letztes Mal.
Gleichzeitig drückte Mama die „Record“-Taste der Videokamera. Es war exakt 9.40 Uhr. Aufnahme lief. Etwa 15 Sekunden lang. Cut.
Ich habe das Unfallvideo mittlerweile sicherlich zehnoder zwölfmal gesehen. Selten mit Trauer oder Wehmut, viel öfter mit detektivischer Neugier, was um alles in der Welt bei diesem Sprung so derart schiefgelaufen ist. Ohne eine befriedigende Antwort erhalten zu haben. Das Video per se hinterlässt den Betrachter keineswegs schockiert. Zumindest wenn man den Ton ausgeschaltet lässt. Die Schreie, die ich nach dem Überqueren der Schnur in vier Meter Höhe und beim Aufprall auf dem Boden von mir gab, sind nicht jedermanns Sache. Es hört sich an, man möge mir den drastischen Vergleich nachsehen, als ob ein Schwein abgeschlachtet würde. Zu sehen aber sind nur Anlauf, Absprung, Flugphase – und dass ich nicht dort lande, wo ich hätte landen sollen. Im Einstichkasten nämlich und nicht auf der Matte. Dieser Einstichkasten jedoch ist durch die Seitenteile der Matte verdeckt. Ich verschwinde gewissermaßen spurlos darin. So wie sich meine ganze Sportkarriere, von ein paar nackten Zahlen in den Rekord- und Ergebnislisten abgesehen, in Sekundenbruchteilen in Nichts aufgelöst hat.
Es gibt Möglichkeiten zuhauf, einen Versuch vorzeitig abzubrechen. Indem man den Stab kurz vor dem Absprung wegwirft und durchläuft, wenn sich abzeichnet, dass die Anlauflänge nicht gepasst hat. Indem man nicht aufrollt, sich an den Stab klammert und loslässt, sobald man sich über der Matte befindet, wenn beim Absprung Unvorhergesehenes eintritt. Oder sich, wenn der Sprung weiter fortgeschritten ist, vom Stab in der Luft Richtung Matte abstößt. Ich machte von keiner dieser Optionen Gebrauch. Weil sich der Versuch beim Absprung gut angefühlt hatte. Erst in der Streckphase beschlich mich das Gefühl, dass es dem Sprung an Tiefe fehlen könnte. Aber abbrechen? Ich hatte bestimmt schon 50 Sprünge dieser Art im Laufe meiner Karriere ohne gravierende Blessuren überstanden. Weil man äußerst selten kerzengerade vertikal nach unten fällt, sich daher zumeist auf einen Seitenteil der Matte retten kann.
Gravierender Fehler lässt sich keiner feststellen, das bestätigte mir auch Weltrekordler Renaud Lavillenie, der mich in der Reha in Bad Häring besucht hat. Zumindest keiner, der diese Folgen erklärbar macht. Wenn überhaupt, dann hatten sich mehrere kleine Unzulänglichkeiten summiert. Vielleicht fehlte mir nach dem Bänderriss durch die verpassten Lauftrainings der letzten Tage noch eine Nuance zur gewohnten Geschwindigkeit, vielleicht hatte ich für diesen Speed um eine Spur zu hoch gegriffen, dem Stab beim Absprung zu wenig Energie gegeben, zu wenig mit den Armen, mit den Schultern gearbeitet. Und dennoch: Ich hatte die Schnur, die man im Training anstelle einer Latte verwendet, überquert, um dann, allen physikalischen Gesetzmäßigkeiten zum Trotz, im Flug die Richtung zu ändern. Als mir über der Schnur bewusst wurde, wohin die Reise gehen würde, war es für Korrekturen längst zu spät. Es schien, als würde mich eine geheimnisvolle Kraft von der Matte wegziehen.
Ein Bewegungsablauf aus dem Lehrbuch endet klarerweise auf dem Stabhochsprungkissen. Als Faustregel gilt: je weicher der Stab, desto weiter weg vom Einstichkasten erfolgt die Landung. Im Extremfall kommen die Fersen in ausgestreckter Rückenlage einen Meter von der Mattenkante entfernt zum Liegen. Bei der Verwendung von harten Stäben können die Beine bereits ab der Kniekehle von der Sprungmatte baumeln. Ich aber verfehlte bei meinem letzten Karrieresprung diese „Landebahn“ um 1,2 bis 2,2 Meter. Eine Welt.
Welche „Maßarbeit“ andererseits nötig war, in der Absprungzone zu liegen zu kommen, lässt ein Blick auf die Form derselben erahnen. Der 1,2 Meter lange, trapezförmige Einstichkasten aus Metall (wie in der WUB-Halle) oder Hartplastik weist an der dem Anlauf zugewandten Seite eine Breite von 60, an der der Matte zugewandten Seite eine solche von nur mehr 15 Zentimetern auf. Durch die Neigung des Innenlebens von 11,3 Grad findet sich am Ende des Einstichkastens auch der tiefste Punkt, 20 Zentimeter unterhalb der Oberkante. Er leitet den Athleten bzw. den Stab damit gewissermaßen zum idealen Absprungpunkt. Innen- und Außenmaße divergieren wegen der Aufbauten stark. Die Breite beträgt an der Außenkante 84 (Anlaufseite) bzw. 65 Zentimeter (Mattenseite). Mit einem Abstand von rund zehn Zentimetern zu den Seitenteilen der Matte ergibt sich ein an der engsten Stelle etwa 85 Zentimeter breites Loch, in das ich aus vier Meter Höhe zielsicher und krachend hineinstürzte. Nicht kopfüber, wie die ersten Medienberichte signalisierten, sondern, wie bei jedem geglückten Sprung auch, horizontal. Aber so unglücklich, dass ich mit dem fünften Halswirbel auf die vorderste Kante des Einstichkastens prallte, die das Rückenmark auf Höhe des sechsten Halswirbels massiv beschädigte. Die Kräfte, die bei einem Aufschlag auf einer Metallkante aus dieser Höhe frei werden, kann man sich ausmalen. Die Folgen, die eine ebensolche schwere Quetschung oder gar Durchtrennung des Rückenmarks auf Höhe des zweiten Halswirbels, zwei, drei Zentimeter weiter oben, nach sich gezogen hätte, ebenso. Fazit: Game over.
Mein Kopf ragte also über die Absprungvorrichtung hinaus, berührte vermutlich am Scheitel die Matte; Rumpf, Arme und Beine waren, da wo sie reinpassten, im 20 Zentimeter tiefer liegenden Einstichkasten positioniert; alles, was dort keinen Platz fand, ruhte auf den Aufbauten rundherum. Ein riesiger blauer Fleck Höhe der linken Niere zeugte von der Wucht des Aufpralls. In dieser misslichen Lage fanden mich meine Eltern, die von ihrer seitlichen Beobachterposition zur Unglücksstelle gesprintet kamen. Es ist schwer zu rekonstruieren, welche Gedanken in den Momenten nach dem Aufprall durch meinen Kopf rasten, aber ich nahm instinktiv wahr, dass mein Leben nach dem 30. Juli 2015 ein anderes sein würde als davor. Allem voran deuteten die gut spürbaren letzten Nervenzuckungen in meinen Beinen darauf hin. „War’s das?“, fragte ich meine Eltern, ohne heute zu wissen, was genau ich mit „das“ gemeint haben könnte. Die Karriere? Das Leben?
Mein Vater bedeutete mir, mich zunächst einmal gar nicht zu bewegen. Er machte sich daran, Kopf und Rücken zu stabilisieren, mich in eine annähernd horizontale Liegeposition zu bringen. Nachdem seine Kräfte nach ein paar Minuten zu schwinden begonnen hatten, gelang es meiner Mutter, mir Kleidungsstücke unterzuschieben, um meine Schultern zu entlasten, die auf dem harten Metall der Kastenumrandung lagen. Ich bat Mama, mir die Sportschuhe auszuziehen. Irgendwie hatte ich abgespeichert, dass das in solchen Situationen zu tun sei. Obwohl es für mich keinerlei Unterschied machte. „Bewege einmal deine Beine“, forderte mich Papa auf. „Bewegst du schon?“, frage er kurz darauf, und ich bejahte. „Gut machst du’s“, lobte er, aber ich sah nur allzu deutlich, dass sich meine Beine überhaupt nicht rührten. Jeder von uns wusste, was das zu bedeuten hatte, und ich artikulierte es auch. „Das kann’s doch nicht gewesen sein. Bin ich jetzt gelähmt?“ Meine Eltern redeten mir gut zu, und Papa entgegnete: „Sag doch so was nicht. Versuche doch mal, deine Arme zu bewegen!“ Ganz allmählich war ein leichtes Heben zu bemerken, das von der Schulter ausging. „Na bitte, die Arme funktionieren ja.“ Ich konnte seinen Optimismus nicht ganz teilen, hatte ich mir doch vorgenommen, eine Faust zu machen …
In meiner Erinnerung war ich diejenige, die Mama aufforderte, die Rettung anzurufen. Aber in der Hektik fiel uns die korrekte Notrufnummer nicht ein. „Ruf halt 133, irgendwer wird schon abheben“, hoffte ich. Wie nicht anders zu erwarten, landete meine Mutter beim Polizeinotruf, der die wichtigsten Daten aufnahm und ihr die Nummer der Rettung mitteilte. Die war bereits informiert, als Mama den Sachverhalt durchgeben wollte, und wies sie nur mehr an, sich außerhalb der Halle zu postieren, um den Einsatzkräften den Weg zur günstigsten Zufahrt zu zeigen. „Sie sollen sich beeilen“, gab ich den Einsatzkräften mit auf den Weg, die sich nicht lange bitten ließen. Sieben Minuten später rollten zwei Kranken- und ein Notarztwagen in die Leichtathletikhalle. Noch schneller war nur die Polizei an Ort und Stelle gewesen.
In Ausnahmesituationen wie dieser funktioniert man wie ein Roboter, hinterfragt nicht viel. Möglich, dass meine Mutter dem Wunsch der Beamten sonst nicht nachgekommen wäre, das Video von meinem Unglückssprung vorzuführen, während die Rettungsleute alle Hände voll zu tun hatten, mich aus dem Einstichkasten zu bergen. Die Amtshandlung gipfelte nach einer kurzen Befragung, ob zum Zeitpunkt des Unglücks weitere Personen anwesend waren, in der Erkenntnis, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fremdverschulden nicht sehr wahrscheinlich war. Da waren Freude und Erleichterung natürlich groß.
Auch bei den Rettungskräften musste alles seine Ordnung haben. Auf Nachfrage ratterte ich anstandslos meine Versicherungsnummer herunter, nur die e-card hatte ich nicht griffbereit. Die war sicher in der Geldtasche in meinem Auto verwahrt, von wo sie Mama umgehend herbeischaffte. Ich kann mich an keinen Moment aufkommender Panik erinnern, sehr wohl aber an die Frage, die ich an mich selbst richtete: „Wie wird mein Leben jetzt wohl weitergehen?“ Ich vergoss auch keine Tränen, glaube aber, dass man in solchen Momenten viel zu sehr damit beschäftigt ist, einfach am Leben zu bleiben. Denn selbiges hing, ohne dass ich es wusste, an einem seidenen Faden. Oder eigentlich an zwei. Denn von den vier Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgen, pumpten zu diesem Zeitpunkt nur mehr die beiden Arteriae carotides internae, die inneren Halsschlagadern. Die zwei Arteriae vertebrales (Wirbelarterien) hingegen waren durch den Aufprall gequetscht und abgeklemmt worden. Eine Schmalspurversorgung, die im schlimmsten Fall zum Hirntod führen kann. Doch auch die plötzliche Öffnung einer der Wirbelarterien hätte mich in akute Gefahr bringen können. Das Eindringen eines Blutpfropfens ins Gehirn löst im Normalfall einen Schlaganfall aus.
Gut, dass ich von diesen Szenarien erst viel später erfuhr – am Beginn der Rehabilitation. Und deswegen die längste Zeit blutverdünnende Mittel verschrieben bekam. Ich wäre im Lauf des Rettungseinsatzes wohl noch ein bisschen angespannter gewesen, hätte auch nicht die Muße gehabt, der Konversation meiner Mutter mit der Notärztin zu lauschen. Die nette Medizinerin berichtete, mich aus der Zeitung zu kennen, erst unlängst einen Artikel über mich gelesen zu haben. Und dass es ihr leidtäte, mich unter solchen Umständen wiederzusehen. Mir auch, das konnte sie mir glauben. Ein Sanitäter verpasste mir eine Plastik-Halskrause, die Notärztin legte mir einen Zugang zur Vene, über den mir, so vermutete ich zumindest, Beruhigungs- und Schmerzmittel gespritzt wurden. Prophylaktisch eher, denn von Schmerzen war ich keineswegs geplagt. Wie denn auch, wenn man vom Hals abwärts nichts spürt?
Was ich aber sehr wohl als äußerst unangenehm empfand, war dieses Kribbeln auf der Haut meiner Arme, das sich bei jeder Berührung verschlimmerte. Zum ersten Mal fiel mir diese Wahrnehmung auf, als mich Mama kurz nach dem Unfall streichelte, um mir gut zuzureden, mir Mut zu machen. Es fühlte sich an, als würden Ameisen über meine Arme laufen, als würde meine Haut regelrecht explodieren. Die Empfindung blieb für die nächsten zwei Wochen meine unliebsame Begleiterin.
Für die sieben Sanitäter entpuppte sich die Bergung als ganz schön schwierige Übung. Die für derartige Fälle vorgesehene ausklappbare Liege erwies sich im Einstichkasten als unbrauchbar, die Matten links und rechts verhinderten, dass sie zur Entfaltung kam. Rund 15 Minuten dauerten die Versuche, mich aus meiner Notlage zu befreien und in den Krankenwagen zu hieven. Am Ende trugen mich die Rettungskräfte buchstäblich auf Händen. Als alles verstaut war und dem Abtransport nichts mehr im Wege stand, bemerkte ich, dass Clemens von meiner Seite gewichen war. So hieß jener Sanitäter, der Papa als meine „Kopfstütze“ abgelöst hatte. Zu ihm hatte ich in den vergangenen Minuten scheinbar eine Art Vertrauensverhältnis aufgebaut. Mein Wunsch, dass er mich, zusätzlich zu meiner Mutter und anstelle eines Sanitäters, den ich bisher nur aus der Ferne wahrgenommen hatte, im Rettungsauto begleiten möge, stellte die Einsatzleitung vor gewisse organisatorische Probleme, zumal Clemens einer anderen Rettungsorganisation zugehörig gewesen sein dürfte als der Krankenwagen, in dem ich mich befand. Am Ende wurde meiner Bitte doch entsprochen, und der Tross setzte sich Richtung Landeskrankenhaus in Bewegung.
Unterdessen hatte Mama bereits unser nächstes Umfeld über die unerfreulichen Entwicklungen informiert – und auch niemanden im Unklaren gelassen, mit welcher Diagnose zu rechnen sei. Zuerst alarmierte sie Angie, die Mutter eines meiner Trainingskollegen, die als Sprechstundenhilfe für unseren Vertrauensarzt Christian Hoser arbeitet. Sie muss ihn umgehend erreicht und er alles stehen und liegen gelassen haben, traf er doch ziemlich gleichzeitig mit uns im Uniklinikum, seiner ehemaligen Arbeitsstätte, ein. Der zweite Anruf galt meinem Freund Christoph, der in seiner Wohnung in Graz saß und an der Bachelorarbeit feilte. Der dritte meinem Manager Tom Herzog, der vierte meiner Schwester Brit. „Brauchst aber nicht zu kommen“, legte Mama ihr nahe, weil sie offenbar fand, dass man das Leid nicht auf noch mehr Personen verteilen müsse. Brit dachte nicht daran, untätig zu Hause auf Nachrichten zu warten, und brach auf, wurde unterwegs aber von Mama zur WUB-Halle umdirigiert. Dort hatte Papa, der per Pkw ins Krankenhaus hätte nachkommen sollen, ebenso fieberhaft wie vergeblich nach dem Autoschlüssel gesucht. Als Brit mein Trainingsdomizil betrat, sah sie die Schlüssel auf dem Stabhochsprungkissen liegen und Papa ein wenig konfus umherirren. Womit ihr augenblicklich klar wurde, dass es ohnedies besser sei, ihn in diesem Zustand nicht ans Steuer zu lassen.
Es waren 43 Minuten seit meiner Bruchlandung vergangen, als wir in der Notaufnahme eintrafen. Auf die holprige Fahrt mit Blaulicht und Sirene hätte ich durchaus verzichten können. Die Federung des Rettungsautos übertrug jede Bodenwelle, jedes auf den ungeteerten Wegen des WUB-Areals befindliche Schlagloch auf mich, und ich machte mir zunehmend Sorgen, dass sich meine Verletzung durch das permanente Durchgerütteltwerden weiter verschlimmern könnte. Wenigstens war ich durch Mamas Telefongespräche abgelenkt, ich hatte ihr noch aufgetragen, meinen Vorgesetzten beim Bundesheer, Vizeleutnant Hechenberger, über den Stand der Dinge zu informieren. Im Krankenhaus schob man mich sogleich in den Schockraum und bettete mich auf eine Krankenhausliege um. Mama musste draußen warten, und ich freute mich über das vertraute Gesicht von Christian Hoser, der kurz mit mir sprach, sich nach meinem Befinden erkundigte.
Unverzüglich wurde ein CT von Kopf und Halswirbelsäule angefertigt, das Aufschluss darüber geben sollte, wie es tatsächlich um mich stand. Alsbald begannen die Vorbereitungen für eine Operation, eine Notoperation, eine Operation als lebenserhaltende Maßnahme, wie meinem Manager später als Input für seine erste offizielle Aussendung mitgeteilt wurde. Bei mir verfehlten die diversen Medikamente und Mittelchen indessen ihre Wirkung nicht. Vieles von dem, was mir seit Jahren aufgrund der Anti-Doping-Bestimmungen bei Strafe verboten war, wurde nun in rauen Mengen in mich hineingepumpt. Und obwohl ich nicht auf die Idee kam, Einspruch zu erheben, so schoss mir doch zwischenzeitlich der Gedanke ein: „Wenn jetzt die Dopingkontrolleure kämen, hätten sie’s lustig mit mir.“
Nicht minder skurril gestaltete sich die Konversation mit dem medizinischen Personal. Eine Assistentin eröffnete mir, dass mein T-Shirt für die Operation aufgeschnitten werden müsse. Ich führe es auf mein wegen der Halskrause sehr eingeschränktes Blickfeld und auf meine Sedierung zurück, dass ich heftig protestierte, weil ich der irrigen Auffassung war, dasselbe coole, weiße Michael-Kors-Leibchen mit aufgedruckter rosa Brille zu tragen, das ich frühmorgens vor dem Weg zur Physiotherapie übergestreift hatte. Die Krankenhaus-Bedienstete versicherte mir, mein Lieblings-T-Shirt vorsichtig an der Seitennaht aufzutrennen, damit es später problemlos zusammengenäht werden könne. Zurück bekam ich es trotzdem nicht mehr. Bloß gut, dass es sich letztlich nur um ein schmuckloses Textil fürs Training gehandelt hatte.
Rund um mich wurde eifrig gewerkt, aber ich hatte zahlreiche Fragen: „He, bin ich eigentlich schon nackig?“, wollte ich mehrfach wissen, denn die Halskrause verunmöglichte mir auch diesen Blickwinkel. Einen jungen, südländisch aussehenden Mitarbeiter fragte ich schließlich mit ehrlichem Interesse: „Schlägt mein Herz eigentlich noch?“ Die Antwort des Angesprochenen entbehrte nicht einer gewissen Logik. „Sonst könntest du wohl kaum mit mir reden.“ Ich aber ließ nicht locker. „Könnte ja sein, dass ihr mich an eine Maschine angeschlossen habt.“ Das war ihm dann offensichtlich doch zu blöd. Weniger wissbegierig war ich, als mich die operierenden Ärzte aufsuchten und mir begreiflich machen wollten, was passiert war und was sie während der Operation zu tun gedachten. Mich schreckte die Vorstellung, dass mir die Chirurgen womöglich eine günstige Prognose stellten, mir in Aussicht stellten, gehen zu können, und dann beim Eingriff irgendetwas misslang. Also wehrte ich die Aufklärungsversuche mit den Worten ab: „Operiert doch mal, dann sehen wir ja, was rauskommt.“ Kurz darauf kam meine Familie, die sich sehr wohl über den Stand der Dinge hatte informieren lassen, um sich von mir zu verabschieden und mir Glück zu wünschen. Dann war ich wieder mit dem Ärzteteam allein, das darüber diskutierte, ob es mich bereits im Schockraum oder erst im Operationssaal narkotisieren sollte. Es dürfte sich für Variante eins entschieden haben. Denn ich war dann mal weg.