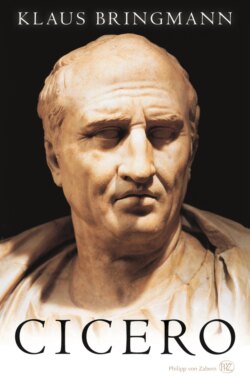Читать книгу Cicero - Klaus Bringmann - Страница 16
Der Aufstieg: Aedilität und Praetur
ОглавлениеWas für den Rückkehrer aus der Provinz der Entschluss bedeutete, von nun an sein Leben für die Politik ganz in Rom zu verbringen, hat Cicero in seiner Rede Für Plancius so beschrieben: „Ich legte es darauf an, dass sie [die Römer] mich nunmehr Tag für Tag für sich hatten, ich lebte förmlich unter ihren Augen, ich ließ nicht vom Forum; niemand wurde von meinem Pförtner oder meinem Schlaf daran gehindert, bis zu mir vorzudringen.“1 Das Haus der Familie Ciceros in Rom lag in den Carinae, in einer guten Wohngegend, aber auf Dauer genügte es nicht den Ansprüchen eines ganz der Öffentlichkeit zugewandten Lebens in repräsentativem Rahmen. Es dauerte freilich bis zum Jahre 62, bis Cicero um den Preis einer erheblichen Verschuldung und Gefährdung seines guten Rufes den Palast erwerben konnte, den der große Reformer Marcus Livius Drusus, Volkstribun des Jahres 91, am Nordostvorsprung des Palatins, in der bevorzugten Wohngegend der politischen Prominenz, hatte errichten lassen.2 Livius Drusus hatte von seinem Architekten verlangt, den Palast so zu bauen, dass er bei Konferenzen und Empfängen auch von außen gesehen werden konnte. Der Architekt hatte ursprünglich andere Absichten. Er wollte einen Bau errichten, der den Bauherrn vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit abschirmte. Aber da kam er bei Livius Drusus schlecht an. „Im Gegenteil“, sagte er, „wenn Du Deine Kunst verstehst, dann baue mir das Haus so, dass alles, was ich tue, von jedermann beobachtet werden kann!“3 Als er dort in der kritischen Phase seines Volkstribunats einen seiner Massenempfänge abhielt, wurde er im Gedränge von einem unerkannten Täter niedergestochen und tödlich verletzt. Livius Drusus stand mit seiner ganzen Existenz für den Versuch einer durchdachten Lösung der großen Probleme des römischen Staates ein, der Integration der italischen Bundesgenossen in den römischen Bürgerverband, der Wiederaufnahme der Landverteilung und der Beilegung des Konflikts, der sich zwischen dem Senatoren- und Ritterstand über die Frage der Zusammensetzung der Richterliste ergeben hatte.4 Aber er scheiterte am fehlenden Konsens über das von ihm vertretene Reformprogramm. Seinem Scheitern folgten der Bundesgenossenkrieg und ein Bürgerkrieg, der die Nobilitätsherrschaft in ihren Grundfesten erschütterte – bis Sulla sie um den Preis einer gesellschaftlichen Destabilisierung und eines schwerwiegenden Eingriffs in die politische Verfassung des römischen Staates wiederherstellte. Dieser Eingriff betraf das Volkstribunat, das Amt also, das seit den Gracchen Träger von Reformprojekten gewesen war, an denen sich die Geister schieden. Sulla nahm dem Volkstribunat sein wichtigstes politisches Recht, die freie Gesetzesinitiative, indem er diese von der Ermächtigung durch den Senat abhängig machte, und er verschloss das Amt allen, die an einer politischen Karriere interessiert waren, indem er verfügte, dass die Bekleidung des Volkstribunats die Bewerbung um weitere Ämter ausschloss.
Sulla hatte kaum die Macht aus der Hand gegeben, als der Kampf um die Wiederherstellung der alten Rechte des Volkstribunats begann. In dem Jahr, in dem Cicero Quaestor in Lilybaeum war, wurde den Volkstribunen die Möglichkeit weiterer Ämterbewerbungen zurückgegeben, doch die Agitation für ihr altes Recht auf freie Gesetzesinitiative ging weiter, bis die Konsuln des Jahres 70 Gnaeus Pompeius und Marcus Licinius Crassus dem Amt per Gesetz die alte Machtfülle zurückgaben. Sofort stellte sich die Konstellation wieder ein, die zur Zeit des Marius die regierende Klasse in Atem gehalten hatte, als das Bündnis zwischen dem großen Feldherrn und den Volkstribunen Appuleius Saturninus und Sulpicius Rufus in den Jahren 100 und 88 jeweils zu einem politischen Eklat führte. Nach dem Jahr 70 war der Nutznießer der wiederhergestellten politischen Befugnisse des Volkstribunats kein Anderer als ihr Wiederhersteller Gnaeus Pompeius, auch er ein großer Feldherr und Organisator großräumiger militärischer Operationen. Er hatte im Widerspruch zur Ämterordnung des römischen Staates vor seinem Konsulat kein einziges ordentliches Amt bekleidet, war aber mit einem außerordentlichen Militärkommando nach dem anderen betraut worden. Gegen eine solche Karriere außerhalb der bestehenden Normen gab es in der Nobilität Widerstand, doch mit Hilfe der Volkstribunen Aulus Gabinius und Gaius Manilius erreichte Pompeius den Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn: Im Jahre 67 wurde ihm durch Plebiszit ein das ganze Mittelmeergebiet umfassendes Kommando zur Beseitigung der Seeräuberplage übertragen, und nach seinem spektakulären Erfolg wurde ihm im folgenden Jahr auch die Beendigung des langwierigen Krieges gegen die Könige Mithradates von Pontos und Tigranes von Armenien übertragen. Die beiden Volkstribune fungierten als Werkzeuge des ehrgeizigen Feldherrn. Sie waren, anders als die großen Vorgänger von den Gracchen bis Sulpicius Rufus, nicht mehr Träger einer eigenständigen Reformpolitik. Deren alte Themen waren aufgebraucht, die neu entstehenden noch nicht recht greifbar, aber in die Zukunft wies bereits der Umstand, dass das Volkstribunat unmittelbar nach der vollen Wiederherstellung seiner Rechte in Abhängigkeit von einem der potentiellen Militärdespoten agierte, die der Republik zum Schicksal werden sollten.5
Diese hier in groben Zügen vorgestellte Entwicklung vollzog sich in den neun Jahren, die auf Ciceros Rückkehr aus Sizilien folgten. Er hat sie in keiner Weise beeinflussen können, denn er war noch ganz auf das Ziel seines persönlichen Ehrgeizes fixiert, in der regulären Ämterlaufbahn voranzukommen. Aus dem Blickwinkel der Nobilität war er ein Außenseiter, der zu ihr gehören wollte, und um dieses Ziel zu erreichen, musste er sich dem juste milieu dieser Aristokratie anpassen. Der Weg einer Konfrontation mit den optimatischen Traditionalisten, den manche Angehörige der alten regierenden Klasse einschlugen, wie später etwa Caesar, der damit den größten und verheerendsten Erfolg haben sollte, war einem Mann wie Cicero von vornherein verschlossen. In seinem Fall gab es dafür auch eine sachliche oder, wenn man so will, eine ideelle Begründung. Cicero war ein Verehrer der traditionellen Ordnung des römischen Staates, und obwohl er die Umstände der Wiederherstellung der Nobilitätsherrschaft durch Sulla bedauerte und kritisierte, entsprach das Ergebnis seinen Wünschen. Er betrachtete die durch eine großartige Erfolgsgeschichte legitimierte traditionelle Ordnung der römischen Republik als Realisierung des idealen Staates, wie er von der griechischen Staatsphilosophie konzipiert worden war, und hat später in den 50er Jahren diese Konzeption seinen staatstheoretischen Schriften De re publica und De legibus zugrunde gelegt.6 So kamen innere und äußere Hemmungen zusammen, die eine Bewerbung um das Volkstribunat von vornherein ausschlossen. Cicero vermied es so, sich in politische Konflikte verwickeln zu lassen, die seiner Karriere schädlich sein konnten, und er blieb seinen politischen Überzeugungen treu.
Umso intensiver mussten seine Bemühungen ausfallen, in das nur aus vier Mitgliedern bestehende Aedilenkollegium gewählt zu werden. Und da von den Amtsinhabern auch der Einsatz eigener Mittel für die Ausstattung von Spielen und unter Umständen für die Subventionierung von Lebensmitteln erwartet wurde, erhob sich die Frage, wie diese Mittel beschafft werden sollten. Was diesen Punkt anbelangt, kam Cicero ein Zufall zu Hilfe, der es ihm ersparte, sich zu verschulden. Er vertrat im Jahre 70 mit Erfolg die Gemeinden Siziliens in dem Verfahren gegen den korrupten Statthalter Gaius Verres, und die dankbaren Klienten revanchierten sich mit Spenden, die ihm erlaubten, für die Verbilligung der Lebensmittel zu sorgen.7 Nach seiner Rückkehr aus Lilybaeum blieben Cicero fünf Jahre, bis er im Jahre 69 das gesetzliche Alter für die Aedilität erreicht hatte. Er war Mitglied des Senats, er stimmte mit ab, aber zu Wort ist er wohl nie gekommen. Die Magistrate, die die Sitzungen leiteten, pflegten nur Angehörige der oberen Ränge des Standes um ihre Meinung zu befragen. Aber der Zufall der Überlieferung hat ein Dokument des Jahres 73 erhalten, in dem Cicero als Mitglied einer Senatskommission verzeichnet ist.8 Diese Kommission stand unter Leitung der Konsuln und hatte die Aufgabe zu prüfen, ob die römischen Steuerpächter berechtigt seien, Abgaben auch von Ländereien im böotischen Oropos zu erheben, die dem Lokalheroen Amphiaraos geweiht waren. Die Gesandten von Oropos beriefen sich darauf, dass in dem von Sulla stammenden Statut alles Land, das zur Unterhaltung von Heiligtümern diente, Abgabenfreiheit genießen solle, die publicani dagegen machten geltend, dass diese Bestimmung für die Heiligtümer der Götter, aber nicht der Heroen wie Amphiaraos gelte. Die Kommission klammerte diese subtile Frage indessen aus, sie zog alle einschlägigen Dokumente heran und stellte fest, dass Sulla in Einlösung eines Gelübdes alles Land im Umkreis von 1000 Fuß um den Tempel des Amphiaraos für heilig erklärt und darüber hinaus alle Einnahmen aus Stadt, Land und Hafen von Oropos für Spiele und Opfer reserviert hatte. Dies alles war durch einen Senatsbeschluss des Jahres 80 bestätigt worden. So fiel die Entscheidung der Streitfrage des Jahres 73 eindeutig zugunsten von Oropos aus, und der Senat erhob am 16. Oktober die Entscheidung der Konsuln zum Beschluss. Cicero hatte also nichts für seine spezielle Klientel, die publicani, tun können, aber er erinnerte sich noch im Alter, als er sein Werk Über das Wesen der Götter schrieb, an die Rechtsauffassung, die diese vertreten hatten: „Sind etwa Amphiaraos und Trophonia Götter? Unsere Staats- und Steuerpächter freilich haben, obwohl deren Ländereien in Böotien vom Verpachtungsstatut ausgenommen waren, bestritten, dass unsterbliche [Götter] seien, die einst Menschen gewesen waren.“9
Im Senat hat Cicero vermutlich zunächst alles vermieden, was seine Wahlchancen hätte mindern können. Neue Wähler aber musste er dadurch gewinnen, dass er einer möglichst großen Zahl von einflussreichen Leuten seinen Beistand vor Gericht lieh. Gleich im ersten Jahr nach seiner Rückkehr erschien in seinem Haus in Rom – es war das in den Carinae – die Prominenz von Aletrium, einer etwa 25 km westlich von Arpinum gelegenen Stadt, um ihn zu bitten, den Freigelassenen eines ihrer Mitbürger, des dem Ritterstand angehörenden Gaius Fabricius, in einem Giftmordprozess zu verteidigen.10 In Ciceros Augen ging es nicht in erster Linie um den Freigelassenen Scamander, sondern um diejenigen, die hinter dem Angeklagten standen. Wie heutzutage Abgeordnete Lobbyisten und Petenten zu fragen pflegen, in wessen Namen sie sprechen, so war Cicero bei der Übernahme des Falles wichtig, dass Scamander von prominenter Seite unterstützt wurde. Indem er sich die Leute verpflichtete, die in Aletrium Rang und Namen hatten, gewann er zukünftige Wähler und Fürsprecher. Dies alles ist für das Verständnis der römisch-italischen Gesellschaft und ihrer Verknüpfung mit dem politischen System typisch, und es lohnt sich, Ciceros eigene Schilderung zu zitieren: „Weil [Fabricius] wusste, dass ich mit den Alitrenaten in freundnachbarlichem Verhältnis und mit sehr vielen von ihnen in engem Umgang lebte, brachte er sie in großer Zahl zu mir in mein Haus … Weil er aus derselben Stadt war, glaubten sie es ihm schuldig zu sein, ihn so gut sie konnten zu verteidigen, und sie baten mich, ein Gleiches zu tun und die Sache des Scamander zu übernehmen, von der für seinen Patron alles abhing. Ich mochte diesen ausgezeichneten und mir so ergebenen Leuten nichts abschlagen und vermutete auch nicht, dass der Schuldvorwurf so erheblich und so triftig sei … Ich versprach ihnen also, alles zu tun, was sie von mir verlangten.“11
Cicero verlor den Prozess, und an den sich anschließenden gegen Scamanders Auftraggeber Gaius Fabricius und Statius Albius Oppianicus hatte er keinen Anteil mehr. Als acht Jahre später der damalige Ankläger Aulus Cluentius Habitus von seinem Stiefbruder beschuldigt wurde, den seinerzeit verurteilten Albius Oppianicus vergiftet zu haben, wechselte Cicero die Seite und verteidigte den Angeklagten. Auch dieses Mal waren wohl der Hauptgrund für die Übernahme des Falles die Freundschafts- und Patronatsverhältnisse, über die Cluentius verfügte. Der regionale Umkreis, aus dem sich dessen Fürsprecher rekrutierten, war größer, und der gesellschaftliche Rang, den sie einnahmen, bedeutender als bei dem Vorgängerprozess. Im Epilog seiner Rede Für Cluentius Habitus hat Cicero die bei der Verhandlung anwesenden Fürsprecher aufgerufen, um seinem Plädoyer zusätzliches Gewicht zu verleihen: „Denn wisst, ihr Richter, dass alle Larinaten, die hierzu imstande waren – es klingt unglaublich, doch ich sage die volle Wahrheit –, nach Rom gekommen sind, um Cluentius durch ihre Teilnahme und große Zahl, soviel an ihnen liegt, in dieser schlimmen Gefahr beizustehen … Und erst die Nachbarn: Wie groß ist ihr Eifer, wie unglaublich ihre Bereitwilligkeit, wie stark ihre Besorgnis! … Da sind die Frentaner, sehr ehrenwerte Leute, ebenso die Marruciner, von gleichem Rang; aus dem apulischen Teanum und Luceria seht ihr römische Ritter, hochangesehene Leute, als Leumundszeugen; aus Bovianum und dem ganzen samnitischen Land hat man teils sehr ehrenvolle Zeugnisse geschickt, teils fanden sich die achtbarsten und vornehmsten Leute persönlich ein. Ferner, wer in der Gemarkung von Larinum [als Nichtbürger] Güter, wer dort Erwerbsquellen, wer dort Viehherden hat, ehrbare und im größten Ansehen stehende Männer: Man kann kaum schildern, wie besorgt sie sind, welchen Kummer sie empfinden … Um es kurz zu machen, beteuern wir, dass alle Nachbarn mit dem größten Wohlwollen zu ihm [dem Angeklagten] stehen.“12
Cicero erreichte einen Freispruch und verpflichtete sich nicht nur den Angeklagten, sondern auch seine Fürsprecher aus der ehrenwerten Gesellschaft in Samnium und Apulien. Nach den gesellschaftlichen Konventionen, nach der eine Hand die andere wusch, konnte er als Gegenleistung erwarten, dass sie bei Wahlen seinen Aufstieg auf den beiden letzten Stufen der Ämterlaufbahn unterstützten. Wahlen fanden in Rom statt, wer daran teilnehmen wollte, hatte sich vor Ort einzufinden, und das bedeutete, dass Jahr für Jahr, gemessen an der Gesamtzahl potentieller Wähler, eine Minderheit die aktuelle Wählerschaft stellte. Rom verharrte bei den Institutionen eines Stadtstaates, aber sein Bürgergebiet umfasste ganz Italien bis zum Po, entsprach also einem modernen Territorialstaat. Bei den Wahlen selbst wurde nicht nach Köpfen abgestimmt, sondern nach Stimmabteilungen, den 35 Tribus, beziehungsweise bei den Wahlen der Obermagistrate, der Konsuln und Praetoren, nach 193 Zenturien. Diese Zenturien waren so organisiert, dass die Minderheit der Besitzenden über die Mehrheit der Stimmkörperschaften verfügte oder, wie Cicero es einmal ausdrückt, die Vermögenden das meiste vermochten. Ein Kandidat, der die Mehrheit der Stimmkörperschaften gewann, war gewählt, auch wenn diese Mehrheit nur aus einer Minderheit der Abstimmenden bestand. Wer fern von Rom wohnte und von zuhause unabkömmlich war oder kein Geld hatte, um die Reisekosten zu bestreiten, konnte an den Wahlen nicht teilnehmen. Anders stand es mit den Honoratioren der ehrenwerten Gesellschaft, und sie besaßen auch die Mittel, um zusätzliche Wählerstimmen aus ihrer Heimat zu mobilisieren. Von Bedeutung war dies vor allem bei den Wahlen der Obermagistrate, bei denen die Angehörigen der oberen Vermögensklassen den Ausschlag gaben.13 Man muss diese Verhältnisse vor Augen haben, um zu verstehen, dass Ciceros Rechnung aufging: Er wurde jeweils als erster zum frühestmöglichen Zeitpunkt in das Kollegium der Aedilen des Jahres 69 und das der Praetoren des Jahres 66 gewählt.
Als Cicero im Jahre 74 auf Bitten des Gaius Fabricius und seiner prominenten Mitbürger aus Aletrium die Verteidigung des Freigelassenen Scamander übernahm, erlebte er eine böse Überraschung. Der Ankläger legte unwiderleglich Beweise vor, die Scamander als Helfershelfer eines Giftmordanschlags auf Cluentius Habitus entlarvten. Er selbst hat in dem Nachfolgeprozess des Jahres 66 den Schock beschrieben, den er angesichts dieser unvorhergesehenen Sachlage erlitt: „Jetzt erhob ich mich um [dem Ankläger] zu antworten, doch in welcher Bestürzung, ihr unsterblichen Götter, in welcher Aufregung, welcher Angst! Zwar bin ich stets befangen, wenn ich zu reden beginne … Damals aber war ich so bestürzt, dass mich alles mit Besorgnis erfüllte: Man könne mich, wenn ich nichts sagte, für den unbegabtesten Tölpel, wenn ich aber in einer Sache dieser Art viel sagte, für das unverschämteste Subjekt halten. Endlich fasste ich mich und beschloss, mich tapfer zu schlagen … Und so geschah es; ich habe gekämpft, mich so in jeder Weise angestrengt, so zu allen mir erreichbaren Mitteln und Kniffen, die in Prozessen üblich sind, meine Zuflucht genommen, dass ich eines zuwege brachte (ich sage dies zögernd): Niemand glaubte, dass in jener Sache der Anwalt fehlte.“14
Doch der Prozess war verloren, Scamander wurde verurteilt, und damit war für Cluentius die Bahn frei, die zwei Hintermänner, Fabricius, den Patron des Scamander, und den eigentlichen Urheber des Giftanschlags Oppianicus, den Stiefvater des Cluentius, vor Gericht zu ziehen. Den Hintergrund des Anschlags bildete die Besitzgier eines Mannes, der mit allen Mitteln, Heirat, Scheidung, Abtreibung, Testamentsfälschung und Mord nur ein Ziel kannte, sein Vermögen zu mehren, nachdem er bereits als Parteigänger Sullas in seiner Heimatstadt Larinum Nutzen aus der Besitzumwälzung der Proskriptionen gezogen hatte.15 Cicero hat später in dem Nachfolgeprozess des Jahres 66, als er Cluentius Habitus verteidigte, die ganze Vorgeschichte aufgerollt. Er hat dabei gewiss dramatisiert und überzeichnet, um die kriminelle Energie des Oppianicus und seiner fünften Ehefrau Sassia, der Mutter des Cluentius, in ein grelles Licht zu rücken. Doch geradezu erfunden können die gerichtsnotorischen Anschuldigungen nicht gewesen sein. Zweifellos geben sie einen Einblick in die kriminellen Abgründe der nachsullanischen Eigentümergesellschaft, deren höchste Werte Geld, Landbesitz und Macht waren und die in den Mitteln nicht wählerisch war. Was das Verfahren gegen Scamander im Jahre 74 anbelangt, so war durch dessen Ergebnis auch der Ausgang der beiden nachfolgenden Prozesse vorentschieden: Fabricius und Oppianicus wurden verurteilt. Aber während die Verurteilung des Scamander mit nur einer Gegenstimme erfolgte, veränderte sich danach das Abstimmungsergebnis auf wunderbare Weise: Immer mehr Richter stimmten für Freispruch, zum Schluss wurde Oppianicus nur mit einer einzigen Stimme Mehrheit verurteilt. Die Richter waren bestochen, und zwar von beiden Prozessparteien. Den Skandal nutzte der Volkstribun Lucius Quinctius, der Oppianicus verteidigt hatte, zu einer heftigen Agitation gegen den Vorsitzenden des Gerichts und die senatorischen Richter mit dem Ziel, die senatorischen Gerichte, eine der Säulen der sullanischen Ordnung, zu Fall zu bringen. Der Gerichtsvorsitzende Gaius Iunius wurde wegen Bestechlichkeit verurteilt und politisch vernichtet. Und als im Jahre 70 die rein senatorischen Gerichte fielen, empfing auch Aulus Cluentius eine zensorische Rüge wegen aktiver Bestechung, und eine ganze Reihe der an den Prozessen beteiligten Richter wurde aus dem Senat gestoßen. Cicero konnte von Glück sagen, dass er sich nach seiner Niederlage im Verfahren gegen Scamander von der bedenklichen Sache zurückgezogen hatte, die auch seinem Ruf hätte schaden können.
Sieben Jahre später, als er Praetor war, wechselte Cicero wie gesagt die Seite und verteidigte Cluentius, der seinerseits nach dem Tod des Oppianicus von dessen Sohn angeklagt wurde, seinen Stiefvater durch Gift umgebracht zu haben. Dazu wurde Cicero wohl vor allem, wie oben gezeigt wurde, durch das gewaltige Aufgebot von Fürsprechern angetrieben. Sie alle waren potentielle Wähler und Wahlhelfer, und im Jahre 66 warfen schon die Konsulwahlen des Jahres 64, bei denen Cicero sich bewerben wollte, ihre Schatten voraus. Den Mordvorwurf handelte Cicero kurz ab, umso weiter holte er in der Darstellung der Vorgeschichte des Prozesskrieges aus, um Cluentius als verfolgte Unschuld darzustellen und ihn auch von dem Vorwurf der Richterbestechung im Jahre 74 reinzuwaschen. Er überging geflissentlich den Umstand, dass von beiden Seiten Geld zur Bestechung der Richter geflossen war, und verbreitete, wie er später selbst sagte, vor Gericht Dunkel über die Angelegenheit.16 Da die Anklage ihm vorhielt, im Jahre 70 in seiner Rede gegen Verres die von dem Volkstribun Quinctius in Umlauf gesetzte Version, die Cluentius belastete, zustimmend zitiert zu haben,17 wollte er sich auf diese Äußerung nicht mehr festlegen lassen und verteidigte sich mit dem Argument, dass alle Äußerungen von Prozessrednern situationsbedingt seien: „Doch der irrt gewaltig, der da meint, er besitze in unseren Reden, wie wir sie vor Gericht gehalten haben, unsere verbrieften Überzeugungen. Alle diese Reden sind nämlich durch die vertretenen Fälle und die Umstände bedingt, nicht durch die Überzeugungen der Menschen und der Anwälte selbst.“18 Dem Anwalt ging es darum, die Sache seines Klienten und der Fürsprecher zu vertreten, und was Cicero dabei für sich erwartete, hat Matthias Gelzer so ausgedrückt: „Jeder Hilfesuchende war ein künftiger Wähler.“19 So dachten alle, die politischer Ehrgeiz dazu bestimmte, als Verteidiger vor Gericht aufzutreten. Als Quintus Cicero seinem Bruder eine Denkschrift zur Ausschöpfung aller Chancen bei den Konsulwahlen widmete, verwies er ihn auch auf die Maxime eines erfolgreichen Bewerbers. „Gaius Cotta, in Sachen Wahlbewerbung ein Künstler, pflegte zu sagen, er verspreche seine Hilfe, sofern er nicht entgegen einer bestehenden Verpflichtung gebeten werde, gewöhnlich allen, lasse sie denen zuteil werden, bei denen sie nach seiner Meinung am besten angelegt sei.“20
Nach dem Untergang der Republik hat der Historiker Sallust das Verhängnis Roms auf den Verfall der moralischen Werte der Vorfahren und die Vorherrschaft von Habgier und Machtstreben zurückgeführt.21 Er gab damit einem verbreiteten Unbehagen Ausdruck, und es wäre leicht zu zeigen, dass diese Diagnose mehr als ein Klischee ist, sie trifft auf Habitus und Mentalität der höheren Gesellschaft weitgehend zu. Was Habgier und Machterwerb mit allen Mitteln, auch Gewaltanwendung, Bestechung und Verbrechen, anbelangt, enthalten Ciceros Gerichtsreden den sprechenden Kommentar. Dies gilt auch für die im Jahre 72 oder 71 gehaltene Rede Für Marcus Tullius.22 Der Rede liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Marcus Tullius – er war übrigens nicht mit Cicero verwandt – war Gutsbesitzer im Gebiet von Thurii in Süditalien. Einen benachbarten Gutskomplex kaufte ein gewisser Publius Fabius mit dem Gewinn, den er in der Provinz Macedonia gemacht hatte. An dem Kauf beteiligte sich als sein Kompagnon Gnaeus Acerronius. Aber das Land und die Gebäude des Gutes befanden sich in einem desolaten Zustand. Thurii und Umgebung waren eines der Zentren des großen Sklavenaufstandes der Jahre 73 bis 71. Doch auch nach seiner Niederwerfung gelangte die Gegend nicht zur Ruhe. Süditalien war seit langem das gelobte Land des Großgrundbesitzes und der Sklaverei, und die durch Sullas Proskriptionen bewirkten Besitzumwälzungen hatten alles noch schlimmer gemacht. Cicero berichtet, um ein Beispiel anzuführen, von einem Nutznießer dieser Umwälzungen namens Valgius, dass er sich zu Sullas Zeiten durch Inbesitznahme von konfisziertem, aber unversteigertem Land das gesamte Territorium der Hirpiner in Samnium angeeignet habe.23 Das mag übertrieben sein, aber es unterliegt keinem Zweifel, dass Großgrundbesitz und Konzentration von Sklavenmassen die wirtschaftliche Struktur Süditaliens bestimmten. Süditalien war das klassische Land der Transhumanz, des Wechsels von Sommer- und Winterweide, die Hüter der großen Viehherden waren unbeaufsichtigte Hirtensklaven. Um die öffentliche Sicherheit auf dem Land war es dementsprechend schlecht bestellt. Dazu trug auch bei, dass im Zuge von Enteignung, Okkupation und Landspekulation keine gesicherten Eigentumsverhältnisse bestanden. Die Großgrundbesitzer unterhielten vielfach zum Schutz ihres Landbesitzes und zur Durchsetzung von Besitzansprüchen bewaffnete Sklavenbanden. Besonders betroffen scheint die Gegend um Thurii gewesen zu sein. Als Gaius Octavius, der Vater des nachmaligen Kaisers Augustus, um das Jahr 60 auf dem Weg in seine Provinz Macedonia war, hatte er im Auftrag des Senats das Land dort von marodierenden Banden zu säubern, Überbleibseln aus der Zeit des Spartacus (73–71) und des Catilina (63 v. Chr.).24
Unter diesen Umständen kann es nicht verwundern, dass Fabius an seinem spekulativen Landkauf keine rechte Freude hatte und seinen Anteil losschlagen wollte. Sein Kompagnon war zum Kauf bereit. Fabius’ Kaufangebot schloss eine Flur ein, die sogenannte centuria Populiana, die sich im Besitz des Nachbarn Marcus Tullius befand. Dieser gab, als er von dem Verkauf erfuhr, seinem Verwalter von Rom aus Order, das betreffende Flurstück durch bewaffnete Sklaven bewachen zu lassen und auf jeden Fall die Übergabe an Acerronius zu verhindern. Daraufhin rüstete auch Fabius einen bewaffneten Sklaventrupp aus, um sich seinerseits mit Gewalt in den Besitz des zur Übergabe vorgesehenen Areals zu setzen. Bevor es jedoch zum Privatkrieg kam, schien eine friedliche Einigung möglich zu werden. Tullius reiste nach Thurii, und die Kontrahenten vereinbarten, den Streit vor Gericht auszutragen. Der Prozess sollte in der Weise in Gang gebracht werden, dass sich beide auf der strittigen Flur trafen, Tullius dann den Fabius in einem symbolischen Akt aus dem Grundstück „herausführte“ und ihm dabei einen Termin für die Eröffnung eines Verfahrens zusicherte, das über die Rechtmäßigkeit der Ausweisung und damit indirekt über die Eigentumsverhältnisse zu entscheiden hatte. Das war sicherlich beim Fehlen von Katastern und beweiskräftigen Dokumenten – seit der Gracchenzeit übrigens ein notorisches Problem bei allen Bodenreformversuchen – ein schwieriges Unterfangen. Zu dem vereinbarten Verfahren kam es denn auch gar nicht. In der Nacht vor dem geplanten Treffen drangen bewaffnete Sklaven des Fabius in das Grundstück ein, zerstörten ein Gebäude und töteten die Leute des Tullius, die dort Wache hielten. Hinter dem Coup stand wohl die geänderte Strategie des Fabius: Durch Inbesitznahme des strittigen Objekts wollte er sich in die bessere Ausgangslage für die gerichtliche Auseinandersetzung bringen und seinem Kontrahenten die Rolle des Anklägers zuschieben. Tullius blieb nichts anderes übrig, als Klage zu erheben, und zwar strengte er ein Verfahren wegen Sachbeschädigung unter Berufung auf das Edikt an, das der Praetor Marcus Licinius Lucullus im Jahre 76 zur Eindämmung der grassierenden Bandenkriminalität verkündet hatte. Nach älterem Recht wurden Klagen wegen Sachbeschädigung – und dazu gehörte auch die Tötung von Sklaven – von einem Einzelrichter entschieden, und der Ersatz lautete auf das Einfache und in besonderen Fällen auf das Doppelte des geschätzten Schadens. Das praetorische Edikt des Jahres 76 schuf ein neues Verfahren für die Fälle, bei denen bewaffnete Banden im Spiel waren. Dies war eine Reaktion auf die das flache Land überziehende Bandenkriminalität, die ihrerseits eine Folge der gewaltsamen Revolutionierung der Besitzverhältnisse durch Sulla war. Das neue Verfahren spiegelt das staatliche Interesse an der Wahrung der öffentlichen Sicherheit, ohne den privatrechtlichen Charakter der Schadenersatzklage aufzuheben. Im einzelnen war bestimmt, dass das Verfahren vor einem Kollegium von drei, fünf oder sieben Richtern, sogenannten Rekuperatoren, stattfand und beschleunigt innerhalb von zehn Tagen abgewickelt werden musste. Zeugen konnten von Amts wegen vorgeladen werden, und der im Fall einer Verurteilung zu leistende Schadenersatz betrug das Vierfache des geschätzten Schadens. Im vorliegenden Fall bestritt der Anwalt des Beklagten, der Volkstribun des Jahres 74 Lucius Quinctius, nicht den Gewaltakt als solchen, der Fabius in den Besitz des fraglichen Flurstücks gebracht hatte, aber er rechtfertigte ihn unter Berufung auf Notwehr. Ciceros Strategie lief nun darauf hinaus, dass die praetorische Prozessinstruktion wegen der Gewaltausübung durch eine bewaffnete Bande jegliche Berufung auf Rechtfertigungsgründe von vornherein abschneide. Hilfsweise wird der Berufung auf das Notwehrrecht auch die Einrede des Missbrauchs, also des Notwehrexzesses, entgegengestellt. Ciceros Rede ist nur fragmentarisch erhalten. Auch ist nicht überliefert, ob er mit seinem Plädoyer Erfolg hatte. Für wahrscheinlich darf man es aber halten. Denn es war ja nicht zu bestreiten, dass Fabius sich mit Gewalt in den Besitz des strittigen Objekts gesetzt hatte und seine bewaffneten Sklaven erheblichen Schaden angerichtet hatten.
Kurze Zeit später baten die sizilischen Gemeinden Cicero, ihre Schadenersatzansprüche gegen den gerade abgelösten Statthalter der Provinz Gaius Verres zu vertreten. Dieses Mal handelte es sich um einen Fall mit politischer Sprengkraft. Verres war entgegen dem Reglement drei Jahre in seinem Amt gehalten worden. Wegen der auf drei Schauplätzen geführten Kriege, in Spanien, Kleinasien sowie in Italien gegen die von Spartacus geführten Sklaven, gab es einen Mangel an Kandidaten für die Nachfolge. Erst im Jahre 71 wurde Verres auf dringende Vorstellung der sizilischen Gemeinden durch Lucius Caecilius Metellus abgelöst. Verres hatte die drei Jahre seiner Statthalterschaft zu beispielloser Bereicherung genutzt und dabei seine Amtsgewalt hemmungslos missbraucht. Petitionen der drangsalierten Untertanen blieben vergeblich. Eine wirksame Aufsicht des Senats gab es schlechterdings nicht. Wenn es einem prominenten Einheimischen einmal gelang, persönlich in Rom vorstellig zu werden, verfing sich seine Initiative im Dickicht persönlicher Rücksichtnahmen. Beispielsweise hatten die sizilischen Gemeinden im November 72 in einer gemeinsamen Eingabe den Senat gebeten, sich der Sache des vor Verres nach Rom geflohenen Sthenius, eines prominenten Bürgers von Thermae, anzunehmen.25 Das wurde von Verres’ Vater vereitelt. Er versprach, seinen Sohn von dem Vorhaben abzubringen, gegen Sthenius einen Kapitalprozess auf Leben und Tod vor seinem Tribunal zu führen. Daraufhin ließ der Senat den Fall auf sich beruhen, und Verres fällte ungerührt das Todesurteil über den Abwesenden. Als dann der Volkstribun Marcus Lollius Palicanus den Skandal publik machte, konnte Cicero immerhin zugunsten seines Gastfreundes Sthenius einen Dispens von dem Edikt der Volkstribunen erwirken, das allen in einem Kapitalprozess Verurteilten den Aufenthalt in Rom verbot. Erst nach Ablauf der Amtszeit eines Statthalters besaßen Provinziale die Möglichkeit, ihn zur Verantwortung zu ziehen, indem sie ein Verfahren wegen Erpressung von Geldern und Dienstleistungen vor dem sogenannten Repetundengerichtshof in Gang brachten. Dazu benötigten sie einen römischen Patron, der ihre Sache vor Gericht vertrat. Auch dann war die Verurteilung eines Schuldigen nicht leicht zu erreichen. Der Gerichtshof war bis zum Jahr 70 mit senatorischen Geschworenen besetzt, und in dem Beziehungsdschungel des Standes galt in der Regel das Prinzip, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Was Beziehungen nicht vermochten, bewirkte das Geld in Gestalt der Richterbestechung. Von Verres wird das Bonmot zitiert, dass der Raub aus seinem ersten Jahr für ihn selbst sei, der des zweiten für seine Anwälte und der des dritten für seine Richter.26
Für den aufstiegsorientierten Cicero war die Übernahme der Anklage nicht ohne Risiko. Er lief Gefahr, es sich mit den mächtigen Verbündeten des Angeklagten zu verderben und so seine Wahlchancen zu vermindern. Verres war bereits auf den Plan getreten und hatte einen beträchtlichen Betrag zu dem Zweck reserviert, die anstehende Wahl Ciceros zum Aedilen zu verhindern,27 und in der Person des Aulus Hortensius und des Publius Cornelius Scipio (er wurde später Pompeius’ Schwiegervater und bekleidete mit diesem das Konsulat im Jahre 52) gewann er Verteidiger und Beistände aus den höchsten Kreisen der Nobilität. Darüber hinaus mobilisierte er zu seinem Schutz den mächtigen Clan der Meteller. Von drei Brüdern übernahm einer, Lucius, als Verres’ Nachfolger die sizilische Statthalterschaft, der zweite, Quintus, bewarb sich mit Hortensius um das Konsulat des Jahres 69 und der dritte, Marcus, um die Praetur. Bei den Wahlen im Juli 70 floss das Geld des Verres, und alle wurden gewählt – die Wahl Ciceros zum Aedilen konnte allerdings nicht verhindert werden. Danach taten die Verschworenen alles, um den Prozess in das Jahr 69 zu verschleppen, in dem Marcus Caecilius Metellus als Vorsitzender des Repetundengerichts fungieren würde. Cicero musste also abwägen: Auf der einen Seite standen die einflussreichen Verbündeten des Verres und die Macht des Geldes, auf der anderen Seite die Patronatspflichten gegenüber seiner sizilischen Klientel, der er schon im Jahre 75 seine künftige Unterstützung zugesagt hatte, und die Interessen der römischen Geschäftswelt, die ebenfalls schlechte Erfahrungen mit Verres’ Amtsführung gemacht hatte. Hinzu kam, dass die Agitation der vorangehenden Jahre gegen die Richterbestechlichkeit und die bereits angekündigte Beseitigung des senatorischen Richtermonopols die Geschworenen zur Vorsicht nötigten. Cicero entschied sich für die Vertretung der Anklage gegen Verres, doch sogleich begannen die Schachzüge der Gegenseite. Als er zu Beginn des Jahres 70 die Klage einreichte, forderte ausgerechnet der ehemalige Quaestor des Verres, Quintus Caecilius Niger, das Klagerecht für sich, und Cicero musste erst in einem Vorverfahren seine Zulassung als Ankläger erkämpfen.28 Er erbat und erhielt eine Frist von 110 Tagen zur Beschaffung von Beweismaterial. Im Gegenzug veranlasste die andere Seite, dass der Ankläger in einer Achaia betreffenden Repetundenklage eine Ermittlungsfrist von nur 108 Tagen forderte. Da nach dem Gerichtsbrauch die Termine für die Hauptverhandlungen entsprechend der Dauer der beantragten und gewährten Ermittlungsfristen anberaumt wurden, musste zuerst über den achäischen Fall entschieden sein, bevor der sizilische zum Zuge kam. Von diesem Schachzug der Gegenseite wusste Cicero nichts, als er mitten im Winter nach Sizilien aufbrach, um das Belastungsmaterial gegen Verres zusammenzubringen. Da er damit rechnete, dass sein Prozess schon im Mai stattfinden würde, beschleunigte er seine Recherchen, so gut er konnte. Dabei bereitete ihm Lucius Metellus Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Aber Cicero gab nicht auf; er erzwang sich sogar am Amtssitz des Statthalters die Einsichtnahme in die Rechnungsbücher der Steuerpächter.29 Anstelle von 110 brauchte Cicero nur 50 Tage, um ein ebenso umfangreiches wie sensationsträchtiges Belastungsmaterial zu sammeln. Diese Effizienz war nicht zuletzt der rührigen Unterstützung durch den Vetter Lucius Cicero geschuldet. Lange überlebt hat dieser die erfolgreiche Mission in Sizilien nicht. Er starb schon im November 68. Cicero hat ihn geliebt und ihm im ersten der Briefe an Atticus einen Nachruf gewidmet, der ein liebevolles Bild des Jungverstorbenen zeichnet: „Welchen Schmerz und welchen Verlust ich für meine öffentliche und private Existenz erlitten habe, vermagst vor allem Du angesichts unserer Vertrautheit nachzuempfinden. Denn mir ist alles, was einem aus der Menschlichkeit und dem ganzen Wesen eines Anderen zuteil werden kann, durch ihn begegnet. Und so zweifle ich nicht, dass auch Dich [sein Tod] beschwert; denn Du nimmst ja an meinem Schmerz Anteil und hast selbst einen Verwandten und Freund verloren, den die größten Qualitäten und die Bereitschaft auszeichneten, anderen zu dienen, und der Dich aus eigenem Antrieb und wegen meiner Äußerungen liebte.“30
Als Cicero nach 50 Tagen zurückkehrte, musste er erleben, dass es der Gegenseite gelungen war, den Prozessbeginn auf die Zeit nach den Wahlen im Juli zu verschieben. Als der Prozess endlich am 5. August eröffnet wurde, war klar, dass die mit Verres verbündeten Konsuln und der für das Jahr 69 zum Vorsitzenden des Repetundengerichts bestimmte Praetor Marcus Metellus auf weitere Verschleppung unter Ausnutzung des herbstlichen Festkalenders setzten. Doch Cicero durchkreuzte diesen Plan. Gewöhnlich wurde mit dem Austausch ausführlicher, auf mehrere Tage verteilter Plädoyers begonnen, dann folgten die Präsentation und Befragung der Belastungs- und Entlastungszeugen, bevor es zu den Schlussplädoyers und zur Abstimmung über die Schuldfrage kam. Cicero führte jedoch nach einer kurzen Einführungsrede sofort die Belastungszeugen vor. Der Eindruck ihrer Aussagen war so überwältigend, dass Verres seine Sache verloren gab und freiwillig ins Exil ging. Das war ein Schuldeingeständnis, und so wurde er verurteilt. In dem sich anschließenden Verfahren, in dem es um die Abschätzung des Schadens und um die Rückerstattungssumme ging, war Cicero weniger erfolgreich. Der Schaden wurde auf 40 Millionen Sesterzen taxiert, doch nur 3 Millionen konnten zurückerstattet werden.31 Den größten Teil hatte Verres beiseite geschafft beziehungsweise seinen Verbündeten zukommen lassen. Die sizilischen Gemeinden kamen also nur in den Genuss eines symbolischen Schadenersatzes, aber sie hatten die Genugtuung, dass ein Exempel statuiert und die bürgerliche Existenz ihres Peinigers vernichtet war. Sie dankten ihrem Patron durch Zuwendungen, die ihm erlaubten, den finanziellen Anforderungen der Aedilität großzügiger nachzukommen, als seine Vermögensverhältnisse es von Haus aus zuließen. Im Frühjahr 69 richtete er die Spiele zu Ehren der Göttin Ceres, das Frühlingsfest der Florales und später die Römischen Spiele, die ludi Romani, aus, und er war darüber hinaus in der Lage, Mittel zur Verbilligung des Marktpreises von Lebensmitteln zu verwenden.32 Auch damit verbesserte er seine künftigen Wahlchancen.
Cicero hatte den Prozess gegen Verres so angelegt, dass er das gesammelte Belastungsmaterial gar nicht mehr in einem ausführlichen Plädoyer vorzustellen brauchte. Das holte er dann in einer schriftlichen, zur Publikation bestimmten Ausarbeitung nach. Die schriftliche Version enthielt die Rede gegen Caecilius, mit der er sich das Klagerecht erstritt, und die Eröffnungsansprache zur Vorführung der Belastungszeugen, dann folgte die zu übermäßigem Umfang angeschwollene, fiktive zweite Rede, die sage und schreibe fünf Buchrollen umfasst. Die erste gilt dem kriminellen Vorleben des Angeklagten, die zweite dem Missbrauch seiner Funktion als oberster Gerichtsherr in Sizilien, die dritte den korrupten Praktiken bei der Einziehung der Getreideabgaben der Untertanen, die vierte dem Kunstraub und die fünfte dem Missbrauch der militärischen Kommandogewalt. Diese gigantische Dokumentation – für uns eine wichtige Quelle zur römischen Provinzverwaltung in der Zeit der späten Republik – belegt Ciceros Sorgfalt bei der Vorbereitung eines Sensationsprozesses, und sie zeigt auch sein überlegenes Geschick, Verres zu isolieren und Anstoß bei dessen einflussreichen Verbündeten aus der Nobilität zu vermeiden. Dies gelang ihm, indem er von Verres das Bild des schwärzesten aller schwarzen Schafe zeichnete. So war jeder froh, sich von diesem Ausnahmekriminellen des Senatorenstandes distanzieren zu können. Ein weiteres Ergebnis der Affäre war, dass Cicero den berühmten Hortensius endgültig vom Platz des angesehensten Gerichtsredners verdrängt hatte.
Ciceros Erfolg war so aufsehenerregend, dass der ehemalige Statthalter der Provinz Gallia Narbonensis, Marcus Fonteius, den Aedilen Cicero bat, ihn in dem anhängigen Verfahren wegen Erpressung zu verteidigen. Cicero übernahm den Fall – und verteidigte vermutlich keinen Unschuldigen.33 Fonteius hatte ähnlich wie Verres drei Jahre als Statthalter fungiert, und ihm war die Aufgabe zugefallen, für den spanischen Krieg die Stellung von Hilfstruppen, Nachschub und Winterquartiere sowie die Beschaffung von Geld zur Besoldung der Truppen zu organisieren. Zusätzlich war er auch mit dem Ausbau der wichtigsten Kommunikationslinie nach Spanien, der via Domitia, befasst. Dies alles bot gute Möglichkeiten zu persönlicher Bereicherung. Entsprechende Vorwürfe wurden von Seiten der keltischen Stämme der Provinz erhoben. Ciceros Verteidigungsstrategie bestand darin, die Gallier, die alten Feinde Roms, als unzuverlässige Zeugen zu diskreditieren und ihre Anklagen den positiven Zeugnissen gegenüberzustellen, die der Amtsführung des Angeklagten die Bürgerschaften der römischen Kolonie Narbo Martius (heute: Narbonne) und der verbündeten griechischen Polis Massilia (heute: Marseille) sowie die im Land ansässigen Römer ausgestellt hatten.34 Dem Vorwurf hoher Zahlungen an Fonteius wird mit dem nicht unbedingt beweiskräftigen Argument begegnet, dass es dafür keinen Nachweis in den Büchern der römischen Geschäftsleute gebe, obwohl doch alle Geldtransaktionen in Gallien von ihnen getätigt würden.35 Und was das Straßenbauprogramm anbelangt, so könne der Angeklagte schon deshalb daraus keinen Gewinn gezogen haben, weil er die Abwicklung dieser Aufgabe seinen Legaten übertragen habe.36 Es braucht kaum gesagt zu werden, dass auch dieses Argument alles andere als schlüssig ist. Es kann ja Absprachen zur Teilung ungesetzlicher Gewinne gegeben haben. Schließlich kommt die Berufung auf die Staatsräson: Es gehe nicht an, einen bewährten Feldherrn den Beschuldigungen der potentiellen Feinde Roms zu opfern.37 Cicero erhebt seine warnende Stimme: „Wenn ich euch demnach noch warnen müsste, ihr Richter (was nicht der Fall ist), so könnte ich euch, gewiss nur andeutend, wie es sich für mein bescheidenes Ansehen ziemt, den Rat geben, ihr möchtet glauben, dass ihr euch sorgsam die Leute erhalten solltet, deren Mannhaftigkeit, Energie und glückliche Hand im Kriegsdienst erprobt sind.“38
Der gute Rat entsprach einem Topos. Verteidiger in Repetundensachen bedienten sich seiner, Ankläger wiesen ihn zurück. Letzteres hatte Cicero im Fall des Verres getan: „Ich kenne das Thema, ich sehe, worin sich Hortensius verbreiten will. Die Gefahren des Krieges, die schwierige Lage des Staates, den Mangel an Feldherren wird er erwähnen. Bald wird er von euch erbitten, bald sogar als sein Recht fordern, ihr möchtet nicht dulden, dass ein solcher Feldherr dem römischen Volk durch die Aussagen der Sizilier genommen werde, dass ihr nicht wollen möchtet, dass Feldherrnruhm durch die Anschuldigungen von Habgier zerrieben werde.“39 Cicero kannte eben alle geläufigen Argumente und Advokatenkniffe und wusste sie je nach Interessenlage zu verwenden. Im Falle des Fonteius verschmähte er zum Schluss auch nicht den sentimentalen Appell an die Richter, sie möchten das Leid und den Schmerz bedenken, die sie der alten Mutter und der Schwester des Angeklagten, die ihr Leben dem Dienst der Göttin Vesta geweiht habe, mit einer Verurteilung bereiten würden.40 Ob Ciceros Verteidigung Erfolg hatte, wissen wir nicht. Aber wie immer der Prozess des Fonteius ausgegangen war, Ciceros Ansehen als Gerichtsredner war ungebrochen. Er blieb weiterhin ein vielbeschäftigter Anwalt.
Aus der Zeit der Aedilität oder aus dem folgenden Jahr ist die schriftlich ausgearbeitete Fassung der Rede Für Aulus Caecina erhalten, die Cicero in einem privatrechtlichen Besitzstreit gehalten hatte. Der Fall hatte sich aus einer Erbschaftsangelegenheit entwickelt. Aulus Caecina aus dem etruskischen Volaterra hatte eine reiche Witwe geheiratet. Als sie starb, hinterließ sie ihm 23/24 der Erbmasse, ihr ehemaliger Vermögensverwalter Aebutius erhielt zu seiner Enttäuschung nur 1/72. Der Streit entzündete sich an einem Grundstück, von dem Aebutius behauptete, es sei sein Eigentum, Caecina hingegen, es gehöre zur Erbmasse. Auf Anraten des Juristen Gaius Aquilius vereinbarten die Kontrahenten, den Rechtsweg in folgender Weise zu beschreiten. Die beiden sollten sich auf dem strittigen Grundstück, das Aebutius in Besitz hatte, treffen, dann sollte Aebutius in einem Akt symbolischer Vertreibung Caecina „herausführen“, damit dieser beim zuständigen Praetor ein Interdikt erwirke, das die widerrechtliche Störung oder Entziehung des Besitzes untersagte. Dies war die rechtliche Grundlage zur Eröffnung eines Verfahrens über die Frage des rechtmäßigen Besitzes (und mittelbar die nach den Eigentumsverhältnissen). Aebutius hielt sich jedoch nicht an die Vereinbarung, sondern hinderte Caecina unter Aufbietung einer bewaffneten Mannschaft am Betreten des Grundstücks. Daraufhin erwirkte Caecina ein praetorisches Edikt, das anordnete, den gewaltsam Vertriebenen zurückzuführen. Darüber kam es zu einem Prozess vor einen Rekuperatorengericht. Aebutius machte geltend, dass das Edikt ihn gar nicht betreffe, da er Caecina aus dem fraglichen Grundstück nicht vertrieben habe. Er wählte also nach althergebrachtem Brauch die Methode der wortwörtlichen Auslegung der Prozessinstruktion. Demgegenüber bezog sich Cicero in seinem Plädoyer auf den Sinn der praetorischen Verfügung und legte sie in dem Sinne aus, dass von ihr nicht nur die gewaltsame Vertreibung, sondern auch die gewaltsame Verhinderung des Zugangs erfasst sei.41 Er vertrat in einer scharfsinnigen und umständlichen Argumentation das Prinzip der Billigkeit, die nach dem Sinn einer Bestimmung fragte, gegen das der buchstäblichen Textauslegung. Damit hatte seinerzeit schon der große Redner Lucius Licinius Crassus gegen den Juristen Mucius Scaevola in der Erbschaftsangelegenheit des Manius Curius vor Gericht den Sieg davongetragen,42 und es ist in Hinblick auf diesen und vergleichbare Fälle die These vertreten worden, dass auf der Berücksichtigung der Willensrichtung rechtsetzender Personen oder des Sinns rechtlicher Bestimmungen der spezifische Beitrag der Rhetorik zur Rechtsentwicklung in der Zeit der späten Republik beruhe.43 Im vorliegenden Fall liegt der Verdacht nahe, dass Aebutius’ Vorgehen von Arglist nicht frei war, und es will bedacht sein, dass der soeben genannte Jurist Aquilius als Erster den Tatbestand der arglistigen Schädigung definierte, der dann Aufnahme in das tralatizische praetorische Edikt der Klageformeln fand.44 Cicero hat das Problem, das die Vorgehensweise des Aebutius aufwarf, später so charakterisiert: „Oft geht das Unrecht aus einem Advokatenkniff und allzu schlauer, aber böswilliger Rechtsauslegung hervor. Daraus ist das durch häufigen Gebrauch schon abgenutzte Sprichwort entstanden: Das strengste Recht ist das größte Unrecht.“ 45
Die Arbeitslast, die Cicero auf sich nahm, hinterließ ihre Spuren. Er sehnte sich nach einem Ort der Ruhe und Erholung, an dem er seine Mußestunden mit philosophischer Lektüre in einer schönen und anregenden Umgebung verbringen konnte und nicht jeder Zugang zu ihm hatte. Er besaß bereits eine Villa zwischen Formiae und Caieta an der Küste Latiums. Dieses Formianum diente ihm vor allem als Zwischenaufenthalt auf dem Weg von Rom nach Arpinum. Es lag zu weit von Rom entfernt und kam deshalb für kurze Erholungsaufenthalte nicht in Frage. Für diesen Zweck kaufte Cicero in Tusculum, der bevorzugten Sommerfrische der römischen Aristokratie, von einem gewissen Vettius ein Anwesen, das dem Diktator Sulla und dem älteren (Konsul 102) oder jüngeren Catulus (Konsul 78) gehört hatte.46 Das Geld für den Kauf stammte vielleicht aus den Zuwendungen, die er von den sizilischen Gemeinden und von anderen Klienten erhalten hatte. Jedenfalls verfügte er über hinreichende Mittel, um auf dem erworbenen Anwesen in Erinnerung an den Studienaufenthalt in Athen und zur Befriedung seiner geistigen Bedürfnisse zwei Gymnasien in Hanglage zu errichten, das obere, das Lyceum, und das untere, die Akademie, mit Palaestra, Bibliothekssaal und Leseräumen. Die ersten erhaltenen Briefe an Atticus zeigen ihn damit beschäftigt, die Gymnasien mit griechischen Kunstwerken zu schmücken. Atticus fiel in Athen die Aufgabe zu, den Ankauf zu besorgen. Wie Cicero schreibt, wollte er dafür alle seine Ersparnisse aufwenden – für einen Einzelposten, megarische Bronzen, ist ein Betrag von 20.400 Sesterzen erwähnt –, und er beschwor Atticus, alle Bücher, die sein Freund aufgekauft hatte, ja keinem anderen zu überlassen, sondern sie für ihn zu reservieren.47 Was ihm sein Tusculanum bedeutete, ist mehreren Briefstellen zu entnehmen: „Denn von allen Beschwernissen und Mühen finden wir einzig an diesem Ort Erholung.“48 – „Wir freuen uns an unserem Tusculanum, so dass wir erst dann, wenn wir dorthin kommen, mit uns selbst im Einklang sind.“49 – „Wunderbar, wie nicht nur die Anwesenheit an jenem Ort, sondern schon der Gedanke an ihn mir Freude verschafft.“50 Im Alter von 39 Jahren dachte er bereits daran, seinen Alterssitz auf dem Tusculanum zu nehmen: „Denn ich reserviere alle meine kleinen Rücklagen für dieses Refugium meines Alters.“51 In der Last der täglichen Geschäfte überkam ihn das Verlangen, seiner zweiten Natur leben zu können, den Büchern und der Lektüre: „Ich vergehe vor Sehnsucht nach den Büchern wie am Widerwillen gegen alles übrige.“52 Dies wurde im August 67 geschrieben, als er mitten im Wahlkampf um die Praetur steckte und erleben musste, dass die Agitation des Volkstribunen Gaius Cornelius gegen Wahlbestechung zweimal zum Abbruch der Praetorenwahlen geführt hatte. Cicero teilte seinem Freund mit, dass er entgegen Atticus’ Erwartung noch immer nicht gewählt sei.53 Wohl im Hinblick auf die Auseinandersetzungen um die Gesetzesinitiativen der Volkstribunen setzt er der Bemerkung über seinen Widerwillen gegen alles noch hinzu: „Es ist unglaublich, in wie kurzer Zeit Du die Dinge um soviel schlechter vorfinden wirst, als Du sie [bei Deiner Abreise aus Rom] verlassen hast.“
Abgesehen von den Umtrieben des Gaius Cornelius wurde die Politik von den Gesetzesanträgen des Volkstribunen Aulus Gabinius in Atem gehalten, den Oberkommandierenden auf dem asiatischen Kriegsschauplatz Lucius Lucullus abzuberufen und des weiteren Gnaeus Pompeius ein umfassendes Sonderkommando zur Säuberung des Mittelmeers von der Seeräuberplage zu erteilen. Zu dieser umkämpften Agenda der Tagespolitik nahm Cicero nicht öffentlich Stellung. Es gehörte zur Wahrung seiner Wahlchancen, sich nicht zu exponieren und gegen mächtige Interessen zu verstoßen. Was er zur Mobilisierung von Wählern und Wahlhelfern tun konnte, glaubte er, mit zahlreichen, ihn bis an den Rand der Erschöpfung treibenden Prozessvertretungen geleistet zu haben. Im Wahljahr 67 verschmähte er es auch nicht, dafür zu sorgen, dass ein Mann, der zu dem Berufsstand der magistratischen Schreiber und Rechnungsführer gehörte, rehabilitiert wurde: „Ich habe kürzlich“, so berichtet er in der Rede Für Cluentius Habitus, „einen einfachen Mann verteidigt, einen Schreiber der Aedilen, Decimus Matrinius, bei den Praetoren Marcus Iunius und Quintus Publicius sowie bei den Aedilen Marcus Plaetorius und Gaius Flaminius; ich bestimmte sie dazu, ihrer Eidespflicht gemäß den als Schreiber einzustellen, den die schon genannten Zensoren [des Jahres 70] unter die Aerarier versetzt hatten. Da sich nämlich bei dem Manne keine Schuld feststellen ließ, glaubten sie fragen zu müssen, was er verdient, nicht, was man gegen ihn entschieden habe.“54 Die Zensoren waren bei ihren Säuberungsaktionen nicht zimperlich verfahren, hatten den Schreiber von der Tribusliste gestrichen, ihm damit das aktive Wahlrecht aberkannt und ihn aus seinem Amt entfernt. Nun wurde die Degradierung zurückgenommen, und Cicero hatte sich nicht nur die Dankbarkeit des einen Schreibers, sondern vermutlich des ganzen Berufsstandes erworben. Die Irritation, die der zweimalige Abbruch der Praetorenwahl auslöste, bedeutete keine Minderung der Wahlchancen Ciceros – im Gegenteil: Er hatte die Genugtuung, in allen drei Wahlgängen jeweils als erster gewählt zu werden. Seine schon vorher geäußerte Siegesgewissheit hatte ihn also nicht getrogen. Im Mai 67 hatte er das Angebot seines Freundes Atticus, aus Griechenland nach Rom zurückzukommen, um ihn bei der Bewerbung persönlich zu unterstützen, nicht angenommen und hinzugefügt, dass er dem Freund den Wahlerfolg gleichwohl gutschreiben werde.55 Der triumphale Wahlsieg brachte ihm übrigens auch die Verschwägerung mit einer Familie der alten Nobilität ein. Noch vor Jahresende teilte er Atticus mit, dass er seine damals ungefähr zehnjährige Tochter Tullia dem jungen Gaius Calpurnius Piso, einem Urenkel des Konsuls des Jahres 133, der den ersten ständigen Gerichtshof für Erpressungsdelikte errichtet hatte, verlobt habe.56
Bei der Auslosung der Amtsbereiche fiel Cicero die Leitung des Gerichtshofs zu, vor dem er als Ankläger des Verres einen spektakulären Erfolg errungen hatte. Als gewähltem Praetor war ihm nun auch aufgegeben, zu Fragen der Tagespolitik Stellung zu beziehen. Die wichtigste betraf zu Beginn seines Amtsjahres die Gesetzesinitiative des Volkstribunen Gaius Manilius, den Sieger im Krieg gegen die Seeräuber, Gnaeus Pompeius, mit einem weiteren außerordentlichen Kommando zu betrauen, damit er den Krieg gegen die Könige Mithradates von Pontos und Tigranes von Armenien zu einem siegreichen Ende führe. Es war weitverbreitete Überzeugung, dass Pompeius für diese Aufgabe der richtige Mann am richtigen Platze war – er befand sich bereits mit Heer und Flotte in Kilikien, in unmittelbarer Nähe des Kriegsschauplatzes. Insbesondere drangen die Staats- und Steuerpächter sowie die römische Geschäftswelt darauf, dass die Gefährdung ihrer Geschäfts- und Kapitalinteressen durch den langwierigen Krieg in Asien endlich ein Ende finde. In Cicero sahen sie ihren bewährten Sachwalter, der nun als Praetor auch in der großen Politik ein Wort mitzureden hatte. Cicero hielt eine Rede vor dem Volk, in der er den Gesetzesantrag des Manilius nachdrücklich zur Annahme empfahl. Der Antrag war populär, und Cicero rannte offene Türen ein. Er handelte das Thema nach drei Gesichtspunkten ab: Art und Bedeutung des Krieges, die Größe der Gefahr und die Person des Retters, des Feldherrngenies Pompeius. Dann setzte er sich mit den Einwänden auseinander, die zwei unentwegte Optimaten gegen den Gesetzesantrag vorzubringen noch den Mut hatten.57 So wenig dies alles für die Entscheidung der Volksversammlung ins Gewicht fiel, so sind doch zwei Gesichtspunkte an Ciceros Stellungnahme bemerkenswert: seine Sachkenntnis bei der Erläuterung der Zusammenhänge zwischen dem Krieg in Asien und dem Geld- und Kreditmarkt in Rom (davon war oben bereits die Rede)58 und die Auseinandersetzung mit den optimatischen Einwänden gegen die Übertragung des Oberbefehls an Pompeius. Die ganze Karriere dieses Mannes war die Negation der kollektiven Nobilitätsherrschaft, die auf der gesetzlichen Normierung der Ämterlaufbahn beruhte und mit einer extremen Machtakkumulierung durch militärische Sonderkommandos nicht vereinbar war. Ciceros Laufbahn entsprach der herkömmlichen Ordnung, die des Pompeius sprengte sie. Vom optimatischen Standpunkt hatte deshalb Lucius Licinius Lucullus völlig recht, als er einwandte, die erneute Nominierung des Pompeius entspreche nicht den bewährten Grundsätzen der traditionellen Ordnung. Ciceros Antwort lautete, dass die Vorfahren sich in Friedenszeiten vom Herkommen leiten ließen, im Krieg dagegen von Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten, und er zieht Beispiele aus der Vergangenheit heran, vor allem die beiden Scipionen, von denen der eine Hannibal besiegte und der andere Karthago und Numantia zerstörte.59 Damit verwischte er den qualitativen Sprung, der zwischen den Karrieren der Scipionen und der des Pompeius lag. Gewiss hatte die Geschichte den Blick auf die Konsequenzen, die sich aus der Vergabe der großen außerordentlichen Heereskommandos für das Schicksal der Republik ergaben, noch nicht freigegeben. Was Cicero damals wirklich dachte, steht dahin. Gegen Ende seines Lebens fällte er ein scharfes Verdikt über die aufrührerischen Volkstribunen Gabinius und Manilius.60 Aber in der Situation des Jahres 66 rief er Manilius dazu auf, an seinem Antrag festzuhalten, und sagte ihm jede Unterstützung zu.61
Denar des Sex. Pompeius aus dem Jahr 44/43. Die Vs. zeigt den Kopf des Cn. Pompeius Magnus mit dem Dreizack als Symbol der Seeherrschaft, die Rs. ein Kriegsschiff mit Rammsporn.
Was die Tätigkeit als Gerichtsvorsitzender anbelangt, legte Cicero offenbar Wert auf eine unparteiische Amtsführung. Er besaß ja eine klare Einsicht in die unterschiedlichen Anforderungen an einen Richter und an einen Anwalt. Freilich stand alles, was er tat, die amtliche Tätigkeit ebenso wie die politische Stellungnahme vor dem Volk, unter der Frage nach dem Nutzen für die angestrebte Wahl zum Konsul. Als unter seiner Leitung Gaius Licinius Macer wegen Erpressung verurteilt worden war, schrieb er an Atticus: „Hier [in Rom] hat meine Prozessleitung in Macers Fall die Billigung des Volkes in einzigartiger und unglaublicher Weise gefunden. Obwohl wir uns ihm gegenüber fair verhielten, haben wir dennoch mehr Gewinn aus der Meinung des Volkes über seine Verurteilung gezogen, als wir von seiner Dankbarkeit gewonnen hätten, wenn er freigesprochen worden wäre.“62 Das Hauptinteresse des Aufsteigers war auf Beifall des Volkes und auf die Dankbarkeit einflussreicher Einzelner gerichtet, und es war klar, dass im Hinblick auf die Konsulwahlen, die Nagelprobe auf einen gelungenen Aufstieg, die Zustimmung des Volkes mehr galt als die Dankbarkeit eines Einzelnen. Aber für die Gewinnung einer möglichst großen Zahl einflussreicher Personen war Cicero weiterhin unermüdlich vor Gericht tätig, wie unter anderem die oben erwähnte umfangreiche Rede für Cluentius Habitus demonstriert. Wie Aurelius Cotta versprach er nach Möglichkeit allen seine Hilfe. In den letzten Tagen seines Amtsjahres geriet er durch eines dieser Versprechen in eine peinliche Lage. Im Dezember 66 wurde Manilius unmittelbar nach Ablauf seiner Amtszeit ausgerechnet bei dem Praetor Cicero von optimatischer Seite wegen Erpressung angezeigt. Er wollte den Fall schnell zu Ende bringen, damit er nicht in Erfüllung seiner Zusage, die er in seiner Rede für den Oberbefehl des Pompeius gegeben hatte, Manilius im kommenden Jahr verteidigen musste und sich so die optimatischen Kreise des Senats entfremdete. So beraumte er die Verhandlung vor dem Repetundengericht in ungeziemender Eile auf den letztmöglichen Termin seiner Amtszeit, den 29. Dezember, an. Das stieß auf Empörung. Die Volkstribune schritten ein, und Cicero musste sich vor einer Versammlung des Volkes rechtfertigen. Er behauptete, er habe die Verhandlung so früh angesetzt, um Manilius einen Dienst zu erweisen, und versprach, ihn im kommenden Jahr zu verteidigen. Ja, er missbilligte den optimatischen Vorstoß, weil damit Pompeius getroffen werden sollte.63 Was Cicero also vermeiden wollte, genau das war eingetreten. Er geriet bei den Optimaten ins Zwielicht, und es fiel das harte Wort vom Überläufer.64 Cicero konnte von Glück sagen, dass die Anzeige gegen Manilius nicht weiterverfolgt wurde und er den hochumstrittenen Parteigänger des Pompeius nicht zu verteidigen brauchte.