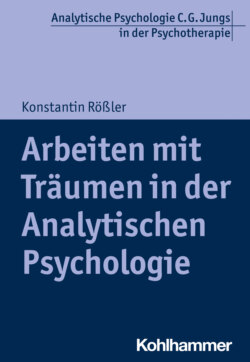Читать книгу Arbeiten mit Träumen in der Analytischen Psychologie - Konstantin Rößler - Страница 14
1.4 Der Traum in der Tradition von Aufklärung und Romantik
ОглавлениеWie eng die beiden konkurrierenden Auffassungen von Bedeutsamkeit oder Bedeutungslosigkeit des Traums beieinander liegen, lässt sich in den konträren Haltungen der Aufklärung und der Romantik zum Traum weiterverfolgen.
Interessanterweise stellt ausgerechnet ein Traum die entscheidende Zäsur im Leben René Descartes’ (1596–1650) dar, der als Vertreter des Rationalismus und Vorläufer der Aufklärung wesentliche Grundlagen eines dualistischen Weltbilds mit einer Trennung von Geist und Materie schafft, die noch heute die naturwissenschaftliche Forschung auch der Traumphänomene bestimmt. Descartes hält diesen Traum, den er am 10. November 1619 als Freiwilliger der bayerischen Armee unter General Tilly im Dreißigjährigen Krieg träumt, für so wichtig, dass er sich intensiv mit ihm auseinandersetzt, ihn veröffentlicht und als eine Art Erleuchtungserlebnis empfindet. In diesem Traum offenbare sich ihm der »Geist der Wahrheit« (von Franz, 2002, S. 159), der ihm die »Schätze aller Wissenschaften« zugänglich mache und der zur Grundlage seiner Wissenschaftstheorie wird. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, am Ende seines Lebens Träume als »Schatten der Seele« (Alt, 2011, S. 132) zu bezeichnen, deren Ursache nicht klar erkennbar sei.
In der aufgeklärten Literatur gerät der Traum als Ausdruck der Irrationalität und Gegenspieler des von der Vernunft geleiteten Bewusstseins in den »Bannkreis einer Defizithypothese« (Alt, 2011, S. 140), da im Traum offenbar die Abwesenheit zentraler Kategorien wie Wahrheit, Vernunft, Wahrnehmung, Gedächtnis und nach Hume vor allem des Bewusstseins herrsche (Alt, 2011, S. 138). Die anarchischen Vorgänge der Traumhandlungen sind mit den Mitteln der rational-kritischen Betrachtungsweise nicht zu erfassen. Der Traum wird als Widersacher der ratio eingeordnet, der sich jeder Erkenntnis verschließt: »Er erscheint wie ein Einbrecher in der Nacht, der bemerkt, daß der Hausherr, den er berauben möchte, verreist ist.« (Alt, 2011, S. 138). Für das in der Aufklärung mühsam errungene rationale Paradigma als Basis jedes Erkenntnisgewinns stellt der Traumzustand mit seinen bizarren Bildern und Handlungen eine regelrechte Bedrohung dar und ruft eine Abwehrbewegung hervor, die den Traum in die Nähe des Wahnsinns rückt: »Traum und Wahnsinn teilen im Zeitalter der Vernunft eine – freilich graduell unterschiedene – Tendenz, rationale Sinnstrukturen durch die Neukombination ihrer Bestandteile zu verfremden.« (Alt, 2011, S. 133).
Ganz anders die Entwicklung des Traumverständnisses in der Romantik, wo in zahlreichen literarischen Fassungen der Traum als Zugang zu einer transzendenten Ebene erlebt wird. Betont die Aufklärung – in moderner psychologischer Terminologie – das Ich-Bewusstsein und muss den Traumzustand daher als Bedrohung ansehen, ist in der Romantik gerade die Auflösung des Ichs in der geistigen Sphäre und sein Aufgehen im Ganzen Ziel eines inneren seelischen Entwicklungsprozesses. Besonders deutlich wird dies in Novalis’ 17. Blütenfragment formuliert:
»(…) Wir träumen von Reisen durch das Weltall – Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht – Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten – die Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt – (…) Aber wie ganz anders wird es uns dünken – wenn diese Verfinsterung vorbei, und der Schattenkörper hinweggerückt ist – Wir werden mehr genießen als je, denn unser Geist hat entbehrt.« (Novalis, 1984, S. 8).
Für die Entgrenzung des Ichs und seine Aufhebung besitzt der Traum in der Romantik geradezu modellhaften Charakter. So ist der Traum »für den romantischen Roman kein zweckgerichtetes Stimmungselement, sondern ein poetisches Modell« (Alt, 2011, S. 243). Der Traum wird zum narrativen Vorbild der romantischen Erzählung vom Eingehen des Subjekts in die Ordnung der Natur, gerät zugleich aber zum Ausdruck der Gegensatzspannung zwischen Individualität und Teilhabe am Ganzen: »Obwohl der Traum stets ein Merkmal von Individualitätserfahrung ist, bildet er daneben das Element einer allgemeinen ›Naturseelenentwicklung‹ (…)« (Alt, 2011, S. 252).
Mit diesem Primat des subjektiven Faktors der Welt im Inneren im Gegensatz zum aufgeklärten Paradigma der Objektivität als Erkenntniszugang zur Welt im Außen erschließt sich über die Romantik und ihre Rezeption in der Medizin und Philosophie des 19. Jahrhunderts auch der Weg hin zu einer Konzeption des Unbewussten.
Als wichtiger Wegbereiter Mitte des 19. Jahrhunderts kann hier exemplarisch Carl Gustav Carus (1789–1869) genannt werden. Als Arzt, Maler und Naturphilosoph gilt er als einer der letzten Universalgelehrten und entwickelt eine eigene Psychologie und Traumtheorie, die ihn als »Testamentsvollstrecker der romantischen Philosophie« (Alt, 2011, S. 273) erscheinen lassen. Auf sein 1846 veröffentlichtes Werk »Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele« geht die Begrifflichkeit des »Unbewußten« zurück, die später in die tiefenpsychologischen Konzeptionen des 20. Jahrhunderts Eingang fand. Er entwickelt darin ein Verständnis von der Seele als Zugang zum Wissen der Natur und kosmischer Erkenntnis. Dies wird vor allem im Zustand des Träumens vermittelt, wenn das Bewusstsein und der Wahrnehmungsapparat der Sinne ausgeschaltet sind und sich eine unbewusste Dimension mitteilt.