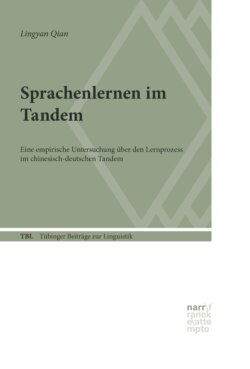Читать книгу Sprachenlernen im Tandem - Lingyan Qian - Страница 7
1.1.1 Interaktion und Zweitspracherwerb
ОглавлениеUnter Zweitspracherwerb versteht man den Prozess, bei dem ein Mensch sich neben der ersten Sprache eine zweite oder weitere Sprache aneignet. Dieser Prozess kann in der späten Kindheit, in der Jugend oder im Erwachsenenalter geschehen, wenn die Erstsprache erworben wurde. Je nachdem unter welchen Bedingungen eine neue Sprache erlernt wird, unterscheidet man zwischen den Begriffen Zweitsprache und Fremdsprache. Mit Zweitsprache wird in der Regel die Sprache bezeichnet, die zum alltäglichen Gebrauch lebensnotwendig ist. Die Sprecher leben z.B. in einem Kontext, wo vorwiegend diese Sprache gesprochen wird. Um an den sozialen, akademischen, politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen, sollten sie diese Sprache beherrschen. Im Gegensatz dazu ist unter Fremdsprache die Sprache zu verstehen, die man normalerweise im Kontext der eigenen Kultur lernt. Das heißt, die Lerner haben oft wenige Gelegenheiten oder Bedürfnisse, sich an den Aktivitäten in der fremdsprachlichen Gesellschaft zu beteiligen. Da der Fokus der vorliegenden Arbeit in der Rolle der Interaktion für das allgemeine Lernen einer neuen Sprache liegt, werden die beiden Begriffe (Zweitsprache und Fremdsprache) hier nicht extra differenziert. Das heißt, das Wort „Zweitsprache“ wird, wie in der Forschung üblich, für jede Sprache gebraucht, die nicht die erste Sprache des Lerners ist.
Die Forschung zum Zweitspracherwerb begann in den späten 1960er Jahren und zeichnete sich von Anfang an durch ihre Interdisziplinarität aus. Sie umfasste nämlich Didaktik, Linguistik, Kinderspracherwerb und Psychologie gleichermaßen (Huebner, 1998). Bis Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist dieses Forschungsgebiet eine eigenständige Disziplin geworden.
Einen Überblick über die Zweitspracherwerbsforschung bieten Ortega (2009) und Saville-Troike (2012). Ortega (2009) führt aus, wie universale, individuelle und soziale Faktoren den Erwerb der Zweitsprache von verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Lernsituationen beeinflussen. Ebenfalls davon ausgehend, dass man nur aus multi- und interdisziplinären Perspektiven ein umfassendes Bild über die Aneignung der Zweitsprache bekommen kann, stellt Saville-Troike (2012) verschiedene Forschungen zu diesem Thema aus den Bereichen der Sprachwissenschaft, Psychologie und Soziologie vor. Ein weiterer Fokus von Saville-Troike (2012) liegt darin, dass man sich beim Zweitspracherwerb nicht nur die Sprache, sondern auch die Kompetenz in der Zweitsprache aneignen sollte. Diese Kompetenz lässt sich ihrer Meinung nach auch aus mehreren Blickwinkeln definieren, z.B. sprachliche Kompetenz, kommunikative Kompetenz und Kompetenz für die Teihnahme an Aktivitäten wie Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen.
Dabei richtet sich der Blick in der linguistischen Zweitspracherwerbsforschung seit den 1980er Jahren auf die Wirkungen der Interaktion beim Erlernen der Zweitsprache. Es ist die Gruppe um Long (u.a. Chaudron, Doherty, Pica, Young), die die Input-Hypothese (u.a. Ferguson 1975, Chaudron 1977, Hatch 1974, Larsen-Freemann 1976, Krashen 1982, 1985) zur Interaktions-Hypothese weiterentwickelt hat. Während in der Input-Hypothese der Verständlichkeit der zielsprachlichen Äußerungen eine besondere Bedeutung für den Spracherwerb zugeschrieben wird, weist Long (1983) darauf hin, dass der Input durch Modifikationen der interaktionalen Struktur der Konversation verständlich wird. Die Bedeutung der Interaktion für den Zweitspracherwerb wird dadurch betont.
In der Interaktions-Hypothese lautet die allgemeine Auffassung, dass der Spracherwerb durch zweiseitige Interaktion erfolgreicher als durch einseitige stattfindet. Nach zahlreichen empirischen Untersuchungen über die Wirkung von Interaktion auf den Zweitspracherwerb ergibt sich die folgende Bilanz:
Interaktion bietet einen Kontext, in dem die Lerner mit dem Input der Zielsprache konfrontiert werden und damit versuchen, sie zu verstehen (Krashen 1982).
Interaktion bietet einen Kontext, in dem die Lerner gezwungen werden, in der zu lernenden Zielsprache zu kommunizieren und ihren Output in der Zielsprache verständlich und angemessen zu gestalten (Gass 2003, Swain 1995, 2005).
Interaktion bietet den Lernern die Möglichkeit zur Bedeutungsaushandlung („negotiation of meaning“) zum Zweck der gegenseitigen Verständigung (Gass 2003).
Das Feedback, das die Lerner in Interaktion bei Formulierungsschwierigkeiten oder Verständnisproblemen von ihren Interaktionspartnern bekommen, spielt eine bedeutende Rolle für den Zweitspracherwerb (Mackey 2006).
Möglichkeiten zum zielsprachlichen Output können die Beherrschung der erworbenen zielsprachlichen Kenntnisse und das flüssige Sprechen in der Zielsprache fördern (de Bot 1996, Swain 1995, 2005).
Während einerseits die positiven Wirkungen von Interaktion auf den Zweitspracherwerb entweder theoretisch oder empirisch verdeutlicht werden, gibt es andererseits auch kritische Meinungen dazu. Kommunikative Interaktion in der Zielsprache ist zwar wichtig für den Spracherwerb, aber effizientes Sprachenlernen erfolgt nach Edmondson und House (2003: 244) nicht mittels Interaktion allein. Ellis (2003) wirft der Interaktions-Hypothese vor, ein statisches Bild von Fremdspracherwerb zu zeichnen, bei dem letztendlich Interaktion auf einzelne, quantifizierbare Merkmale reduziert, der reziproke Charakter von Gesprächen aber negiert wird.
Hinsichtlich der Wirkung von Interaktion auf den Zweitspracherwerb bilden sich einige Forschungsfelder in den linguistischen Untersuchungen heraus. Im Vordergrund steht in der Regel die Forschung über gesteuerten oder ungesteuerten Spracherwerb in Interaktionen. In den folgenden Darlegungen wird ein Überblick über den Forschungsstand auf dem Gebiet des Zweitspracherwerbs in Interaktionen auf zwei Ebenen (gesteuerter und ungesteuerter Zweitspracherwerb) gegeben.