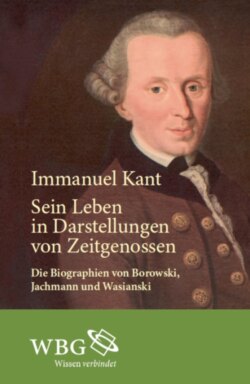Читать книгу Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen - Ludwig Borowski - Страница 7
Einleitung KANT UND SEINE FRÜHEN BIOGRAPHEN
ОглавлениеVon RUDOLF MALTER
Die Biographien von Borowski, Jachmann und Wasianski sind nicht nur die bekanntesten, sondern auch die wichtigsten der zeitgenössischen Lebensbeschreibungen Immanuel Kants. Alle drei verdanken sich der unmittelbaren Bekanntschaft der Autoren mit dem Philosophen; ihren besonderen Wert erhalten sie dadurch, daß sie jeweils einen anderen Lebensabschnitt Kants aus der Perspektive des Mitlebenden beleuchten: bei Borowski lernen wir vornehmlich den jungen Magister kennen, Jachmann beschreibt Kant auf dem Höhepunkt seines Schaffens, Wasianski führt uns in Kants Altersjahre.
Den drei berühmten 1804 erschienenen Biographien waren einige biographische Versuche vorangegangen. Sie können sich weder hinsichtlich der Authentizität noch hinsichtlich des Umfangs des in ihnen Mitgeteilten mit den Biographien der Sammelpublikation von 1804 – Borowskis, Jachmanns und Wasianskis Schriften wurden unter dem Titel ›Über Immanuel Kant‹ gemeinsam publiziert – messen. Kant selber hat alle Pläne, ihn noch zu seinen Lebzeiten zum Gegenstand einer Biographie zu machen, nachdrücklich abgelehnt. So erklärt sich wohl auch die Tatsache, daß er die bereits 1769 an ihn herangetragene Anfrage des Hallenser Geschichtsprofessors earl Renatus Hausen auf sich beruhen ließ (zumindest ist ein Antwortschreiben nicht bekannt). Hausen hatte ihm am 18. Nov. 1769 geschrieben:
„Sie dencken viel zu billig, als daß Sie mir meine Freyheit nicht vergeben solten. Ich bin entschloßen: Biographien berühmter Philosophen und Geschichtschreiber des 18. Jahrhunderts in und außer Deutschland zu schreiben. Ich habe auch bereits das Leben eines Ploucquet, und anderer erhalten. Die Absicht ist den Geist der Philosophie und Geschichte in unsern Zeiten zu zeigen. Ew: Wohlgebohrn haben dem Publicum so schöne und zugleich so gründliche Schrifften geschenckt, daß der erste Theil dieses Buches durch Dero Leben ein eignes Verdienst erhalten wird. Ich bitte dahero mir zu übersenden
1) Dero vollständiges Leben und Anzeige der Schrifften
2) die Bemerkung nach welchem Plane Sie die Philosophie studiret, und in ihren Schrifften bearbeitet, weil ich gerne den Geist der Kantischen Philosophie zeigen möchte.
Da das Buch Ostern herauskommen soll, so verspreche ich mir eine baldige Erfüllung meiner Bitte. Ich glaube gewiß, daß ihre Gewogenheit diese meine Litterarische Bemühungen unterstützen wird, und ich werde mich bestreben derselben künfftig immer würdiger zu werden“ (Ak 10, S. 79).
Die erste biographische Kantpublikation, ohne Wissen des Philosophen abgefaßt und veröffentlicht, stammt vom Abbé Dénina, der in seinem Werk ›La Prusse littéraire sous Frédéric II‹ (Berlin 1790) einen kurzen Lebensabriß Kants gebracht hatte. Aus dem Briefwechsel mit dem Verleger de la Garde geht hervor, daß Kant mit Déninas Darstellung höchst unzufrieden war und auf eine Korrektur drängte. Von der nächsten biographischen Veröffentlichung nahm Kant, soweit überliefert, keine Notiz – von der 1799 in Altenburg erschienenen, auf eine englische Vorlage aus der Feder von Richardson zurückgehenden Schrift ›Kants Leben. Eine Skizze. In einem Briefe eines Freundes an seinen Freund‹.
Die von Hasse und Wasianski überlieferte Äußerung Kants zu einer zu seinen Lebzeiten erschienenen Biographie bezieht sich wohl auf die 1802 in Königsberg publizierten ›Fragmente aus Kants Leben‹, als deren Autor mit ziemlicher Sicherheit der Königsberger Arzt Johann Christoph Mortzfeld anzunehmen ist. Hasse und Wasianski berichten in unterschiedlicher Weise über Kants Reaktion auf eine dem Greis in die Finger gekommene Biographie, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Mortzfeldsche handelte: nach Hasse habe Kant eine „Art von Wohlgefallen“ (Hasse 1804, S. 31) darüber geäußert, nach Wasianski dagegen habe er sich „sehr unwillig darüber“ gezeigt (Wasianski 1804, S. 215).
Die Jahre 1804 und 1805 brachten dann neben den drei Biographien der Sammelpublikation des Verlegers Nicolovius noch einige weitere kantbiographische Schriften: die von dem Theologen und Orientalisten Johann Gottfried Hasse stammenden ›Merkwürdigen Äußerungen Kant’s von einem seiner Tischgenossen‹ (Königsberg 1804, erste und – veränderte – zweite Auflage), dann die dem Königsberger Medizinprofessor und Kollegen Kants zugeschriebene anonym veröffentlichten ›Äußerungen über Kant, seinen Charakter und seine Meinungen. Von einem billigen Verehrer seiner Verdienste‹ (o.O., o.J.), weiter die auf vier Bände angelegte, aber nur in zwei Bänden erschienene sog. Leipziger Biographie, deren Autor bislang nicht ermittelt werden konnte: ›Immanuel Kants Biographie‹ (Leipzig 1804, 2 Bde.). Das Jahr 1805 komplettierte die 1804 herausgebrachten Biographien durch die ›Ansichten aus Immanuel Kant’s Leben‹ (Königsberg 1805) von Kants Schüler und Editor Friedrich Theodor Rink. Als Nachhall erschien 1848 die – leider unvermittelt abbrechende, ihrer Authentizität wegen höchst wertvolle – Charakteristik ›Kant und seine Tischgenossen‹ aus dem Nachlaß von Christian Friedrich Reusch, der im Titel der Publikation als „jüngster“ von Kants Tischgenossen vorgestellt wird. Wertvolle Informationen enthalten die von Rudolph Reicke herausgegebenen Materialien zu Walds Gedächtnisrede von 1804 (Reicke 1860).
Die späteren Kantbiographien, angefangen von Schubert über Vorländer bis zu Ritzel, beziehen sich durchweg auf die von den genannten Biographen gebotenen Quellen. Neben dem Kantischen Briefwechsel spielen in den kantbiographischen Darstellungen die Biographien von Borowski, Jachmann und Wasianski die Hauptrolle.
Auf Initiative des Königsberger Verlegers Nicolovius lieferten die drei ehemaligen Schüler Kants 1804 ihre Biographien. Jede von ihnen hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Borowskis Schrift lag zu einem Teil schon 1792 vor, Jachmanns Pläne gehen, angeregt durch Kant selbst, auf das Jahr 1800 zurück, Wasianski, offenbar von Freunden dazu bewegt, entschloß sich offenbar erst nach Kants Tod zur Abfassung seines Berichts. In Anlehnung an Karl Vorländers grundlegende Studie von 1918 (= Vorl. 1918) sollen im folgenden die drei Autoren und ihre Biographien kurz vorgestellt werden.
(1) Ludwig Ernst Borowski, geboren am 17.6.1740 in Königsberg, studierte Theologie an der Königsberger Universität (immatrikuliert 20.3.1755), war dann als Hauslehrer der jüngeren Söhne des (mit Kant in Verbindung stehenden) Generals von Knobloch tätig, 1762 übernahm er die Stelle eines Feldpredigers im Lehwaldtschen Regiment, wurde 1770 Erzpriester im ostpreußischen Schaaken und kehrte 1782 nach Königsberg zurück, wo er Pfarrer an der Neu-Roßgärter Kirche wurde. Seiner Beziehung zum preußischen Königspaar in der Epoche der napoleonischen Wirren verdankte er den Aufstieg in höhere kirchliche Ämter: 1805 bekam er die Stelle eines Oberhofpredigers an der Schloßkirche, 1812 wurde er zum Generalsuperintendenten, 1815 zum Bischof, 1829 zum (einzigen preußischen) Erzbischof ernannt; 1831 erhielt er den Schwarzen Adlerorden. 91 jährig starb er am 10.11.1831 in seiner Vaterstadt. Ein Denkmal neben der Neu-Roßgärter Kirche erinnerte bis zur Zerstörung Königsbergs an ihn.
Borowski ist der Biograph, der Kants akademische Anfänge direkt miterlebte. Er hörte als junger Student Kants erste Vorlesung im Wintersemester 1755/56; im kommenden Sommersemester vertrat er bei Kants Verteidigung der ›Monadologia Physica‹ die Stelle des Opponenten. Nach seinem Weggang von Königsberg blieb er in sporadischem Kontakt mit seinem Lehrer; eine nähere Verbindung ergab sich erst wieder 1782, doch zählte er nicht, obwohl er öfter in Gesellschaften mit Kant zusammentraf, zu seinen eigentlichen Tischgenossen.
Borowskis Biographie unterscheidet sich von den beiden anderen Biographien prinzipiell dadurch, daß sie (teilweise) – wie es auf ihrem Titelblatt heißt – „Von Kant selbst genau revidiert und berichtigt“ wurde. Im Vorwort gibt Borowski über Entstehung und Weiterbearbeitung seiner Kantbiographie Rechenschaft: im Zusammenhang mit dem Plan, über Kant eine biographische Skizze erscheinen zu lassen, wandte sich Borowski unter dem 12. Oktober 1792 schriftlich an Kant und unterbreitete ihm, mit der Bitte um Korrektur und Ergänzung, sein Manuskript. Kant willfahrte Borowskis Wunsch, bat ihn aber dringlich, mit der Publikation bis nach seinem Tode zu warten und vorderhand die durchgesehene Skizze als „Sammlung von Materialien zu einer Lebensbeschreibung nach meinem Tode“ zu betrachten. Borowski ergänzte 1804 das Manuskript von 1792 und übergab die vermehrte Schrift zusammen mit einer diplomatisch genauen Abschrift der von Kant stammenden Änderungen dem Verleger Nicolovius zum Druck. So besteht seine Biographie aus zwei deutlich unterschiedenen Teilen. Die Bemerkung auf dem Titelblatt „Von Kant selbst genau revidiert und berichtigt“ bezieht sich demnach nur auf den dem Umfang nach weitaus geringeren ersten Teil der Schrift. Und auch hier ist, wie Karl Vorländer bemerkt, Vorsicht geboten, denn ob Kant wirklich den Text genau durchgesehen und korrigiert hat, dürfte angesichts der offenkundigen Irrtümer fraglich sein. Vorländer hat die von Borowski gebotenen biographischen Daten minutiös mit den Resultaten der kritischen kantbiographischen Forschung verglichen und hebt folgende Punkte heraus: „Kants Vater war Riemer-, nicht Sattlermeister; seine Schwestern waren nicht sämtlich jünger als er, sondern eine davon älter; Knutzen starb nicht erst 1756, sondern 1751; Kants Erstlingsschrift erschien nicht 1746, sondern erst 1749; er hat im Gegensatz zu Borowskis Behauptungen 1. wohl den Namen des Oberkurators der preußischen Universitäten gekannt, 2. nach Berlin korrespondiert, 3. seinem Gönner Zedlitz eines seiner Werke dediziert, wie die Dissertation von 1770 König Friedrich, und 4. die Stelle an der Schloßbibliothek nicht ohne sein Gesuch erhalten, auch 5. sie aus einem anderen Grunde als dem von Borowski angegebenen niedergelegt“ (Vorl. 1918, S. 16f.).
Neben kleineren Änderungen ist eine der von Kant eingebrachten Korrekturen von besonderer Bedeutung; sie betrifft die in der biographischen Kantforschung ausführlich erörterte Frage nach Kants Theologiestudium und seiner Tätigkeit als Prediger. Kant strich, was Borowski darüber behauptet hatte, nämlich „1. Kant habe als Student der theologischen Fakultät angehört, 2. einigemal in Landkirchen gepredigt, 3. als er bei der Besetzung der untersten Lehrerstelle einem anderen nachgesetzt wurde, ‚allen Ansprüchen auf ein geistliches Amt entsagt‘, wozu dann 4. Schwäche seiner Brust als Mitursache angegeben wird, mit allerlei Bemerkungen, warum es gut sei, daß er nicht Prediger ward“ (Vorl. 1918, S. 17f.). Trotz einiger kleinerer Irrtümer auch im 2. (von Kant nicht bearbeiteten) Teil hält Vorländer die Borowskische Biographie für verläßlich und informativ: „… im Ganzen erhalten wir doch hier eine recht lebendige und zutreffende Schilderung einer Reihe Kantischer Wesenszüge: seiner Grundsätzlichkeit überhaupt und ihrer Anwendung auf die Behandlung seines Körpers, seiner äußeren Lebensweise, Kleidung, Wohnungen, Ausflüge, seines Verhältnisses zu den Geschwistern, Freunden, Frauen, der Obrigkeit, seines Umganges. Ferner seiner strengen Wahrhaftigkeit, Dankbarkeit, Wohltätigkeit, seiner finanziellen Grundsätze, seiner Selbständigkeit in der Forschung, seiner Lehrweise, namentlich (wovon wir sonst wenig wissen) in den ersten Jahren während Borowskis eigener Studentenzeit, der Vorbereitung seiner Schriften zum Druck und eine allerdings theologisch-salbungsvolle und nicht erschöpfende, aber doch ehrliche Darstellung von Kants Verhältnis zum Christentum; den Schluß bildet eine kurze Schilderung des Begräbnisses und der akademischen Trauerfeier“ (Vorl. 1918, S. 18f.).
(2) Reinhold Bernhard Jachmann wurde am 16. 8.1767 in Königsberg geboren; nach dem Besuch des Altstädtischen Gymnasiums bezog er 1783 die Königsberger Universität (immatrikuliert 11.4.1783), 1787 erwarb er den Grad eines Magisters, 1794 übernahm er die Stelle eines 3. Predigers in Marienburg, 1801 siedelte er als Leiter des Conradinum nach Jeschkau bei Danzig über; 1814 wurde er Regierungs- und Schulrat in Gumbinnen, 1832 Provinzialschulrat und Geheimrat in Königsberg und Thorn. Er starb am 28.9. 1843.
Jachmanns direkte Beziehung zu Kant dürfte schon bald nach seinem Eintritt in die Albertina begonnen haben. Wie er selbst berichtet, genoß er neun Jahre lang Kants Unterricht und stand in dieser Zeit in einem besonders engen Verhältnis zu seinem Lehrer. Kant kümmerte sich um Stipendien für ihn und für seinen Bruder, den Mediziner Reinhold Benjamin Jachmann. Häufig nahm er an Tischgesellschaften teil, bei denen auch Kant zugegen war. Zweimal trat er aus Anlaß von Kant zugedachten Ehrungen hervor: 1786 hielt er am Tag von Kants Rektoratsantritt eine Rede, 1789 übergab er zusammen mit Kiesewetter dem Philosophen ein selbstverfaßtes Geburtstagsgedicht. Zu seiner Schrift ›Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie‹ schrieb Kant das Vorwort. Nach seinem Weggang von Königsberg blieb er in brieflichem Kontakt mit Kant und besuchte ihn mehrfach. Bei einem solchen Besuch (1800) sprach Kant mit ihm über das Projekt einer künftigen Biographie. Vorländer macht darauf aufmerksam, daß hinsichtlich der Initiative zur Biographieabfassung möglicherweise eine Diskrepanz zwischen Jachmanns Ausführungen in der Einleitung zu seiner Schrift und seinem Brief an Kant vom 16.8.1800 besteht – nach ersteren sieht es so aus, als sei Kant an Jachmann mit dem Biographieplan herangetreten, nach dem Brief scheint aber eher Jachmann die Initiative ergriffen zu haben. Um Material zu erhalten, hatte Jachmann einen Bogen mit 56 Fragen an Kant geschickt. Hätte Kant den Fragenkatalog ausgefüllt, so wäre manche Dunkelheit in Kants Lebensgang durch ihn selbst aufgehellt worden. Jachmann hatte Kant folgende Fragen zukommen lassen:
Materialien zu Herrn Professor Kants Biographie
1. Tag und Stunde der Geburt.
2. Stand und Herkunft der Eltern.
3. Wie alt sie damals waren.
4. Das Characteristische ihrer Denkungsart in moralischer und religiöser Rücksicht.
5. Was sie für die Erziehung des Herrn Professor thaten.
6. Wie viel Kinder sie hatten.
7. Das wie vielste der HE. Professor war.
8. Sein Verhältniß zu dem übrigen Geschwister in der Jugend.
9. Wie waren seine Gesundheitsumstände in der Jugend.
10. Hatte er die gewöhnlichen Kinderkrankheiten? und welche? und wie wurden sie überstanden?
11. Hater in der Folgezeit bedeutende Krankheiten gehabt und welche? – – –
12. Das Temperament, die besonderen Züge der Sinnesart und des Characters in der Jugend.
13. Welches waren die hervorstechenden Neigungen in früher Jugend und in wie fern wurden sie befriedigt.
14. Die jugendlichen Spiele. –
15. Wann und von wem den ersten Unterricht empfangen.
16. In welche Schulen gegangen und wie lange?
17. Wer waren die Lehrer, wenigstens die vorzüglichsten.
18. Welche Wissenschaften und Sprachen wurden vorzüglich geliebt und getrieben?
19. Bei welcher wissenschaftlichen Beschäftigung äußerten sich zuerst und in welchem Alter vorzügliche Geistesanlagen? –
20. Welches waren die jugendlichen Schulfreunde und welchen Einfluß hatten Lehrer und Jugendfreunde auf Verstandesbildung und Denkungsart?
21. Wie waren die ersten Religionsüberzeugungen und welchen Gang nahmen sie zum ächten Religionsglauben? –
22. Wann auf die Universität gegangen und wie lange studirt?
23. Welchen Gang in den Studien genommen und auf welche Wissenschaften sie besonders gelegt?
24. Welches waren die vorzüglichsten academischen Lehrer?
25. Bei wem und nach welchem System die Philosophie gehört?
26. Auf welche Wissenschaften bezog sich vorzüglich die Lectüre und das Privat-Studium?
27. Wurde keine von den sogenannten 3 obern Fakultätswissenschaften studirt?
28. Wares schon früh der Plan sich dem academischen Lehramt in der philosophischen Facultät zu widmen?
29. Welche Geschäfte übernommen nach vollendeten Universitätsjahren
30. Wem und worin als Jugendlehrer Unterricht gegeben. Universitätsfreunde. –
31. Welchen anderweitigen Umgang gepflegt.
32. Erholungen und Lieblingsvergnügungen –
33. Hat nicht ein Frauenzimmer das Glück gehabt ausschließliche Liebe und Achtung auf sich zu ziehen?
34. Welche Frauenzimmer sind überhaupt zur Bildung in geselligen Eigenschaften beförderlich gewesen?
35. Wann die Magister Würde übernommen?
36. Welche Collegia und wie viel täglich in der Regel als Magister gelesen?
37. Die ökonomischen Umstande zu der Zeit
38. Ob und wem privatissima gelesen?
39. Wann in eine Professur getreten?
40. Wan und weshalb die Professur der Mathematic mit der der Metaphysic vertauscht?
41. Welche Anerbietungen gehabt auf andern Universitäten eine Professur zu übernehmen?
42. Auf welche Weise wurde der Herr Professor dem Friedrich II bekant.
43. Wie bewieß dieser seine Achtung? wie der Minister v. Zedlitz?
44. Die Hauptmomente von der Veränderung in philosophischen Meinungen und die Veranlassungen dazu besonders zum Uebergang in den Criticism.
45. In welcher Reihordnung die philosophischen Systeme der alten und neueren Philosophen studirt worden.
46. In wie fern sie auf die Philosophie des HE. Professor Einfluß hatten.
47. Wurden die kirchlichen Gebräuche der christlichen Kirche je mitgemacht und wann wurden sie aufgegeben?
48. Sind einige Predigten gerne angehört.
49. Hat das Studium der Bibel und einiger theologischen Schriften nicht auf die Lehrbegriffe der practischen Philosophie Einfluß gehabt.
50. Was hat zum ehelosen Stand bestimmt und ist nie der Wille gewesen sich zu verheurathen
51. Welche Menschen haben das Glück gehabt als Freunde vorzüglich werthgehalten zu werden.
52. Ueber die Verhältnisse mit Herrn Kaufmann Green.
53. Wie theuer sind die Schriften des HE. Professor von Anfang an bis zuletzt bezahlt worden und was haben sie wohl überhaupt eingebracht.
54. Bei welchen Speisewirthen und in welcher Tischgesellschaft gegessen.
55. Was hat zur Errichtung einer eignen Oeconomie Veranlassung gegeben und wieviel hat sie jährlich gekostet
56. Über den Umgang mit Schwestern und Verwandten und ihre Unterstützung.
(Ak 12, S. 323f.)
Da Kant – vermutlich aus Altersgründen – zur Beantwortung der Fragen nicht kam, mußte Jachmann auf das von ihm aus Kants Mund Gehörte und ansonsten ihm bekannt gewordene biographische Material zurückgreifen, zugute kam ihm jedoch in erster Linie sein jahrelanger persönlicher Umgang mit Kant – so besteht der spezielle Wert seiner Lebensbeschreibung vor allem darin, daß er aus direkter Anschauung ein lebensvolles Bild des Menschen, Gelehrten und Gesellschafters Kant entwirft. Das wird aus einer Inhaltsübersicht über die (fingierten) Briefe deutlich: Briefe 1 und 2: Angaben zu Kants äußerem Lebensgang; 3: „einige Züge zur Charakteristik des Geistes und der besonderen und hervorstechenden Geisteskräfte Kants“; 4: Kant als Lehrer; 5: Kant als Gelehrter; 6–8: Kant als Mensch; 9: Kants Familie; 10: ästhetischer Geschmack; 11: Religion (hier findet sich ein biographisch wie philosophisch bemerkenswertes Gespräch über die Unsterblichkeit); 12: politische Grundsätze (u.a. zur Französ. Revolution); 13: Kant als Gesellschafter; 14: körperliche Beschaffenheit; 15: alltägliche Lebensordnung; 16: Vermögensverhältnisse; 17 und 18: Altersjahre und Tod.
Auch Jachmanns Biographie wurde von Vorländer kritisch gesichtet; es ergaben sich hierbei folgende Corrigenda: „Aus der Ehe von Kants Eltern entsprangen neun, nicht sechs Kinder; und von seinen Schwestern lebte 1804 nur noch eine. Von seinen Hauslehrerstellen wird nur die eine auf Arnsdorf angegeben und die Hauslehrer-Zeit auf neun Jahre (statt etwa sieben) angesetzt; desgleichen die Erstlingsschrift, wie bei Borowski, auf 1746 statt 1749; Kant zog sich nicht schon 1794, sondern erst im Sommer 1796 vom Lehramt ‚ganz in seine stille Einsamkeit zurück‘. Green starb nicht zwanzig, sondern 1786, also 17 bis 18 Jahre vor Kant; auch ist die Freundschaft mit ihm nicht erst zur Zeit des englisch-nordamerikanischen Krieges entstanden. Lampe ist nicht wegen Altersschwäche entlassen worden“ (Vorl. 1918, S. 23f.).
Daß Jachmann von Kant „nur Rühmenswertes zu berichten weiß“ (Vor. 1918, S. 24) und daher gelegentlich zu Übertreibung (etwa im Falle der Kantischen Kenntnis der antiken Literatur) oder zur Harmonisierung schwer zu vereinigender Positionen neigt (so etwa bei seinem Versuch, Kants Begeisterung für die Französische Revolution mit dem preußischen Patriotismus in Einklang zu bringen), wird verständlich, wenn man die generelle Absicht der Jachmannschen Darstellung vor Augen hat – er hat sie im lateinischen Motto zu seiner Schrift deutlich bezeichnet: „nil maius generatur ipso, nec viget quidquam simile aut secundum“.
(3) Ehregott Andreas Christoph Wasianski stammt wie Borowski und Jachmann aus einer Königsberger Familie. Geboren am 3.7.1755, wurde er nach Besuch des Kneiphöfsehen Gymnasiums, wo sein frühverstorbener Vater bereits Lehrer war, am 17.9.1772 als Student der Theologie an der Albertina immatrikuliert; neben seinem Hauptfach interessierte er sich vor allem für Naturwissenschaften und Medizin; 1780 verließ er die Universität, um zuerst als Kantor, dann (1786) als Diakon, schließlich (1808) als Pfarrer an der Tragheimer Kirche in Königsberg zu wirken; dort hing bis zur Zerstörung Königsbergs sein Porträt. Er starb am 17.4.1831 in Königsberg.
Auch sein Kontakt zu Kant rührt aus seiner Studentenzeit (1773 oder 1774); er hörte bei Kant, war zeitweise sein Amanuensis und durfte unentgeltlich Kants Vorlesungen besuchen. Mit seinem Weggang von der Universität brach die Verbindung zu Kant für ein Jahrzehnt ab. Wie er selbst berichtet, wurde sie wieder erneuert, als er 1790 den Philosophen auf Pörschkes Hochzeit getroffen hatte. Seither gehörte er zu Kants Tischgästen und trat ihm im Laufe der Zeit persönlich immer näher. In Kants Altersjahren kümmerte er sich um die häuslichen Geschäfte des Philosophen. 1801 setzte ihn Kant zum Verwalter seines Vermögens ein. Wasianski widmete sich mit großer Gewissenhaftigkeit seiner Aufgabe; aufopferungsvoll wachte er über das leibliche Wohlergehen des immer hinfälliger werdenden Greises und suchte ihm seine letzten Lebenswünsche, z.B. kleine Ausfahrten, zu erfüllen. Wasianski gab offiziell Kants Tod bekannt. Er gehörte zu den Tischfreunden, die das Andenken des Philosophen in seiner Vaterstadt (im Rahmen der später so genannten „Gesellschaft der Freunde Kants“) weiterpflegten. Auch sprachlich hochbegabt, verfaßte er zur Feier von Kants 100. Geburtstag ein lateinisches Preisgedicht.
Die Idee, über Kants letzte Lebensjahre zu schreiben, ist, so der Autor, nicht „einem Vorsatz aus früherer Zeit“ entsprungen, sondern offenbar einem spontan entstandenen Entschluß, Kant vor „unberufenen Anekdotenkrämern“ zu schützen und authentisch, d.i. „aus dem täglichen Umgang mit ihm“ zu berichten. Diese Absicht dürfte er voll verwirklicht haben; der damals zu Kants Tischgenossen zählende Reusch hat die hohe Authentizität der Wasianskischen Darstellung bestätigt. Dem eventuellen Vorwurf, es herrsche in der Biographie keine durchgängige Ordnung, ist Vorländer mit guten Gründen begegnet:
„Wasianskis Darstellung erscheint auf den ersten Blick sehr unübersichtlich, weil sie ohne jede sichtbare Einteilung oder Gliederung fortgeht. Sieht man indes näher zu, so ergibt sich doch ein ungezwungener innerer Zusammenhang. Eins schließt sich wie von selbst an das andere an: an den Bericht von der Erneuerung der persönlichen Beziehungen die Schilderung von Kants Tischgesellschaften, seines sonstigen Tageslaufs seiner medizinischen Ansichten; dann der Beginn seiner Altersschwächen: Vergesslichkeit, allerlei Idiosynkrasien, Änderungen seiner Lebensweise, Unfälle, die ihn zur Engagierung Wasianskis führen, dem er schließlich alle seine häuslichen Angelegenheiten überläßt. Es folgt die Schilderung seiner Folgsamkeit, Bescheidenheit, Dankbarkeit gegen Wasianski, seines Testaments und – sehr ausführlich – die Entlassung des alten Lampe und Anstellung des neuen Dieners; dann die ergreifende Darstellung der von Jahr zu Jahr abnehmenden Kräfte bis zu den letzten Lebenstagen, dem Augenblick des Todes, der Aufbahrung und dem Begräbnis.
Dazwischen werden freilich – und daher wird der Eindruck der Unübersichtlichkeit verstärkt – an passender Stelle allerlei kleinere Episoden eingeflochten: so etwa, gelegentlich seiner Dankbarkeit gegen Wasianski, die Schilderung der gleichen Dankbarkeit gegen den Wohltäter seiner Jugend Dr. F. A. Schultz und gegen seine Mutter, oder in die Darstellung seiner letzten Jahre so verschiedene Einzelheiten wie der kurze Bericht über seine Bücherei, sein Urteil über das Biertrinken, Verhalten zur Musik, seine mechanische Ungeschicklichkeit, Fremdenbesuche u.a. Dabei werden oft Kleinigkeiten wie der Bedientenwechsel (s.o.), das Trinken einer Tasse Kaffee, Einzelheiten der Vermögensverwaltung, die Strumpfhalter des Philosophen sehr ausführlich beschrieben. Auf eine philosophische Würdigung seines Helden leistet er von vornherein Verzicht; so enthält er sich denn auch jedes eigenen Urteils über dessen Nachlaßwerk“ (Vorl. 1918, S. 26f.).
Wasianski hatte sich in sein Handexemplar eine Reihe von Ergänzungen eingetragen; sie wurden von Paul Czygan in einer Rede vor der „Gesellschaft der Freunde Kants“ 1892 vorgestellt.
Von den drei Biographien hat die von Wasianski die Leser vielleicht am meisten beeindruckt. Durch den englischen Dichter de Quincey gelangte sie zu literarischem Ruhm. Auf sie stützen sich eine Reihe von medizinischen Untersuchungen zu Kants seniler Gehirnerkrankung, wie überhaupt das von Wasianski entworfene Bild des dahinsiechenden Kant spätere Interpreten zu – teilweise abenteuerlichen – psychopathologischen Deutungen von Kants Persönlichkeit provozierte.
Überblickt man vom heutigen Standpunkt der kantbiographischen Forschung aus die zeitgenössischen Quellen für eine Lebensbeschreibung des Philosophen, so bleibt die schon früh erkannte Rangordnung bestehen: neben den spärlichen autobiographischen Äußerungen Kants und dem für jede Kantbiographie fundamentalen Briefwechsel bilden die drei Biographien die Hauptbasis für unser Wissen um Kants Lebensgang, seine Persönlichkeit und seinen Umgang mit den Königsberger Mitbürgern.
Felix Groß kommt das Verdienst zu, die drei Biographien nach über 100 Jahren dem Publikum wieder vollständig zugänglich gemacht zu haben. Die von Alfons Hoffmann betreute Ausgabe von 1902 (2. Aufl. 1907) hatte nur einen Auszug geboten. Großhat lediglich die in die Akademieausgabe aufgenommenen Stücke III (Über Schwärmerei) und V (Schulz-Rezension) weggelassen. Er wollte laut Vorwort von 1912 in einem zweiten kantbiographischen Band „alles sonst aus der Zeit Erhaltene an biographischem und anekdotischem Material sowie überhaupt alles zur Charakteristik Kants irgend Wertvolle bringen“. Dieser zweite Band ist nicht erschienen. Der vorliegende Neudruck des 1912 erschienenen Großschen Bandes hält sich ohne Abweichung an seine Vorlage.
Im Text abgekürzt zitierte Literatur
| Ak | Kant’s gesammelte Schriften. Akademie-Ausgabe, Berlin 1902ff. |
| Hasse (1804) | Der alte Kant. Hasse’s Schrift: Letzte Äußerungen Kants und persönliche Notizen aus dem opus postumum. Hrsg. v. Arthur Buchenau und Gerhard Lehmann. Berlin–Leipzig 1925 (die l. Aufl. der Hasseschen Schrift trägt den Titel ›Merkwürdige Aeusserungen …‹). |
| Reicke (1860) | Kantiana. Beiträge zu Immanuel Kants Leben und Schriften. Hrsg. v. Rudolph Reicke. Königsberg 1860. |
| Vorl. (1918) | Karl Vorländer: Die ältesten Kant-Biographien. Eine kritische Studie. Berlin 1918 (Ndr. Vaduz 1978). |
Weiterführende Literatur
Malter, Rudolf: Kant in der biographischen Forschung, in: Karl Vorländer: Immanuel Kants Leben. Neuhrsg. v. Rudolf Malter. Hamburg, 4., verbesserte Aufl. 1986, XIII–XXXIX.
Malter, Rudolf: Bibliographie zur Biographie Immanuel Kants, in: Karl Vorländer: Immanuel Kant. Der Mann und das Werk. Zweite, erweiterte Auflage. Hrsg. v. Rudolf Malter, Hamburg 1977, 2. Bd., 465–489.
Immanuel Kant in Rede und Gespräch. Hrsg. u. eingeleitet von Rudolf Malter. Hamburg 1990.
Stark, Werner: Eine Spur von Kants handschriftlichem Nachlaß: Wasianski, in: Kant-Forschungen. Band 1: Neue Autographen und Dokumente zu Kants Leben, Schriften und Vorlesungen. Hrsg. v. Reinhard Brandt und Werner Stark. Hamburg 1987, 201–227.