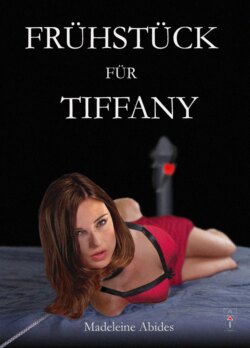Читать книгу Frühstück für Tiffany - Madeleine Abides - Страница 5
3
ОглавлениеVon Amts wegen waren wir nicht gehalten, bei Ortsterminen Uniform zu tragen. Eine wirkliche Uniform hatten wir Schreibtischtäter ja gar nicht. Dennoch hatte ich wie meist eines meiner dunkelblauen Kostüme angelegt, die einer Uniform nicht nur wegen der Applikationen an den Ärmeln zum Verwechseln ähnelten. Die hatte ich selbst anbringen lassen, um genau das zu bewirken, weil ich es satt gehabt hatte, im Außendienst nicht für voll genommen zu werden, nur weil ich eine Frau war. Und eine junge dazu.
Dazu hatte ich Pumps mit mittelhohen Absätzen gewählt, weil die beim Gehen und Stehen die Figur wunderbar strafften, was sich gerade im Gespräch mit aufsässigen Untertanen sehr bewährt hatte. Den richtigen Eindruck zu machen, ist manchmal einfach alles.
Dann noch die Haare mit zwei silbernen Spangen hochgesteckt und fertig war die unnahbare Bürokratenärschin, die ich darstellen wollte, damit ich nicht jede idiotische Kleinigkeit ausdiskutieren musste. Wer sich kompromisslos und ekelhaft gibt, wird von allen mit Samthandschuhen angefasst, auch wenn das etwa so sinnvoll ist wie ein wasserdichtes Nudelsieb. Jedenfalls wurde ich als Amtsperson von all diesen kleinmütigen sterblich Geborenen durch meine kleine Maskerade viel weniger belästigt als vorher.
In meiner Anfangszeit war ich noch naiv gewesen. Hatte mich umgänglich und verständnisvoll gegeben, stets bemüht, die Dinge wie unter normalen Menschen zu regeln. Doch das hatte dazu geführt, dass bei jedem meiner Termine dreimal so viel diskutiert wurde wie bei Kollegen, dass ich fünfmal so viele Einwände wegen nichts erhalten hatte und dass ich mich später zwölfmal so vielen fristgerechten Widersprüchen gegenübersah wie der nächstschlechteste Kollege. Und selbst der wurde im Amt schon wie ein armer Irrer behandelt, weil er einfach nicht begreifen wollte, wie er mit den nimmersatten Nörglern da draußen umzuspringen hatte.
Irgendwann hat man genug davon, immer nur die Dumme zu sein. Ich auch. Und seitdem trug ich Kostüm.
Maiki, mein vorvorletzter Ex hatte dem auch sein Gutes abgewonnen:
„Du siehst echt scharf aus in dem Dress!“, hatte er mir von der Couch aus zugerufen, als ich beim ersten Mal damit nach Hause gekommen war. Morgens hatte er mich nicht darin gesehen, weil er sich immer noch eine Stunde im Bett wälzen konnte, wenn ich längst aus dem Haus sein musste.
Trotzdem hätte er sich seine Bemerkung sparen können. Denn wenn er diesen glasigen Blick bekam, waren Worte überflüssig. Und er sollte mich nicht enttäuschen an diesem Tag. Jedenfalls nicht mehr als sonst auch.
An sich dachte ich ganz gern daran zurück. Nicht, weil ich voll auf meine Kosten gekommen wäre. Aber es war endlich mal wieder was anderes.
Die Uniform schien Maikis Gehirn anzuregen, denn grade er, der bei keinem Casting für phantasievolle Liebhaber über die Vorrunde hinausgekommen wäre, ließ sich plötzlich allerhand einfallen, damit ich die Uniform so schnell nicht auszog. Ich wiederum hatte Spaß daran, ihn damit zu gängeln, sobald ich das spitzgekriegt hatte. Endlich mal nicht dieses selbstherrliche Drüberlegen, Einführen, Absamen, das ich sonst von ihm kannte.
Es hätte ein hübscher Vorgeschmack auf mehr sein können, aber dann war die Uniform mit mir mittendrin wohl doch eine Spur zu scharf für den guten Maiki. Nachdem ich ihn mit allerlei Tricks und vielen geschmeidigen Ausweichbewegungen lange hingehalten hatte, war er halt doch wieder viel zu früh beim guten alten Einführen. Und sobald er den Nagel einmal angesetzt hatte, ließ er auch nicht mehr locker. Ich hätte ihn bestimmt abwerfen können, wenn ich unbedingt gewollt hätte, aber warum sollte ich ihm seinen Spaß nicht gönnen, solange ich selbst nicht vollkommen leer ausging? Also ließ ich ihn eben machen, stöhnte rechtzeitig ein bisschen mit, und dann war er tatsächlich sehr schön hart und sehr schön kraftvoll in mir. Er wütete ein bisschen, und das war schon nicht schlecht, aber als er dann kam, hätte ich auf dem Weg nach ganz oben noch eine schöne lange Strecke vor mir gehabt, die ich zu gerne ausgekostet hätte.
Natürlich merkte er es nicht einmal, sondern er war mit sich und der Welt restlos zufrieden, als er sich schließlich zurückzog.
„Du bist so unglaublich scharf in dieser Uniform“, stieß er keuchend hervor, und das sollte ich wohl als allerhöchstes Kompliment verstehen.
Naja, ich wollte die Stimmung nicht versauen und entschädigte mich selbst ein bisschen, indem ich den Oberkörper aufrichtete, kurz meine Haare fasste und ihn mit möglichst vorwurfsvollem Blick ansah:
„Das war sehr unartig!“, tadelte ich ihn im Tonfall der erzürnten Oberlehrerin. „Dafür werde ich dich streng bestrafen müssen!“
Damit erwischte ich ihn kalt, und ich hätte ums Haar laut hinausprusten müssen, weil er gar so verdattert dreinschaute. Der Kerl wusste doch tatsächlich nicht, ob ich das nun ernst gemeint hatte oder nicht.
Um wenigstens seine Unsicherheit noch ein wenig auszukosten, hob ich in einer Anwandlung von Hochmut das Kinn, kräuselte drohend die Augenbrauen und ließ meine immer noch bestens verpackten Brüste genau vor seiner Nase tanzen. Sein Gesicht war ein Bild für Götter!
Ich war sicher, dass er von diesem strengen Spezialservice zu gerne mehr gehabt hätte, doch irgendwie kam es nicht dazu. Kann sein, dass es an der Tür geläutet hat, oder vielleicht ging das Ganze auch rasch in eine zweite Nummer über, die dann doch nicht so unvergesslich wurde, dass ich mich noch daran erinnert hätte. Jedenfalls hat es später mit der Uniform nie mehr so gepasst, und das mit Maiki war ja dann auch bald zu Ende. Wir trennten uns freundschaftlich, und er tröstete sich bald mit dem Blondchen aus der Videothek, für das er schon immer eine Schwäche gehabt hatte. Mir war es sogar recht, denn das mit ihm und mir hätte sowieso keine Zukunft gehabt. Den Versuch war er wert, und wir hatten ein paar Monate echt eine gute Zeit miteinander, aber das war’s dann eben auch schon gewesen.
Aber interessiert hätte es mich schon, wie viel in der Geschichte mit der Uniform drin gewesen wäre. Es war zu offensichtlich gewesen, wie prompt er darauf angesprungen war, als ich diesen vorwurfsvollen Ton angeschlagen hatte. Ich kann es sehen, wenn ein Kerl Hunger auf mehr in den Augen hat, und Maiki hatte da solchen Heißhunger, dass er auch gegen strengste Erziehungsmaßnahmen keinen echten Widerstand geleistet hätte.
Ich hätte ihn dreimal um den Finger wickeln können, er hätte garantiert noch geschnurrt dabei. Und alles nur wegen einiger Flecken blauen Tuchs, die enganliegend über meine vorzeigbaren Rundungen drapiert waren.
Eigentlich ist diese Geschichte sogar meine beste Erinnerung an Maiki, und ich muss zugeben, dass ich schon ein paarmal versucht war, sowas bei einem seiner Nachfolger auszuprobieren. Leider ist es nie dazu gekommen, aber das hat mit der Zeit meine Lust darauf nur gesteigert, mal einen der Kerls hart ranzunehmen. Ich meine so richtig hart, vielleicht sogar mit Handschellen und ordentlich was mit dem Stöckchen hinten drauf.
Falls Maiki ein Maßstab ist, müsste das zu sehr langen, sehr heißen und sehr standfesten Ergebnissen führen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mich dann ganz nach Lust und Laune draufsetze und der arme Kerl wegen der Handschellen nichts bestimmen kann, keinen Rhythmus, kein Tempo, keine Tiefe des Eindringens, dann werde ich jedes Mal unglaublich feucht.
Naja, irgendwo läuft der arme Kerl, den es damit erwischen wird, jetzt vermutlich schon herum und hat noch keine blasse Ahnung, was ihm blüht!
*
Oberamtsrätin mit vierundzwanzig, das ging normalerweise gar nicht.
Wenn ich dennoch so jung Karriere gemacht hatte, lag das an meinen extraordinären, unerreichten, galaktischen Fähigkeiten. Gut, ein bisschen vielleicht auch an dem Programm „Women on Top“, das die Stadt lobenswerterweise zur rigorosen Durchsetzung der Frauenquote aufgelegt hatte.
Ein Mann hätte schon von jeher um die zehn Jahre länger warten müssen, um so weit nach oben befördert zu werden wie ich, aber dafür konnte ich ja nichts. Wenn gerade jetzt zahllose Frauen in Führungspositionen gebraucht wurden, musste auf dem Dienstweg eben auch mal eine Abkürzung eingerichtet werden. Denn wie hieß es so schön auf einem der Flyer: Am weiblichen Wesen soll die Welt genesen. Haargenau!
Von Petitessen durfte man sich da selbstverständlich nicht stören lassen. Wie etwa davon, dass halbwegs brauchbare Männer jetzt noch sehr viel später befördert wurden als sowieso schon. Oder davon, dass all die dummerweise momentan in Führungspositionen untergebrachten Männer schließlich noch umweltfreundlich entsorgt werden mussten.
Na, egal! Ich war jedenfalls bereit.
Und ich war dem Schicksal sogar ausgesprochen dankbar. Denn als ich damals eher zufällig auf „Women on Top“ gestoßen war, hatte ich mich gerade in einer ebenso unangemessenen wie beunruhigenden Zwickmühle befunden. Verkürzt ließe sie sich als die Wahl zwischen Pest und Cholera, in meinem Fall zwischen arbeiten und pleitegehen zusammenfassen. So war die Stellenausschreibung, mit der alles angefangen hatte, gerade zur rechten Zeit gekommen. Aus Dankbarkeit und zur ewigen Erinnerung hatte ich mir das Ding gerahmt und an die Wand gehängt, weil es schließlich sowas wie mein Freifahrschein für die höheren Besoldungsgruppen gewesen war.
Mit meiner flugs zusammengeschusterten Bewerbung überhaupt in die engere Wahl für eine von nur zwei ausgeschriebenen Stellen gekommen zu sein, hatte ich wohl hauptsächlich dem Umstand zu verdanken, dass das protzig aufgemachte bizonyítvány, das ich Jahre zuvor aus Debrecen mitgebracht hatte, überraschend als Zeugnis eines abgeschlossenen Auslandsstudiums anerkannt worden war. Ehrlich gesagt, hatte ich da zwar bloß ein paar Wochen Sommeruni der Budapester Sprachschule absolviert und selbst die hatten vor allem aus Sonnenbaden und Abhängen mit ein paar besonders ansehnlichen Kommilitonen aus aller Herren Länder bestanden.
Aber irgendwer im Personal- und Organisationsamt hatte wohl seine Ungarisch-Kenntnisse massiv überschätzt oder Bewerbungen von Frauen wurden sogar noch mit wesentlich mehr Begeisterung aufgenommen, als schon der Stellenausschreibung zu entnehmen gewesen war:
„Die Stadt Frankfurt am Main strebt an, den Anteil von Frauen in diesem Bereich zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bei Nichterfüllen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist die Beschäftigung im Arbeitsverhältnis nach EGr. 12 TVöD möglich.“
Ich versuchte mir vorzustellen, wie das in der Praxis aussehen sollte: Da stand dann also so eine Art Pförtner mit ulkigem Käppi am Posteingang der Behörde und sagte mit einer steifen Verbeugung irgendwas wie:
„Guten Tag, verehrte Bewerbung. Du stammst von einer Frau, daher möchte ich dich an dieser Stelle im Namen der Stadt Frankfurt am Main ganz besonders begrüßen.“
Nein, so einen Unsinn konnte ich mir nicht mal bei einer vom Steuerzahler durchgefütterten Behörde vorstellen. Was keineswegs heißen musste, dass es nicht so sein konnte. Aber in diesem Fall handelte es sich wohl eher um eine geheime Botschaft, die man vorsichtshalber verschlüsselt hatte. Obwohl es doch in Artikel 3 des Grundgesetzes klipp und klar heißt:
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
3 Bei gleicher oder irgendwie ungefähr ähnlicher Eignung sind Frauen bevorzugt zu behandeln.
Vielleicht hatten meine namenlosen Gönner einfach befürchtet, dass die Durchsetzung des dritten Absatzes von irgendeinem kleinlichen Richter gekippt worden wäre, wenn sie die Botschaft nicht verklausuliert hätten. Also sagten sie es mir lieber durch die Blume. Tatsächlich meinten sie:
„Nee, nee, Mädchen. Mach dir mal keine Gedanken! Ist alles kuschelig für dich vorbereitet, wirst schon sehen!“
Na schön, von mir aus! Mit Schwerbehinderten auf eine Stufe gestellt zu werden, fand ich zwar irgendwie nicht so prickelnd. Doch wenigstens musste ich mir wegen der gleichen Eignung gar keine Gedanken machen.
Schon nach fünf Minuten Vorstellungsgespräch war alles klar. Der ganze Tisch der Entscheider – allen voran die Amtsvorsteherin Melina Weber-Schnuckenreuth – war einhellig der Meinung, ich sei nach Abschluss einer längeren Anlernzeit mit Sicherheit gleich geeignet, die mir zugedachte Aufgabe zu übernehmen. Damit war die gleiche Eignung schon mal festgestellt.
Alle übriggebliebenen Bewerber außer mir waren männlich und Jahre älter als ich. Hatten daher auch viel mehr Berufserfahrung. Da aber einer von ihnen im Rollstuhl angereist und somit automatisch einzustellen war, kam für die einzig verbliebene Stelle praktisch nur noch ich in Frage.
Tja, Pech gehabt!
Selber schuld, wenn sie unbedingt Männer sein mussten und gesunde noch dazu. Wären sie wirklich so clever gewesen, wie sie glaubten, hätten sie doch wissen können, dass ein Mann zu sein ein grober Fehler war.
Da ich so toll für meine neue Aufgabe geeignet war, gestaltete sich mein Übergang in die Erwerbswelt fließend. Das Wichtigste dessen, was ich für die eigentliche Arbeit brauchte, wurde mir im Zuge eines speziell eingerichteten fünfzehnmonatigen Traineeprogramms vermittelt, das sehr abwechslungsreich verlief, gut bezahlt wurde und nicht unbedingt anstrengend war. Und für alles, was nicht gleich klappen wollte, hatte ich danach ja meine Leute, die sich mit all dem lästigen Kleinkram schon länger herumschlugen.
*
Ausgerechnet seit der aufregenden Freiheitsberaubung im Zoo hatte es allerdings nicht die kleinste Chance auf einen Auftritt in Uniform gegeben. Dabei hätte ich ihn gerade in meinem Zustand so gut gebrauchen können. Ich fühlte mich furchtbar unausgeglichen, fast gereizt, und es war überhaupt nicht schwer zu erraten, weshalb.
Das kleine Abenteuer, in das ich tags zuvor hineingeraten war, war am Ende regelrecht versandet. Wir hatten uns weder für ein nächstes Mal verabredet, noch hatten wir auch nur Handynummern ausgetauscht. Vielleicht hatte er gehofft, dass ich etwas vorschlug, während ich umgekehrt erwartet hatte, dass er darauf drängte. Jedenfalls hatten wir uns sang- und klanglos voneinander verabschiedet, und so wusste ich nicht viel mehr als seinen Namen und dass er mittwochs wie ich oft im Zoo anzutreffen war.
Gut, das würde sicher reichen, um ihn irgendwann mal wieder zu sehen. Nur wann?
Ich konnte natürlich ein paar Datenbanken bei uns im Amt anzapfen, um mehr über ihn zu erfahren. Aber seit immer mehr vollkommen unbedeutende Leute sich immer panischer dagegen wehren, dass wir in den Ämtern freien Zugriff auf ihre Daten haben, konnte das auch mal Ärger geben. Man konnte als treusorgende Staatsdienerin nie ganz sicher sein, dass nicht später irgend so ein wildgewordener Datenschützer dümmliche Fragen stellen würde, was zwar nie irgendwelche Konsequenzen hatte, aber eben einfach furchtbar lästig war. Deswegen hatte ich mich bereits entschieden, mit dem Anzapfen lieber noch ein wenig zu warten. Was meine Laune allerdings auch nicht grade verbessert hatte.
Gegen schlechte Laune jedoch – das wusste ich mittlerweile aus Erfahrung – half kaum etwas so rasch und so zuverlässig wie ein Auftritt in Uniform. Es ist ein überwältigendes Erlebnis, dieses unvergleichliche Gefühl der Macht zu spüren, wenn die niedriggeborenen Bürgerlichen vor der Uniform kuschen. Sie würden gerne aufbegehren, das sieht man ihren langen Gesichtern an. Aber sie wagen es nicht, weil die Uniform ihnen sagt, dass sie es mit einer Amtsperson zu tun haben. Und einer Amtsperson ist der Sterbliche nun mal auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Ja, das wäre jetzt genau das Richtige gewesen, ein paar von denen ein wenig quälen zu können! Nichts Schlimmes natürlich. Nur so viel, dass ihnen der Schweiß auf der Stirn stand und der Widerschein der Ohnmacht in den Augen. Macht über andere zu haben, war einfach wundervoll. Und dass ich dieses Gefühl ausgerechnet jetzt, in diesem Zustand missmutiger Unzufriedenheit mit mir, der Welt und allem übrigen, nicht genießen konnte, machte meine Laune gleich noch ein ganzes Stück schlechter.
Schon die Nacht über hatte ich unruhig geschlafen, am Morgen war ich nur widerwillig aus den Federn geschlüpft, und dann war ich auch im Amt kaum zur Ruhe gekommen. Die Dienststunden hatten sich so entsetzlich gezogen, dass ich es nur mit eisernem Willen geschafft hatte, bis zum Dienstschluss durchzuhalten. Und selbst das nur, weil ich den Dienstschluss dank eines Hinweises aus der Bevölkerung vorverlegen konnte.
Zu meinem Aufgabengebiet gehörte nämlich auch die Überwachung von Parks und Grünanlagen, und wenn es einen Hinweis aus der Bevölkerung gab, dass da etwas im Argen lag, musste ich dem natürlich nachgehen. Um so mehr, wenn es ausgerechnet um einen Park ging, in dem ich mit Connie oft eine Extraschleife drehte, und wenn der Hinweis auch noch besonders zuverlässig war, weil ich ihn mir strenggenommen selbst gegeben hatte. Natürlich erwähnte ich solche unwichtigen Details im Amt nicht extra, und ein Mitglied der Bevölkerung bin ich ja wohl ohne Zweifel.
Schon auf dem Trottoir vor dem Amtsgebäude entschied ich dann, dass die Parkinspektion warten konnte. Wenigstens bis Connie Zeit hatte. Es ist nie gut, wichtige Amtshandlungen ganz allein vornehmen zu wollen.
Zuhause angekommen warf ich mich erschöpft mit dem Handy aufs Bett, um mich mit ihr zum Joggen zu verabreden. Ich brauchte dringend etwas Bewegung, sowohl körperlich als auch geistig. Mir ging einfach zu viel durch den Kopf. Na ja, so viel eigentlich auch wieder nicht, eher immer dasselbe. Derselbe, genauer gesagt.
Es gibt kaum eine Beschäftigung, bei der ich meine Gedanken so frei fließen lassen kann wie beim Laufen. Connie geht es ähnlich, und so treffen wir uns zwei-, dreimal die Woche und laufen eine halbe Stunde vor uns hin, reden ein bisschen dabei und anschließend findet sich immer ein Lokal, in dem wir den Flüssigkeitsverlust umgehend wieder ausgleichen können.
Als ich Connie aus den zuletzt gewählten Nummern herauspicken wollte, fiel mein Blick auf eine Nummer, die mir unbekannt vorkam. Ich wähle prinzipiell keine mir unbekannten Nummern, und wenn ich es doch tue, dann erkenne ich sie hinterher wenigstens wieder. Diese hier nicht.
Erst mit Verzögerung, dann aber schlagartig, wurde mir klar, weshalb: Das war die Nummer, die Arnold gewählt hatte, diese linke Bazille, als er sich ohne Erlaubnis meines Handys bemächtigt hatte.
Wen er da wohl angerufen hatte?
Es interessierte mich zwar überhaupt nicht, und weshalb hätte es das auch tun sollen? Aber immerhin hatte er unerlaubt mein Handy benutzt, da war es doch nur angebracht, wenn ich einer verdächtigen Spur erst einmal nachging. Was ich sonst natürlich niemals getan hätte.
Also wer war es?
Wer konnte es sein?
Garantiert so eine doofe Tussi, mit der er was hatte oder vielleicht gerade was anfangen wollte! Er hatte diese gemein zufriedene Miene aufgesetzt gehabt, als er zu mir zurückgekommen war. Die haben Männer nur dann auf, wenn sie gerade bei einer Frau gepunktet haben. Aber dann immer.
Also wer?
Die Wiederwahltaste hatte ich schon gedrückt, als ich noch gar nicht mit dem Durchdenken fertig gewesen war. So überraschte es mich doch ziemlich, als jetzt aus dem Handy eine samtene Stimme zu hören war, die unversehens einen dicken Kloß in meinem schmalen Hals versenkte:
„Ja, Arnold Kreutzer, mit wem habe ich das Vergnügen?“
Es wäre ein Klacks gewesen, die Verbindung zu trennen und nicht nur den Anruf, sondern auch diesen hinterhältigen Kerl auf der Stelle zu vergessen. Aber sag das mal einer jungen Frau, die gerade von genau der dunklen, samtig warmen Stimme umgarnt wird, die ihr sowieso den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen ist. Und die Nacht über noch viel weniger.
„Ich …“, begann ich zögernd, und das klang so beschämend hilflos, dass die kleine Denkfabrik zwischen meinen Ohren schlagartig in Alarmbereitschaft versetzt und glücklicherweise sofort auf hundertzwanzig Prozent Leistung hochgefahren wurde. „Ich habe mich grade gefragt, wie weit Sie wohl inzwischen mit Ihren Brüsten sind.“
„Ach Sie sind’s, Maxine“, erwiderte er mit einem Lachen.
Seltsamerweise fand ich den Umstand, dass er sich nach beinahe sechsunddreißig Stunden noch an meinen Namen erinnerte, eine tolle Leistung. Für einen Mann, meine ich.
„Ich denke an gar nichts anderes mehr“, antwortete ich bemüht flapsig. Eigentlich war es als ironische Anspielung auf sein Forschungsprojekt gemünzt. Erst als es schon hinaus war, fiel mir auf, dass er meine hingehauchten Worte ohne weiteres auch als Aufforderung zu einem unmoralischen Angebot verstehen konnte. Was zwar auch nicht direkt falsch gewesen wäre, aber das musste ich ihm ja nicht unbedingt auf die Nase binden.
Ich gebe zu, dass ich in der Nacht zuvor ein wenig nachgeholfen hatte. Ich hatte natürlich an ihn gedacht und an all die aufregenden Sachen, die wir zusammen angestellt hatten. Nein, die er mit mir angestellt hatte. Ich hatte viel in mich hineingeschmunzelt, weil es sehr angenehme Erinnerungen waren, zumindest wenn ich an die Empfindungen dachte, die er in mir ausgelöst hatte. Ein paar Details waren nicht ganz so schön gewesen, eher ein bisschen blamabel, aber was spielte das jetzt noch für eine Rolle?
In mich hineinsummend hatte ich mir nächtens ausgemalt, wie schön es mit uns beiden noch werden konnte. Oder wie schön es hätte werden können? Ob es überhaupt noch so etwas wie ein Wir geben würde?
Ach was!
Ich hatte mir alles weiter ausgemalt, in den schönsten Farben, und die meisten dieser Farben waren irgendeine Schattierung von Rosarot. Naja, und soll ein Mädchen dann vielleicht gleichgültig bleiben, wenn es sich vorstellt, wie der Geliebte es in den Arm nimmt, und noch enger in den Arm nimmt und ihm zärtliche Worte ins Ohr flüstert und, und, und, und?
Es war mir auf einmal alles wieder in den Sinn gekommen, als ich nun diese Stimme wieder gehört hatte. Wie es schien, hatte das keinen vorteilhaften Einfluss auf meine Fähigkeit, mich unnahbar zu geben.
„War ganz nett gestern“, sagte ich irgendwann hilflos, weil mir einfach kein noch lockererer Spruch einfallen wollte.
Wenigstens wusste er damit schon mal, dass er auf meiner Bewerberskala nicht über ein mageres ‚ganz nett’ hinausgekommen war.
„Oh, ich fand es sogar sehr nett!“, entgegnete er zu meiner Verblüffung. Und dann auch noch in einem Tonfall, der oben am Treffpunkt meiner Schenkel ein Buschfeuer auslöste.
Ein paar Sekunden lang musste ich die Hand auf das Handy legen, damit er mein Keuchen nicht hören konnte.
„Sind Sie noch da?“, hörte ich ihn schließlich fragen.
„Ja, ja!“, entgegnete ich noch immer atemlos, nachdem ich hastig die Hand dort weggenommen hatte, wo sie nicht hingehörte.
„Ich habe von Ihnen geträumt“, erwiderte er ruhig. „Ich hoffe, das stört Sie nicht.“
„Nein, nein“, sagte ich rasch, ehe mir am Ende wirklich noch die Luft wegblieb. „Warum denn auch?“
„Oh, weil es ein reichlich anzüglicher Traum war.“
„Was denn? Sind Sie etwa zudringlich geworden?“
„Könnte man sagen.“
„Hoffentlich haben Sie mir erst rote Rosen gebracht, um sich für Ihr unmögliches Benehmen zu entschuldigen.“
„Nein.“
„Orchideen?“
„Was dann?“
„Ich hatte Sie in Ketten gelegt.“
Jetzt war es so weit. Jetzt blieb mir endgültig der Atem weg. Und was das Schlimmste war: Mir fehlten die Worte.
Wer mich kennt, weiß, wie ungeheuerlich das ist. Ich kann mich nicht erinnern, wann mich davor zuletzt ein Mann sprachlos gemacht hatte. Seit ich das erste Mal einen Büstenhalter umgelegt habe, jedenfalls keiner. Auf den Mund gefallen war ich schon als Kind nicht gewesen, aber seit ich jeden Morgen zwei hinreißende Wonnedinger in die Auslage packen konnte, wusste ich, dass die Welt mir gehörte.
Und jetzt auf einmal war ich sprachlos.
„Maxine?“
Seine Stimme klang echt ein wenig besorgt. Rührend!
„… j-jjahh…“
Es war eher ein klägliches Krächzen, das ich da mit letzter Willenskraft zustandebrachte.
„Sind sie okay? Sie klingen so – abwesend?“
„Oh, ich muss bloß nebenbei … gerade … etwas Wichtiges erledigen.“
Erst als ich das gesagt hatte, wurde mir bewusst, dass die Finger meiner freien Hand tatsächlich gerade etwas zu erledigen versuchten. Jetzt war die Hand wirklich an einer Stelle, an die sie nicht hingehörte.
Oder vielleicht doch?
Ich musste schlucken und hatte Angst, er könne etwas davon mitbekommen. Auch keuchte ich jetzt noch mehr als vorher, so dass ich mich schließlich zwang, die Zähne aufeinanderzupressen und die Lippen ebenso. Geatmet wurde nur noch durch die Nase. Zudem wollte ich mich zwingen, die Hand von dieser hochempfindlichen, ja explosiven Stelle fortzunehmen. Doch das misslang auf ganzer Linie.
Das Streicheln war wunderschön. Ich wusste doch genau, wie ich es am liebsten hatte, und während diese unerhört warme, männliche, hocherotische Stimme unaufhaltsam ins Zentrum meiner Ohrmuschel kroch und ungehindert bis tief in mein Inneres vordrang, befiel mich unwillkürlich die Vorstellung, dass noch etwas völlig anderes unaufhaltsam in mich drang. Etwas unerhört Warmes, Männliches, Hocherotisches. Etwas, das eine Frau mit Herz außergewöhnlich glücklich machen konnte.
„Ist Ihnen das peinlich?“, fragte er jetzt in besorgtem Tonfall.
„Was? Was soll mir peinlich sein?“
„Denken Sie sich nichts“, beschwichtigte er sanft.
„Es … war ja nur ein Traum, nicht wahr!“
Der Satz kam fast von selbst über meine Lippen. Ich vermute, es war eine Art natürliche Schutzreaktion, sowas wie ein Notprogramm meines überforderten Gehirns, das nach vorübergehendem Totalausfall gerade nur von einer Art Notstromaggregat gespeist wurde.
„Auch wenn Sie nackt waren. Das ist doch etwas ganz Natürliches.“
„Ich – war – nackt?“, stieß ich entsetzt hervor.
„Ja, sicher. Und in Ketten. Sagte ich das nicht?“
„Vielleicht schon. Ich frage mich nur …“
Wieder musste ich schlucken, weil meine unverfrorenen Fingerchen sich nicht zu schade waren, das Schlüpfrige der Situation schamlos auszunutzen. Was natürlich nicht unbedingt dazu führte, meine Beiträge zum Gespräch intellektuell über die Maßen aufzuladen.
„Ich frage mich nur, ob Sie immer so … wilde Träume haben.“
„Oh, ich erkläre mir das so, dass die Ketten wohl den Wunsch nach einer besonders festen Bindung symbolisieren. Zwischen Ihnen und mir.“
„Ja, das … das leuchtet mir ein“, säuselte ich halbherzig, weil sich um mich herum gerade erste rosa Schlieren zeigten. Meine Knie wurden weich, ein unerhörtes Glücksgefühl durchflutete meinen Leib und meinem Mund fiel es immer schwerer, noch wohlartikulierte Laute zu formen.
„Die Nacktheit wäre dann nur eine belanglose Randnotiz. Sie symbolisiert im Prinzip Ihre völlige Offenheit mir gegenüber“, fuhr er nachdenklich klingend fort. „Aber sie hat auch eine praktische Bedeutung.“
„We-welche denn?“
Mir war fast, als verschluckte ich meine Zunge, doch er sprach ungerührt in einförmig dozierendem Tonfall weiter, als wäre ihm noch nichts an mir aufgefallen. Was ich mir allerdings immer weniger vorstellen konnte.
„Sie haben ein entzückendes Hinterteil!“
Jetzt verschluckte ich meine Zunge. Naja, fast.
„Ich habe was?“, stieß ich hervor.
„Oh, es war gar nicht zu übersehen, so aufreizend schamhaft, wie Sie sich in Ihren Ketten gewunden haben“, entgegnete er entschuldigend.
„In … Ihrem … Traum!“
„Ein formidables Hinterteil! Prall und knackig. Allerbestes Erbgut! Sie können wirklich stolz darauf sein.“
Das war ich auch, jedenfalls ein paar Augenblicke lang, bis allmählich doch das Gefühl überwog, dass unsere Unterhaltung die schmale Grenze zum Bizarren bereits weit überschritten hatte:
„Ich dachte“, stieß ich kurz atmend hervor, „Sie interessieren sich mehr für … ähm … Euter!“
„Ach wissen Sie! In der Anatomie der höheren Säugetiere gibt es immer wieder gewisse Parallelen.“
„Parallelen …“
„Ja. Nehmen Sie nur die Proportionen. Ein wohlgeformtes Hinterteil beispielsweise lässt mit hoher Sicherheit auf ebenmäßige Gesichtszüge schließen und vice versa.“
„Vice versa …“
„Genau!“
„Sie meinen, bei Rappenantilopen.“
„Da auch.“
Diese Stimme machte mich kirre. Vielleicht hatte ich zu lange keine Männerstimme mehr am Ohr gehabt, vielleicht hatte aber auch sein Timbre von Natur aus einen so hohen Schlafzimmeranteil, dass ich es trotz allen Bemühens nicht mehr fertigbrachte, unter der Beschallung durch so viel schmeichelnden Wohlklang den Kopf noch einmal klar zu bekommen.
Auf einmal packte mich wieder dieselbe Empfindung, der ich schon machtlos erlegen war, als er mir im Zoo die Hände gefesselt hatte. Es war eine schrecklich verwirrende Mischung aus heftigem Widerstreben und einer nachgerade selbstverleugnenden Bereitschaft zur Hingabe, die all meine Sinne restlos benebelte.
Völlig aus dem Gleichgewicht geriet ich aber, als ich gewahr wurde, dass die Mitte meines Leibes von dem heftigen Verlangen erfasst wurde, dieser tolle Mann möge mich auf der Stelle wieder in Fesseln legen, möge mich entschlossen in den Arm nehmen, mich leidenschaftlich küssen und dann wild und unerbittlich absolut alles mit meinem wehrlosen Leib anstellen, wonach ihm gerade der Sinn stand. Und bitte keine Gnade!
Wie ich die Männer kannte, würde er sowieso nicht allzu lange überlegen müssen, womit er denn anfangen sollte.
Je mehr er jetzt noch redete und je weniger ich noch von seinen Worten erfasste, desto sicherer wurde ich, dass ich ihn – genau ihn! – jetzt auf der Stelle zu meiner Verfügung haben wollte. Oder wollte ich doch eher selbst bedingungslos zu seiner Verfügung stehen? Oder vielleicht beides zugleich? Atemlos lauschte ich noch meinen wildgewordenen Empfindungen, da fühlte ich die ersten Vorzeichen dafür, dass es mit mir durchging.
Zu dem Telefongespräch trug ich mittlerweile so gut wie überhaupt nichts mehr bei, außer vielleicht das weitgehend sinnfreie Echo seiner jeweils letzten Worte und ein immer schlimmer werdendes Keuchen, das dem Topzustand meiner Lunge und meines spitzenmäßig trainierten Sportlerherzens Hohn sprach.
„Hören Sie“, fiel ich ihm schließlich abrupt ins Wort, als er gerade über die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung wohlproportionierter Beine bei höheren Säugetieren dozierte, „ich muss jetzt wirklich … etwas sehr Wichtiges … ich … muss … ich … muss …“
Panisch drückte ich mit letzter Kraft den roten Knopf.
Die Verbindung war getrennt.
Es war eine Verzweiflungstat, die meine Lage auf lange Sicht höchstens noch komplizierte, doch für den Augenblick war sie meine letzte Rettung gewesen. Wenigstens was mein ohnehin schon arg ramponiertes Ansehen bei Arnold Kreutzer betraf.
Der Buschbrand jedoch hatte während des kurzen Gesprächs Ausmaße angenommen, die jeden weitergehenden Versuch der Rettung sinnlos machten. Niemand kann retten, was nicht mehr zu retten ist.
Wie aus weiter Ferne nahm ich wahr, wie meine gepflegten Finger mit größter Geschicklichkeit und wunderbarem Einfühlungsvermögen einen kleinen, aber um so wichtigeren Punkt meines Körpers stimulierten, bis ich mich plötzlich maunzen und wimmern und stöhnen hörte, wie ich es nicht mehr erlebt hatte, seit ich als Teenager auf die Möglichkeit gestoßen war, durch Ausdauer und einfühlsame Zärtlichkeit den Mann im Haus von eigener Hand zu ersetzen.
Was danach geschah, vermag ich im Einzelnen nicht mehr zu berichten. Ich weiß nur, dass es wundervoll war und dass ich fast nicht glauben konnte, wie gut ich mich gerade in den Momenten höchsten Glückes über die Abwesenheit jenes Mannes hinwegzutrösten mochte, nach dem sich mein Herz zugleich so unbeschreiblich verzehrte.