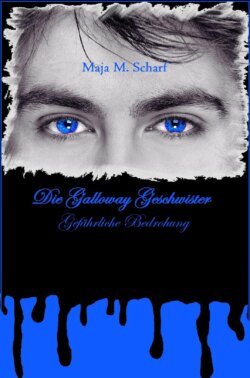Читать книгу Die Galloway Geschwister - Maja M. Scharf - Страница 5
1
ОглавлениеAls ich an diesem Morgen aufwachte, hatte ich noch keinen Schimmer davon, dass dieser Tag nicht nur vollkommen anders verlaufen würde als geplant, sondern auch der Beginn eines völlig veränderten Lebens für mich sein würde.
Als ich nach dem Ausschlafen aufstand und unter die Dusche ging, hatte ich noch keinen Schimmer davon, was mich an diesem Tag alles erwartete und dass mein Leben danach nie mehr wieder so sein sollte wie bisher.
Zunächst handelte es sich um einen ganz gewöhnlichen Samstagmorgen; nach dem Duschen lief ich hinunter in die Küche und gesellte mich zu meiner Mutter und Steven zum Frühstück.
„Guten Morgen, Amelia“, begrüßten sie mich fröhlich, als ich mich zu ihnen an den Tisch setzte.
Während Steven sich gleich wieder seiner Zeitung zuwandte, schenkte meine Mutter mir Kaffee ein und lächelte mich mit ihrem üblichen strahlenden Lächeln an. „Gut geschlafen?“, fragte sie.
Ich nickte und nahm mir ein Brötchen aus dem üppig gefüllten Korb in der Mitte des Tisches. „Klar“, antwortete ich lächelnd, „und du?“
Meine Mutter schmunzelte leicht. „Bestens“, erwiderte sie und wandte sich dann auch wieder ihrer Zeitung zu.
„Hast du irgendwas Bestimmtes vor heute?“, wollte Steven wissen.
Ich zuckte mit den Achseln. „Eric gibt heute Abend eine Party“, antwortete ich.
„Das ist ja mal was ganz Neues“, sagte Steven sarkastisch.
Ich funkelte ihn grinsend an. „Tja, hier kann ich ja noch keine Party machen“, gab ich trocken zurück, „da muss ich mich noch ein paar Wochen gedulden, bis ihr endlich auf Hawaii seid.“
Steven schüttelte lachend den Kopf. „Wehe“, murmelte er nur und wandte sich ebenfalls wieder seiner Zeitung zu.
Steven und meine Mutter waren bereits seit fast vierzehn Jahren miteinander verheiratet. Sie hatten sich kennen gelernt, als ich gerade einmal drei Jahre alt gewesen war. Seitdem war Steven wie ein Vater für mich. An meinen leiblichen Vater konnte ich mich nicht mehr erinnern, er hatte meine Mutter schon kurz nach meiner Geburt verlassen.
„Und was habt ihr heute so vor?“, fragte ich nach einer Weile.
„Ich habe nachher noch eine Telefonkonferenz“, sagte Steven und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. „Deshalb muss ich los.“ Er stellte seine Kaffeetasse in die Spüle, gab meiner Mutter einen Kuss und mir einen Klaps und verschwand aus der Küche.
Steven war ein vielbeschäftigter Mann; er war Geschäftsführer einer großen Immobilienfirma und verdiente viel Geld, hatte dafür aber auch immer viel zu tun.
„Und was hast du vor?“, wandte ich mich an meine Mutter, als wir alleine waren.
„Ich wollte in die Stadt fahren“, sagte sie und stand auf, um den Tisch abzuräumen.
„Triffst du dich mit dem Club der reichen Ehefrauen?“, entgegnete ich grinsend und half meiner Mutter.
Meine Mutter schnitt eine Grimasse. „Sehr witzig“, meinte sie. „Nein, ich wollte mir ein neues Paar Schuhe kaufen und vielleicht mal wieder zur Maniküre gehen.“
„Okay“, murmelte ich nur und räumte das Geschirr in die Spülmaschine. Der „Club der reichen Ehefrauen“, wie ich es nannte, bestand aus drei furchtbaren Frauen und meiner gutherzigen Mutter, die überhaupt nicht dazu passte. Meine Mutter war im Gegensatz zu den drei anderen Frauen selbst berufstätig (sie leitete ihre eigene kleine Backstube, in der es die herrlichsten Kuchen und Gebäckstücke gab, die man sich vorstellen konnte) und sie war ein herzlicher und freundlicher Mensch und nicht eiskalt und nur an Geld interessiert wie die drei anderen Frauen, die nichts konnten außer das Geld ihrer reichen Männer auszugeben.
Dieser „Club“ traf sich etwa zweimal im Monat und ich verstand einfach nicht, warum meine Mutter immer noch dabei war, aber sie meinte, sie müsste dahin, wenn sie weiterhin „zur Gesellschaft dazu gehören wollte“.
„Willst du mitkommen?“, fragte meine Mutter mich jetzt.
Ich antwortete nicht sofort, sondern sah sie skeptisch an. „Erstmal geh ich Zähne putzen“, sagte ich ausweichend und lief nach oben.
Während ich meine Zähne putzte, überlegte ich, was ich sonst bis heute Abend anstellen sollte. Mir fiel nichts ein, also sprach eigentlich nichts dagegen, meine Mutter zu begleiten, bis auf die Tatsache, dass ich solche Dinge wie eine Maniküre verabscheute.
Ich ging wieder nach unten und traf meine Mutter im Flur, die sich schon fertig zum Ausgehen machte. Sie warf mir einen kurzen Blick zu und fragte abermals: „Und? Möchtest du mitkommen?“
Nachdenklich betrachtete ich meine Mutter eine Weile, wie sie ihr Outfit vor dem Spiegel zurechtrückte und an ihren Haaren herum zupfte, und fragte mich unwillkürlich, ob sie wirklich meine Mutter war. Ich hatte so gut wie nichts mit ihr gemeinsam; sie tat viel für ihr Äußeres und legte Wert darauf, gut auszusehen und gut angezogen zu sein (ein ansteckendes Merkmal der reichen Ehefrauen, vermutete ich), wohingegen ich mit meinem Aussehen ziemlich locker umging. Meine Mutter machte Yoga und tanzte für ihr Leben gern, ging regelmäßig zur Maniküre und Kosmetikerin und liebte es, shoppen zu gehen, ich hingegen fand das alles eher ermüdend. Und meine Mutter war eine hervorragende Köchin und Bäckerin, während mir sogar die einfachsten Gerichte total misslingen konnten. Außerdem war meine Mutter einfach eine wunderschöne Frau, groß und schlank, mit langem blonden Haar, hellblauen Augen und sehr sinnlichen Lippen. Von ihrem hinreißenden Äußeren hatte ich nicht viel geerbt; ich war klein und hatte eine durchschnittliche Figur, braune Haare und dunkelgrüne Augen und volle, wenn auch nicht so toll geformte Lippen wie meine Mutter. Ich fand mein Aussehen okay, wenn ich auch zugeben musste, dass ich nicht so sehr darauf achtete und nicht viel tat, um besonders hübsch auszusehen.
Meine Mutter drehte sich zu mir um und zog fragend die Augenbrauen hoch. „Na?“
Ich zögerte. Ich war erst einmal mit ihr bei der Maniküre gewesen und das war fast noch langweiliger gewesen als den ganzen Tag zu Hause zu verbringen. Und ich mochte es nicht, wenn irgendwelche fremden Leute an meinen Händen herum fummelten.
Doch weil ich nichts Besseres zu tun hatte und meine Mutter mich so glücklich anstrahlte, nickte ich achselzuckend. „Wieso eigentlich nicht“, meinte ich und zog mir meine Schuhe an.
Wir betraten das Einkaufszentrum und ich folgte meiner Mutter ins Obergeschoss, wo das Nagelstudio lag, in dem sie sich schon seit Jahren ihre Nägel machen ließ. Die Ladeninhaberin begrüßte meine Mutter fast wie eine Freundin, mit Küsschen auf die rechte und linke Wange und einer überschwänglichen Umarmung. Nach der freundschaftlichen Begrüßung wies sie uns zwei Plätze zu und bot uns ein Getränk an, dann machte sich auch schon je eine Mitarbeiterin an unseren Händen zu schaffen.
Nach fast einer ganzen Stunde, in denen ich das Säubern, Feilen und Lackieren über mich hatte ergehen lassen, fühlten sich meine Hände so sauber und rein an, dass sie mir fast fremd vorkamen.
Meine Mutter bezahlte und wir verließen den Laden.
„Und wie findest du’s?“, fragte sie mich.
„Ganz gut“, log ich und brachte ein Lächeln zustande.
Meine Mutter durchschaute mich sofort und schnalzte missbilligend mit der Zunge. Dann blieb sie vor einem schicken Schuhgeschäft stehen und sah interessiert in die Schaufenster.
„Ich geh da mal kurz rein“, meinte sie.
Ich nickte amüsiert, da ich genau wusste, was „kurz“ zu bedeuten hatte. Glücklicherweise befand sich direkt gegenüber von dem Schuhgeschäft ein hübsches Café, wo ich warten konnte.
„Ich warte da auf dich“, sagte ich und deutete zu dem Café hinüber.
Meine Mutter lächelte verständnisvoll. „Okay, mein Schatz.“
Dann war sie auch schon in dem Laden verschwunden und ich schlenderte zu dem Café. Viele Tische befanden sich außerhalb des Lokals um einen großen Springbrunnen herum verteilt. Ich suchte mir einen davon aus und nahm Platz. Es dauerte keine zwanzig Sekunden, da war auch schon ein Kellner bei mir. Er war ein attraktiver Südländer und schenkte mir ein freundliches Lächeln.
Ich bestellte einen Cappuccino und er verneigte sich leicht vor mir, ehe er davon wuselte und die Bestellung am nächsten Tisch aufnahm.
Ich schaute ihm kurz nach und unweigerlich huschte ein leichtes Lächeln über mein Gesicht. Als ich mich abwenden wollte, blieb mein Blick zufällig an den zwei Mädchen hängen, die zwei Tische weiter saßen und aufgeregt miteinander tuschelten. Dabei verdeckten sie ihre kichernden Gesichter immer wieder hinter den Speisekarten und spähten dann immer über diese hinweg zu etwas offensichtlich furchtbar Interessantem, das sich auf der anderen Seite des Springbrunnens befinden musste.
Ich runzelte kurz belustigt meine Stirn über die beiden peinlichen Mädchen und wandte mich dann kopfschüttelnd von ihnen ab. Weil es hier ansonsten allerdings nichts annähernd Interessantes zu sehen gab, sah ich schon nach wenigen Sekunden wieder zu ihnen rüber und überraschenderweise starrten die Mädchen jetzt zu mir herüber. Stirnrunzelnd drehte ich mich um, um zu sehen, was sie anstarrten, doch es schien tatsächlich so zu sein, dass sie mich anguckten. Als unsere Blicke sich wieder trafen, wandten die Mädchen sich rasch ab und spähten schon wieder herüber zur anderen Seite des Springbrunnens.
Und dieses Mal folgte ich ihrem Blick.
Wenn ich in der Sekunde gewusst hätte, dass ich gleich zum ersten Mal den Jungen sehen würde, durch den sich mein ganzes Leben von Grund auf verändern würde, dann … ja, was dann eigentlich? Vielleicht hätte ich dann genauer oder aufmerksamer hingeschaut oder hätte sein Verhalten genauer beobachtet. Vielleicht hätte ich dann lieber gar nicht erst hingesehen?
Aber Tatsache war, ich sah hin, ohne mir irgendetwas dabei zu denken.
Er saß auf einer Bank neben dem großen Springbrunnen, hatte die Arme vor seiner Brust verschränkt und – und das fand ich tatsächlich etwas merkwürdig – er sah mir direkt in die Augen. Normalerweise hätte ich mich angesichts dessen gleich wieder abgewandt, aber es war mir nicht möglich. Ich hatte noch nie so einen Menschen gesehen.
Er war wohl so ungefähr in meinem Alter und er war nicht hübsch, sondern schlichtweg wunderschön. Er hatte kurze dunkle Haare, volle sinnliche Lippen und eine gerade perfekte Nase. Soweit ich das im Sitzen und aus dieser Entfernung beurteilen konnte, war er ziemlich groß und schlank, hatte breite Schultern und das weiße T-Shirt spannte leicht an seinen Brustmuskeln. Er sah unglaublich aus. Und noch dazu sah er mich unverwandt an. Der Blick aus seinen strahlend blauen Augen war von solch starker Intensität, dass ich seine Augenfarbe auch bei der Entfernung zwischen uns deutlich erkennen konnte und dass ich glaubte, Stromschläge darüber zu kriegen.
Ich schluckte und spürte, wie ich rot anlief. Mit all meiner Willenskraft wandte ich meinen Blick wieder von dem Jungen ab. Dass er mich ununterbrochen anstarrte, erklärte jedenfalls die Blicke der beiden Mädchen, allerdings fragte ich mich unweigerlich, warum so ein Junge jemanden wie mich anglotzte. Die einzige plausible Erklärung, die mir spontan einfiel, war, dass ich irgendetwas Komisches an mir hatte und mit einem Mal fühlte ich mich peinlich berührt.
Der Kellner kam wieder an meinen Tisch und brachte mir meinen Cappuccino. Ich war äußerst dankbar, dass er kurz die Sicht auf den Jungen verdeckte und am liebsten hätte ich ihn gefragt, ob ich irgendetwas Peinliches im Gesicht hatte, aber ich traute mich nicht. Und so entfernte der Kellner sich wieder und ich nippte an meiner Tasse und bemühte mich angestrengt, den Jungen nicht noch einmal anzusehen.
Doch ich spürte seine und auch die neidischen Blicke der beiden Mädchen und wollte nichts wie weg hier. So schnell wie möglich trank ich das heiße Getränk aus, legte genug Geld auf den Tisch, stand auf und wandte mich ab, ohne den Jungen oder die Mädchen noch eines Blickes zu würdigen.
Einen kurzen Moment lang wusste ich nichts mit mir anzufangen und stand etwas planlos an dem großen Springbrunnen herum. Während ich mich angestrengt darauf konzentrierte, nicht zu dem Jungen hinüber zu sehen, fragte ich mich, wohin ich jetzt gehen sollte. Es dauerte eine kleine Weile, bis mir wieder einfiel, dass meine Mutter sich in dem Schuhgeschäft auf der anderen Seite des Springbrunnens befand.
Schnellen Schrittes bewegte ich mich von dem Brunnen weg und auf den Eingang des Schuhgeschäfts zu, ohne mich umzudrehen. Ich wollte so schnell wie möglich von dem Café verschwinden und den Blicken des Jungen und der beiden Mädchen entkommen, die ich nach wie vor in meinem Rücken spürte.
Während ich auf das Schuhgeschäft zusteuerte, sah ich den Jungen und vor allem seine unglaublichen blauen Augen vor mir, deren Anblick sich auf meine Netzhaut eingebrannt zu haben schien. Und auch wenn ich es nicht wollte, konnte ich nichts dagegen tun, dass ich plötzlich stehen blieb und mich noch einmal umdrehte. Ich stand direkt im Eingang des Schuhgeschäfts und spähte zu der Bank an dem großen Springbrunnen rüber, doch der Junge war nicht mehr da. Er hatte seinen Platz verlassen.
Eine eigenartige Mischung aus Verwirrung und Erleichterung machte sich augenblicklich in mir breit. Kopfschüttelnd senkte ich meinen Blick und schmunzelte; sicher hatte ich mir nur eingebildet, dass er mich so angestarrt hatte. Vermutlich war es nichts weiter als ein zufälliger Blickkontakt zwischen uns gewesen. Und doch … seine blauen Augen und wie sie mich fixiert hatten …
Ich schluckte und versuchte, den Jungen aus meinen Gedanken zu vertreiben.
Und gerade als ich mich wieder umdrehte und das Schuhgeschäft betreten wollte, ging plötzlich alles sehr schnell.
Ich wandte meinen Blick von der Bank, auf der gerade noch der Junge gesessen hatte, ab und wollte mich wegdrehen, als ich auf einmal eine Bewegung vor mir wahrnahm. Es dauerte eine Sekunde, bis mir klar wurde, was für eine Bewegung das war. Jemand kam geradewegs auf mich zugerannt. Ich stutzte und runzelte verwirrt meine Stirn, doch es bestand kein Zweifel, dass die Person genau auf mich zurannte. Im selben Moment ertönte über meinem Kopf ein ohrenbetäubender Knall und der Boden unter meinen Füßen begann zu beben. Ich spürte sengende Hitze über mir und riss meinen Kopf hoch. Die Decke über dem Eingang des Schuhgeschäfts, über mir, war plötzlich explodiert, eine Feuerwelle rollte rasend schnell auf mich zu, Betonteile krachten von der Decke zu Boden und dicker schwarzer Rauch umhüllte das Geschehen.
Das alles geschah in Sekundenbruchteilen und es gab nichts, das ich hätte tun können, um zu verhindern, dass ich von der Explosion erfasst wurde. Merkwürdig … meinem Unterbewusstsein war vollkommen klar, dass ich in den nächsten Sekunden sterben würde und es hieß doch, in solchen Momenten zöge das gesamte Leben eines Menschen vor seinem geistigen Auge an ihm vorbei, doch das Einzige, was ich sah, war der Junge, der auf der Bank gesessen und mich aus seinen unglaublichen Augen angestarrt hatte.
Aber ich sah ihn überhaupt nicht vor meinem geistigen Auge, ich sah ihn plötzlich wirklich!
Genau in dem Augenblick der Detonation über mir, erkannte ich die Person, die auf mich zurannte; es war der Junge! Als er noch etwa drei Meter von mir entfernt war, stürzte er sich mit ausgestreckten Armen auf mich und erreichte mich, kurz bevor ich von der Feuerwelle und den herabstürzenden Trümmerteilen erfasst wurde. Die Wucht seines Körpers riss mich von den Füßen und stieß mich gute zwei Meter von der Explosion weg.
Ich landete unsanft auf dem Boden, spürte immer noch enorme Hitze über mir und atmete stickige giftige Luft ein. Trotzdem riss ich meine Augen auf und richtete mich ein Stückchen auf. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich dem Jungen direkt in die Augen.
Er lag genau vor mir auf dem Boden und erwiderte meinen Blick eindringlich.
Um uns herum herrschte das reinste Chaos; Menschen schrien und rannten in alle Richtungen davon, dichter Rauch breitete sich über und um uns herum aus und ein schriller Alarm hallte durch das ganze Einkaufszentrum. Ich nahm kaum etwas von alldem wahr, so gebannt starrte ich den Jungen an. Ich hatte keine Ahnung, wie er es geschafft hatte, aber er hatte mir gerade das Leben gerettet. Er hatte sich auf mich gestürzt, hatte mich rechtzeitig erreicht und vor der Explosion und den herabstürzenden Trümmerteilen beschützt.
Ich schluckte und öffnete meinen Mund, brachte jedoch keinen Ton heraus. Und selbst wenn ich etwas hätte sagen können; genau in dem Moment, in dem ich meinen Mund öffnete, sprang der Junge plötzlich auf, wandte sich ab und lief einfach davon. Ehe ich mich auch nur rühren konnte, war er in dem dichten Rauch verschwunden.
„Amelia!?“ Ein hysterischer Schrei holte mich in die Realität zurück und meine Mutter stürzte sich auf mich. „Um Gottes Willen, geht es dir gut, mein Schatz?“
Meine Mutter umarmte mich, nahm mein Gesicht in ihre Hände und küsste mich ab. Sie drückte mich ganz fest an sich und begann heftig zu schluchzen.
„Mama“, versuchte ich sie zu beruhigen, „es geht mir gut.“ Was ich selbst kaum glauben kann!
Meine Mutter schluchzte. „Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank!“
Ich blickte an mir herunter und bewegte meine Glieder und meinen Kopf; ich schien tatsächlich völlig unverletzt zu sein. Wie um alles in der Welt war das möglich? Wie hatte der Junge das gemacht? Ich musste ihm nachlaufen und ihm danken. Ich musste ihn fragen, wie er es hatte schaffen können, mich rechtzeitig zu erreichen. Außerdem musste ich mich vergewissern, dass es ihm gutging!
In dem Moment stürmten Sanitäter und Feuerwehrleute den Laden, sie löschten die kleinen Flammen, die die Explosion hinterlassen hatte, und versorgten die Menschen, die in der unmittelbaren Nähe gewesen waren.
Als sie mich untersuchen wollten, sträubte ich mich. Ich musste den Jungen finden!
„Sei doch vernünftig, Mädchen“, sagte der Sanitäter. „Du könntest ernsthafte Verletzungen davongetragen haben!“
„Amelia, du musst dich untersuchen lassen“, beharrte auch meine Mutter. „Es ist ein Wunder, dass es dir gut geht; du warst am nächsten an der Tür dran, als es passierte.“
Nein, es ist kein Wunder, dachte ich. Er war es. Er hat mir das Leben gerettet.
„Mir geht’s gut“, sagte ich entschieden und stand auf. Ich kam problemlos auf die Beine und spürte nach wie vor keinerlei Anzeichen einer Verletzung.
Der Sanitäter packte meinen Arm. „Wir müssen dich untersuchen. Es dauert auch nicht lange.“
Ich riss mich los. „Es geht mir gut, ehrlich“, rief ich und bevor mich jemand aufhalten konnte, lief ich los. Ich sprang über die Betontrümmer und rannte aus dem Schuhgeschäft hinaus. Ich blickte mich in alle Richtungen um und hielt Ausschau nach dem Jungen, der mir soeben das Leben gerettet hatte. Ich schaute nach rechts und links, nach oben und unten, lief ziellos durch die Gegend und suchte nach ihm, doch ich konnte ihn nicht finden.
Gerade als ich die Hoffnung aufgeben und zurück zum Laden laufen und mich untersuchen lassen wollte, entdeckte ich ihn plötzlich doch. Er stand etwa dreißig Meter von mir entfernt an einer Ecke und spähte unauffällig zu dem Schuhgeschäft rüber.
Schnellen Schrittes ging ich auf ihn zu, dabei betrachtete ich ihn und suchte nach erkennbaren äußeren Verletzungen. Er war etwas verdreckt und sein weißes T-Shirt war an einigen Stellen zerrissen und schwarz, aber ansonsten schien auch er vollkommen unversehrt zu sein. Von blutigen Wunden war keine Spur zu sehen. Wie konnte das nur möglich sein?
Als ich nur noch zehn Meter von ihm entfernt war, wandte er seinen Blick plötzlich mir zu. Seine Augen begegneten meinen und ich blieb abrupt stehen. Einen Moment lang sahen wir einander wieder nur an, dann wandte er sich erneut ab und verschwand hinter der Ecke.
„Hey!“, rief ich laut und setzte mich auch wieder in Bewegung. Nach wenigen Schritten begann ich zu laufen. „Hey! Warte!“
Doch als ich um die Ecke lief und damit rechnete, ihn wegrennen zu sehen, war er spurlos verschwunden. Ich stutzte und blickte mich stirnrunzelnd in alle Richtungen um, doch er war nirgends mehr zu sehen.
Ich schluckte und nach einer kleinen Weile ging ich zurück zu dem Schuhgeschäft, wo meine besorgte Mutter und der etwas genervte Sanitäter mich erwarteten.
„Na, junge Dame?“, sagte er in strengem Ton. „Lässt du dich jetzt endlich untersuchen?“
Ich nickte nur, sagte jedoch kein Wort.
„Ist wirklich alles okay, mein Schatz?“, fragte meine Mutter und nahm mich in ihren Arm. „Was ist denn los?“
Seufzend lehnte ich mich an sie und fragte mich, warum der Junge einfach abgehauen war. Auch während ich mit meiner Mutter im Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren wurde, dachte ich ununterbrochen an nichts anderes als an den Jungen; an seinen eindringlichen Blick von der Bank am Springbrunnen aus, an seine unglaublichen blauen Augen, daran, wie er schon vor der Explosion auf mich zugestürmt war, als hätte er gewusst, was passieren würde, und daran, wie er mich wie durch ein Wunder hatte retten können …