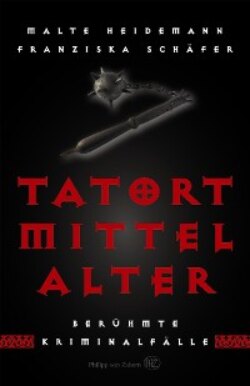Читать книгу Tatort Mittelalter - Malte Heidemann - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеKriminalfälle des Mittelalters – allein das Stichwort lässt uns einen kalten Schauder den Rücken hinunterlaufen. Denn das Mittelalter wird ja oft ausgemalt als eine Zeit, in der Raubritter und Straßenräuber mit bestialischen Waffen in der Hand hinter jedem zweiten Baum arglosen Reisenden auflauerten und bigotte Kleriker vermeintliche Ketzer und Hexen folterten und verbrannten; in der es von korrupten Amtsträgern nur so wimmelte und der Glaube herrschte, dass sie nach ihrem irdischen Ableben von geifernden, bratspießbewehrten Teufeln verdientermaßen auf ewig im brodelnden Pech gesotten werden, wie uns der Florentiner Dante Alighieri dies im „Inferno“, dem ersten Teil seines faszinierenden Jenseitspanoramas, im frühen 14. Jahrhundert erzählt. Und natürlich, die Kreuzzüge als Symbol der dumpfen Engstirnigkeit einer Epoche, in der Andersgläubige und Minderheiten häufig Ausgrenzung und Tod zu erleiden hatten, zudem soziale Unterdrückung mit einer unzählbaren Menge von Gewalttaten und Betrügereien jeglicher Couleur bittere Realität war – und gegen diese Orgie des Unrechts kaum ein Kraut gewachsen, da das Rechtswesen noch in den Kinderschuhen steckte …
In manchen Gesichtspunkten mag dieses Bild des Mittelalters als einer grausamen Epoche mit der Wirklichkeit übereinstimmen, in anderen aber sicher nicht. Diese Zeit war mitnichten eine rechtlose, sondern in den von den Humanisten später abfällig so bezeichneten „mittleren“ Jahrhunderten zwischen 500 und 1500 herrschte im Gegenteil häufig eine sehr klare Rechtsauffassung. Nur können wir diese oft schwer greifen und kaum verallgemeinern, da sich das Recht regional sehr unterschiedlich entwickelte und lange allein in Gestalt von mündlich tradierten Rechtsgewohnheiten lebte. Und darüber hinaus ist mittelalterliches Rechtsdenken für uns häufig schwer nachvollziehbar bis befremdlich, weil sich darin moderne, uns selbstverständlich gewordene Grundsätze oft noch nicht durchgesetzt hatten. Dazu gehört etwa das Gewaltmonopol des Staates, das in Demokratien heutzutage eine unabhängige Justiz und ein fein gegliederter Beamtenapparat auf der Grundlage von für alle geltenden Gesetzen streng bewahren. Diesen Anspruch mussten sich die Könige und andere überregionale Herrscher erst mühsam erkämpfen – nicht zuletzt gegen einen Adel, der sein Recht auf Fehde, das heißt auf rechtmäßige gewaltsame Konfliktaustragung, zäh verteidigte. Das Recht war nicht einheitlich gesetzt, sondern es wuchs allmählich aus den Bedürfnissen bestimmter Gruppen, Einungen, Schwurverbände, wozu auch die Städte gehörten. All diese Gemeinschaften bildeten ihren Zwecken dienende Rechte aus, mit denen sie ihr Zusammenleben organisierten. Von einem „Staat“ kann man daher im Mittelalter noch nicht sprechen und erst recht nicht von einer Polizei, die für die Einhaltung von Recht und Gesetz hätte sorgen können. Ermittler, Kommissare, deren Beruf es ist, Straftaten aufzudecken und Übeltäter dingfest zu machen, gab es damals nicht. Wie es natürlich auch keine Staatsanwälte gab, die im Namen des „Staates“ dafür hätten sorgen können, dass Täter ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Sie sind eine Erfindung, die sich erst im 19. Jahrhundert durchsetzte.
Doch wie wurden dann überhaupt Handlungen zum Schaden an Leib, Leben und Gut anderer verfolgt, wenn keine amtlichen Instanzen dafür existierten? Diese Frage lässt sich verhältnismäßig klar beantworten: Die zuständigen Gerichte derjenigen, die die Gerichtsbarkeit besaßen, seien es kleine Adlige, Grafen, weltliche und geistliche Fürsten oder Städte, wurden auf Anzeige eines Geschädigten tätig. Das Strafrecht des Mittelalters hatte zivilrechtlichen Charakter – der Einzelne musste seine Interessen selbst vertreten! Und wenn er die Tat beweisen konnte und ein Urteil erging, so sollte es auch vornehmlich dem Kläger dienen. Dabei war nicht wie heute, einem staatlichen Straferfordernis zu genügen, bei dem der Ausgleich für den Geschädigten meist zurückgestellt wird. Aus diesem Grundgedanken heraus galt im Frühmittelalter bis weit hinein ins Hochmittelalter ein System, das Rechtsbrüche – und dabei konnte es sich sogar um Mord handeln – mit einem Ausgleich finanzieller Art für den oder die Geschädigten „heilte“. Allerdings durften nur Adlige dieses Vorrecht genießen; ein einfacher Knecht, der sich etwas hatte zuschulden kommen lassen, musste körperliche Züchtigungen oder auch den Tod gewärtigen. Dieser Grundgedanke reicht bis in die sprachlichen Bezeichnungen für Rechtsbrüche hinein, die im frühen Mittelalter alle mit einer Ableitung des modernen Wortes „Schaden“ gebildet wurden. Es gab zunächst tatsächlich weder einen Begriff für „Straftat“ noch für „Strafe“! Erst ganz allmählich, ungefähr ab dem 11. Jahrhundert, gewann der Gedanke des Strafens zunächst in den aufblühenden Städten die Überhand gegenüber dem materiellen Ausgleich des Geschädigten. Und bis zum Spätmittelalter, also der Phase zwischen etwa 1250 und 1500, dauerte es, ehe dann solche schillernden Begriffe wie „Verbrechen“ und „Untat“ entstanden. In der rechtshistorischen Forschung hat dieser Vorgang den Namen „Entdeckung der Strafe“ erhalten, der eine sich über Jahrhunderte erstreckende Entwicklung bezeichnet.
Etwas anders stellt sich die Situation beim sogenannten Inquisitionsprozess dar, der keineswegs eine Erfindung der Kirche ist, aber vornehmlich von der Kirche ab dem 13. Jahrhundert zur Ketzerbekämpfung genutzt wurde. Dabei bedeutete er zunächst eigentlich einen klaren Verfahrensfortschritt und ersetzte archaische Formen wie Gottesurteile und Reinigungseide durch eine rationale Beweisführung. Hier schritt eine Behörde auf Anzeige oder aufgrund eines Verdachtes ein. Die Rechte der Angeklagten sollten zunächst in jedem Falle gewahrt bleiben. Im Laufe der Zeit hat die kirchliche Inquisition diese aber immer mehr eingeschränkt, bis ihrem Terror kaum ein Angeklagter mehr entrinnen konnte. Der Inquisitor vereinte auf sich die Funktionen des Klägers und des Richters gleichermaßen. Als besonders menschenverachtend empfinden wir die Anwendung der Folter zur Findung dessen, was man damals als Wahrheit verstand. Ohne Geständnis (oder auch die Aussage von Zeugen, die den Delinquenten auf „handhafter“, also frischer Tat beobachtet hatten) konnte es kein Urteil geben. Der neuzeitliche Indizienprozess war noch nicht geboren. Die Folter stammt aus der Antike; sie wurde im Zuge der Wiederentdeckung des römischen Rechtes eingeführt und hat bis weit in die Neuzeit hinein Angst und Schrecken verbreitet.
Dies verweist auf ein weiteres Charakteristikum mittelalterlichen Strafrechtes: das starke Hervortreten körperlicher Strafen. Bis zur neuzeitlichen Zurückhaltung, dem Körper eines Menschen Schaden zuzufügen, war noch ein weiter Weg zurückzulegen. Die ab dem Hochmittelalter immer mehr aufkommenden Leib- und Todesstrafen verfolgten den Zweck, am Delinquenten Vergeltung für sein Verbrechen zu üben und nebenbei die beim Vollzug anwesenden Zuschauer von der Nachahmung abzuschrecken. Die Sühne stellte die gebrochene Ordnung wieder her. Deshalb spiegelte die Strafe mitunter die begangene Missetat und so kam es, dass Brandstifter verbrannt wurden und Falschmünzer in heißem Öl starben, weil sie mit der Methode des Weißsiedens ihr minderwertiges Geld aufpoliert hatten. Verallgemeinern lässt sich auch dies nicht, aber eine Tendenz dorthin ist erkennbar. Außerdem sollte die einem Dieb abgeschlagene Hand später alle daran erinnern, dass sie es mit einem solchen zu tun hatten. Diese Menschen waren für den Rest ihres Lebens gezeichnet.
Und ein Weiteres können wir sagen: Das, was wir heute als Integration oder gar Inklusion bezeichnen, war sicher kein Charakteristikum des Mittelalters. Wer am Rand der Gesellschaft lebte, blieb in der Regel ausgeschlossen von den Vorteilen, die eine große Gemeinschaft bieten kann: Respekt und Ansehen, Schutz vor gewissen Unwägbarkeiten des Lebens – und leider häufig auch vom Recht. Egal, ob nun Jude, Muslim, (vermeintlicher) Ketzer, Krimineller, Vagabund, Homosexueller, Prostituierte, Aussätziger, sie alle ermangelten der Achtung durch die Mehrheitsgesellschaft und hatten Ablehnung, Verfolgung und einen Zustand der Rechtlosigkeit zu erwarten, zumindest vorübergehend und in verschiedenen Teilen Europas.
Das Arsenal der Verbrechen, die ein mittelalterlicher genauso wie ein antiker Mensch oder ein Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts begehen konnte oder kann, ändert sich grundsätzlich nicht: Mord in all seinen Varianten, Gewalttaten, Entführung, Diebstahl und Raub, die verschiedenen Formen des Betruges, mit denen andere übervorteilt werden. Letztere sind vermutlich noch die am stärksten zeitbedingten, denn Internetabzocke und Aktienbetrug wären auch den klügsten Denkern etwa des 12. Jahrhunderts genauso wenig verständlich zu machen gewesen, wie der Schadenzauber samt dem dahinterstehenden Weltbild für die meisten Menschen heute noch in irgendeiner Form nachvollziehbar ist. Er galt der vormodernen Welt jedoch als so real, dass ihn die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, also bereits in der frühen Neuzeit, mit Selbstverständlichkeit in die Liste der todeswürdigen Delikte aufnahm.
Aber das Mittelalter kennt noch weitere Spielarten der Untat und des Verbrechens, die wir nicht mehr als Straftaten akzeptieren können: So war die Felonie, der Treuebruch eines Gefolgsmannes gegenüber seinem Herrn, dem er zu Rat und Hilfe verpflichtet war, als außerordentlich schmählich angesehen und brachte den Verlust von rechtlicher und wirtschaftlicher Sicherheit. Dies konnte in der damaligen Zeit mit ihrer weit geringeren Abfederung von Lebensrisiken, als wir sie heute kennen, den Tod bedeuten. Und zu den schweren Vergehen zählte insbesondere auch die Ketzerei, damals ein massiver Verstoß gegen die von Gott geschaffene Ordnung und eine Verbündung mit den Mächten des Bösen, die meist die Hinrichtung des vermeintlichen Delinquenten auf dem Scheiterhaufen nach sich zog. Der Akt des Verbrennens sollte der Läuterung der Seele dienen. Hier wurden im 13. Jahrhundert Strukturen geschaffen, die bis weit in die Neuzeit hinein Bestand hatten und sich für die Betroffenen katastrophal auswirkten. Ketzerei als Auflehnung gegen Gott zwang außer der Kirche auch den weltlichen Herrscher zum Eingreifen; in diesem Sinne kennzeichnete sie Kaiser Friedrich II. als Majestätsverbrechen und dementsprechend übernahm der weltliche Arm seit 1224 die Exekution der Verurteilten.
In der Perspektive des Mittelalters lassen wir Ketzerei hier als Kriminalfall zu. Dies gibt uns die Möglichkeit, zwei der bedeutendsten Prozesse der Weltgeschichte mit in unseren Blick zu nehmen, die beide Ketzerprozesse gewesen sind: Die Rede ist einerseits von dem böhmischen Theologen und Kirchenreformer Jan Hus, der trotz einer Zusage freien Geleits durch den römisch-deutschen König Sigismund auf dem Konstanzer Konzil im Jahr 1415 verbrannt wurde. Und wir betrachten den Fall der kriegerischen Jungfrau Jeanne d’Arc, einer ebenso charismatischen wie rätselhaften Gestalt mit Auditionen, die während des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich lebte. Mit Mut gelang es ihr, das Kriegsglück des französischen Heeres entscheidend zu wenden, was ihr aber auch zum Verhängnis gereichte. Sie endete 1431 ebenfalls als Ketzerin auf einem englischen Scheiterhaufen.
Es gab jedoch nicht nur Einzelfälle von vermeintlicher Irrlehre, sondern auch ganze Massenbewegungen. Die stärkste und einflussreichste im gesamten Mittelalter war die der Katharer und Albigenser. Ihre Geschichte wurde in Deutschland mit der Lynchjustiz einer aufgeputschten Volksmenge 1143 bei Köln manifest, mündete später in einen grauenhaften, 20 Jahre dauernden Kreuzzug in Südfrankreich und verlief sich schließlich im Dunkel der Zeit. Da Ketzerei generell mit dem Kampf der Kirche gegen die Katharer eine massive Kriminalisierung erfuhr, werfen wir auch einen Blick auf diese Bewegung.
Bewusst verzichtet haben wir hingegen auf eine Beschäftigung mit den Hexenprozessen, die im allgemeinen Bewusstsein immer noch mit dem „finsteren Mittelalter“ verbunden werden. Dies steht aber im klaren Gegensatz zu den Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft. Zwar wurden einige Fundamente des späteren Hexenglaubens durchaus im ausgehenden Mittelalter gelegt – wozu in erster Linie der bereits erwähnte Schadenzauber gehört –, aber sie fanden damals noch keine allgemeine Anerkennung als strafwürdige Vergehen. Die tatsächlichen Fälle von Hinrichtung wegen Zauberei sind im Mittelalter daher vereinzelt und betrafen nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Hexenverfolgung als Massenwahn ist dagegen ein Krisenphänomen der frühen Neuzeit, das in mehreren Wellen zwischen dem späten 16. und der Mitte des 17. Jahrhunderts in Europa Zehntausenden von Menschen das Leben gekostet hat.
Überaus real zu allen Zeiten war und ist Mord. Auch die Epoche, mit der wir uns hier beschäftigen, macht da natürlich keine Ausnahme. Wir haben einige Fälle ausgesucht, die zu ihrer Zeit Aufsehen erregt haben. Was zunächst Königsmord angeht, so liegen im Mittelalter verschiedene Beispiele dafür vor, man denke im römisch-deutschen Reich an Philipp von Schwaben 1208 und Albrecht I.1308 oder in England an Richard II. 1399. Wir haben uns jedoch für den englischen König Edward II. entschieden; er wurde 1327 von oppositionellen Adligen getötet, denen sich sogar seine Frau angeschlossen hatte. Dieser Fall ist auch deswegen so interessant, weil Edward zeitlebens homosexuelle Neigungen nachgesagt wurden und wir hier nebenbei aufnehmen können, wie das Zeitalter zu gleichgeschlechtlicher Sexualität stand. Ganz anders gelagert ist das Schicksal der armen Maria von Brabant, Ehefrau des ebenso eifersüchtigen wie rabiaten bayerischen Herzogs Ludwig II., den die Nachwelt „der Strenge“ genannt hat. Es zeigt, welch tragische Ereignisse auch ein nur vermuteter Ehebruch nach sich ziehen konnte. Finsterste Machtkämpfe am französischen Königshof führten 1407, während des Hundertjährigen Krieges, zur Ermordung Ludwigs von Valois, des Herzogs von Orléans und zugleich Bruders des geistig umnachteten Königs Karl VI. Johann Ohnefurcht, der Herzog des für seine höfische Kultur eigentlich ja weithin gerühmten burgundischen Reiches, beauftragte die Meuchelmörder. Damit löste er einen Bürgerkrieg in Frankreich aus, welcher den Hundertjährigen Krieg mit England noch überlagerte und verschärfte. Seine Tat blieb juristisch ungesühnt, er fiel 1419 jedoch selbst einem Attentat zum Opfer, das aus dem Umfeld des französischen Thronfolgers heraus begangen wurde.
Wir haben zwei Massenmorde in die Darstellung mitaufgenommen: Ein markantes Beispiel für Gewaltexzesse gegen religiöse Minderheiten bietet der sogenannte „Rintfleisch-Pogrom“, der 1298 zur Tötung von fast dreieinhalbtausend Juden in süddeutschen Städten führte. Dem reichen Templerorden wurde in Frankreich nach 1307 mit geradezu modernen polizeistaatlichen Mitteln der Garaus gemacht. Dies beweist nebenbei, wie sehr sich in manchen Ländern gegen Ende des Mittelalters bereits eine effiziente Verwaltung herausgebildet hatte, die sich ganz unorthodox neue Geldquellen erschloss.
Kommen wir zu den Gewalttaten, bei denen die Opfer meist mit dem Leben davonkamen. Dazu zählt zunächst eine spektakuläre Entführung aus dem Jahr 1062, als eine einflussreiche Gruppe um den Kölner Erzbischof es wagte, sich des minderjährigen Königs Heinrich IV. zu bemächtigen. In diesem Fall nahm die Angelegenheit ein gutes Ende: Das Kind kam frei und konnte später seine Herrschaft antreten. Anders sah das im Falle des unglückseligen Philosophen Petrus Abaelard aus. Ihm wurde die Liebe zu seiner Schülerin Heloisa zum Verhängnis, denn die Familie des Mädchens ließ ihn entmannen und riss das Paar für den Rest seines Lebens auseinander. Vom Gipfel der Macht stürzte der stolze Welfe Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Bayern, der vor allem in seinen norddeutschen Landen rücksichtslos die Rechte anderer verletzt und den Landfrieden gebrochen hatte. Nachdem er auch Kaiser Friedrich Barbarossa seinen Hochmut hatte spüren lassen, ließ dieser ihn fallen und gab den zahlreichen Klagen seiner Feinde statt. Und noch auf einer ganz anderen Ebene liegen die Verbrechen des Klaus Störtebeker, der mit seinen Piraten Nord- und Ostsee unsicher machte und schließlich in die Hände der Hamburger fiel. In der Hansestadt verlor er 1401 Kopf und Leben.
Eine letzte Gruppe von Kriminalfällen behandelt die Aneignung fremden Gutes sowie verschiedene Formen des Betruges. Was ist Schenkung, was ist Diebstahl? Normalerweise sollte diese Frage klar zu entscheiden sein. Wenn sie jedoch einen Herrscher wie den römisch-deutschen Kaiser Karl IV. betrifft, der als sehr fromm galt und sich ebenso freundlich wie nachdrücklich Heiligenreliquien übertragen ließ, so erhält die Angelegenheit eine pikante Note. Die betroffenen Untertanen haben schließlich eine geschickte Methode entwickelt, sich den Begehrlichkeiten ihres Oberherrn zu entziehen. Dass auch ein ganzes Land von einem Betrug profitieren kann, mag ein Blick nach Österreich beweisen, dessen Herzog Mitte des 14. Jahrhunderts versuchte, sich mit einem Bündel gefälschter Urkunden, dem sogenannten Privilegium maius, weitaus mehr Rechte zu verschaffen, als er eigentlich besaß. Erfolg hatte er mit dieser Dreistigkeit zunächst nicht, seine Nachfahren hundert Jahre später schließlich aber doch. 1406 verfiel der Münzmeister von Thann im Elsass einem typischen Todesurteil: Da er Falschgeld hergestellt hatte, nahm sein Leben in einem Kessel mit siedendem Öl ein jähes Ende. Und das letzte Kapitel unseres Büchleins widmen wir dem Nürnberger Ratsherrn Niklas III. Muffel, der 1469 wegen Unterschlagung städtischer Gelder und Geheimnisverrats den unehrenhaften Tod eines Diebes am Galgen erlitt.
Wir haben also überwiegend prominente Verbrechen des Mittelalters ausgewählt, die naturgemäß häufig in den oberen Gesellschaftsschichten begangen wurden. Dementsprechend wissen wir meist sehr gut über die Umstände dieser Taten Bescheid; was die kleinen Leute sich haben zuschulden kommen lassen, lässt sich in der Regel nicht so gut nachverfolgen. Damit ist verbunden, dass die Darstellungen stark ins Politische tendieren – die Entführung Heinrichs IV., der Sturz Heinrichs des Löwen, die Beseitigung der Templer, der Mord an Edward II., die Fälschung des Privilegium maius, die Morde im Frankreich des frühen 15. Jahrhunderts sowie die Hinrichtungen der Jeanne d’Arc und des Jan Hus waren alle hochpolitische Ereignisse, die nur in diesem Kontext erklärbar sind. Dies gilt auch dort, wo es nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist: etwa bei Störtebeker und seinen Seeräubern, die politisch missbraucht wurden, bei den Judenschlägern des „Königs Rintfleisch“ oder beim Münzmeister von Thann, dessen Betrugsform weitreichende und verheerende Folgen haben konnte und aus diesem Grund unter schwerster Strafe stand. Die juristische Dimension tritt auch deswegen in den meisten dieser Fälle zurück, weil sie häufig ungesühnt geblieben sind – vor den aufgeklärten Zeiten mitunter ein Privileg der Mächtigsten, denn wo kein Kläger, da auch kein Richter. Daneben machen wir an verschiedenen Stellen auch auf kirchengeschichtliche und theologische Gesichtspunkte aufmerksam, die natürlich am ehesten bei den Ketzerprozessen eine Rolle spielen, aber auch bei Abaelard und den Reliquien Kaiser Karls IV.
Bevor wir nun den Blick in die Abgründe mittelalterlicher Menschen wagen, sei noch darauf hingewiesen, dass die Darstellungen auf den im Literaturverzeichnis angegebenen Werken beruhen, ohne dass wir Einzelnachweise angeben. Da dieses Buch keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse vermitteln, sondern bereits Erforschtes allgmeinverständlich darstellen soll, haben wir auf Fußnoten völlig verzichtet. Soweit nicht anders angegeben, stammen die Übersetzungen der Quellentexte von den Autoren.