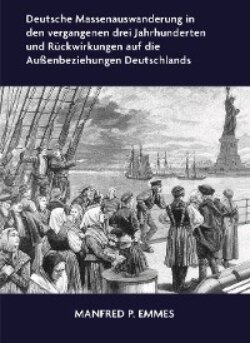Читать книгу Deutsche Massenauswanderung in den vergangenen drei Jahrhunderten und Rückwirkungen auf die Außenbeziehungen Deutschlands - Manfred P. Emmes - Страница 11
4.2. 1830er und 1848er Auswanderer als Wirtschaftsfaktoren und politische Kulturträger im Zielland USA
ОглавлениеUnzufriedenheit mit den sozialen und politischen Umständen des Heimatlandes, vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung der Freiheitsideen der US-amerikanischen und französischen Revolution, ein repressives und kontrollierendes Verhalten der Behörden in den deutschen Staaten, veranlassten und motivierten viele, in Verbindung mit dem Drang nach stärkerer politischer Mitbestimmung, auszuwandern. Gerade auch die reaktionäre Politik nach den Karlsbader Beschlüssen vom September 1819, die den Beginn der sogenannten „Demagogenverfolgungen“ darstellten, mit der Folge strikter Kontrolle der Universitäten, dem Verbot von Burschenschaften, der Freiheitsbeschränkung der Presse, der Entlassungen von Universitätsprofessoren und dem Ergreifen repressiver Maßnahmen gegen studentische Anführer etc. hatten viele freiheitsliebende Bürger in Widerstand zu diesen antiliberalen Tendenzen gebracht. Besonders deutlich war ihr Anteil an der Auswanderung. Die nationale und liberale Bewegung, vornehmlich nach den Frankfurter Unruhen 1833 und dem Zusammenbruch der Revolution von 1848, hatte bei breiten bürgerlichen Bevölkerungsschichten einen tiefen Eindruck hinterlassen und sie oftmals für deren politische Ziele gewinnen können. Tausende von politisch Engagierten, Teilnehmern der Aufstände und enttäuschten Sympathisanten, so u. a. auch die bedeutenden „1848er“ (Carl Schurz, Friedrich Kapp etc.) wurden verfolgt oder sahen für sich in Deutschland keine Zukunft mehr und emigrierten in die Vereinigten Staaten von Amerika. Gerade die politischen Umstände in den einzelnen deutschen Staaten sowie das Scheitern der Revolutionen von 1830 und 1848 und der Aufstände in Baden und in der Pfalz 1849, hatten eine Atmosphäre der Einschüchterung liberaler Kräfte geschaffen und waren die äußeren Triebkräfte, die den sprunghaften Anstieg der Auswanderungszahlen nach 1830 („1830er“), aber vor allem nach 1848 verständlich machen. Diese Gruppen sollten in den USA auf ein stimmungsmässig positives Umfeld stoßen.
Schon seit den 1820er Jahren hatten die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren Freiheitsidealen Revolutionäre jeglicher Richtung angezogen. Die unabhängigen USA galten den fortschrittlichen politischen Kräften in Deutschland und in vielen anderen Ländern vornehmlich als Modell für die Ablösung feudaler Macht und absolutistischer Monarchie. Sie waren das herausragende und nahezu leuchtende Symbol für politische Freiheit und Gleichheit sowie Gradmesser für die liberalen Entwicklungen jener Epoche. Auch umgekehrt, als in Deutschland 1848 die Märzrevolution ausbrach, gab es auf Seiten der Deutsch-Amerikaner viel Sympathie für diese Revolutionsbewegung. Obwohl die Zahl der „Achtundvierziger“, die Deutschland verließen, in Relation zu den weiteren Auswanderergruppen relativ klein war -die Schätzung beläuft sich auf insgesamt etwa 6.000 Personen -spielten verhältnismäßig viele von ihnen später wichtige Rollen im öffentlichen Leben und in der Gewerkschaftsbewegung Nordamerikas. Sie prägten dort das Bild des liberalen bis radikaldemokratischen Deutsch-Amerikaners. Überwiegend gehörten sie akademischen Berufen an und erhofften sich dort Chancen auf einen wirtschaftlichen Aufstieg, die für sie in Deutschland weitgehend unrealisierbar waren oder so erschienen. Zu den wichtigsten politischen Repräsentanten der deutsch-US-amerikanischen „Bindestrich-Kultur“ des 19. Jahrhunderts gehörten Carl Schurz und Friedrich Kapp.
Carl Schurz war als gefangener revolutionärer Kämpfer der demokratischen Bewegung 1849 aus der Festung Rastatt ausgebrochen und hatte anschließend in Frankreich und Großbritannien gelebt. 1852 war er in die USA ausgewandert, wo er 1869-75 Senator von Missouri und schließlich 1877-81 Innenminister der Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Zu den wenigen Revolutionären, die später nach Europa zurückkehrten, um dort – wenn auch inzwischen mit gemäßigter Haltung – wieder politisch aktiv zu werden, gehörte der anfänglich radikale Sozialist Friedrich Kapp. 1848/49 hatte er vorwiegend im Exil in Brüssel, Paris und Genf verbracht und war 1850 in die USA ausgewandert. In New York wurde er zum wohlhabenden Anwalt und wirkte zugleich als Journalist und Historiker für die dort lebenden Deutsch-US-Amerikaner, die er zusammen mit Carl Schurz nahezu geschlossen in die neue Republikanische Partei führte. Von 1866-70 war er Commissioner of Immigration (Beauftragter für Einwanderung) in New York, kehrte 1870 nach Deutschland zurück und gehörte von 1872-77 und 1881-84 als nationalliberaler und schließlich linksliberaler Abgeordneter dem Deutschen Reichstag an.
Die sogenannten deutschen 1848er zählten zu den bekanntesten politischen Aktivisten in den USA. Dort nahmen sie insbesondere an der öffentlichen Diskussion zu Arbeiterforderungen, Sklavenhaltung und Trennung der Südstaaten von der Union engagiert teil und bezogen dezidiert Positionen. Auch die von Deutschen in den USA gegründeten und organisierten Vereine, z. B. (freiheitlich gesinnte) Turnvereine (diese gehörten in der Revolution von 1848 bereits zu den einflussreichsten politischen Gruppierungen), Leseclubs, vertraten politische Anliegen, u. a. zu humanitären Themen, Forderungen zur Durchsetzung von Menschenrechten sowie zur - heftig geführten - Kontroverse um die Sklavereifrage etc. Auch ihr kulturelles Engagement, z. B. die Gründung von Gesangsvereinen und Schulen, fand weithin Beachtung.
Weniger Gewicht für die deutsche Auswanderung im 19. Jahrhundert hatten religiöse Motive, obwohl es diese bei einzelnen Gruppen durchaus gab (z. B. bei den Altlutheranern, schwäbischen Pietisten und Mennoniten).1