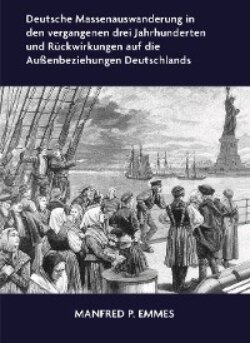Читать книгу Deutsche Massenauswanderung in den vergangenen drei Jahrhunderten und Rückwirkungen auf die Außenbeziehungen Deutschlands - Manfred P. Emmes - Страница 9
3.Frühe deutsche Massenauswanderung in den peripheren westlichen Großstaat USA
ОглавлениеDie Anreisen der Auswanderer zu den europäischen Auswandererhäfen waren oft langwierig und wegen der vielen Zollerhebungen auch recht teuer. Überdies stellten die Seereisen Richtung Amerika häufig mehr gefahrvolles Abenteuer als Vergnügen dar.
Viele besaßen nicht die finanziellen Mittel für die Seereise; so kam es im 18. Jahrhundert oft vor, dass an Arbeitskräften interessierte Bewohner des Ziellandes oder auch Reeder (diese vermittelten die Auswanderer im Ankunftshafen an in Frage kommende Betriebe) anboten, den Auswanderungswilligen die Kosten der Überfahrt zu bezahlen. Jene mussten sich im Gegenzug aber dazu verpflichten, im Zielland solange in fremde Dienste des Finanziers oder Dienste anderer Organisationen einzutreten, bis die Reisekosten beglichen waren. Diese Auswanderer wurden Redemptionisten (Loskäufer) genannt, weil sie sich durch ihre Arbeit erst von der eingegangenen Verpflichtung loskaufen mussten. Die Länge der Dienstzeit richtete sich nach der Höhe der eingegangenen Schuld und der Arbeitskraft des Schuldners. Ein guter kräftiger Arbeiter sollte etwa drei bis vier Jahre Dienst leisten, wobei indes auch Umstände eintreten konnten, bei denen sich die Dienstzeit auf sechs bis sieben Jahre verlängerte. Das „Redemptionisten“-System war im Grunde nichts anderes als eine Form der alten Schuldsklaverei. Da die Kosten der Überfahrt in diesem Zeitraum recht teuer waren, mussten sehr viele Auswanderer von diesem Verfahren Gebrauch machen. Es wird angenommen, dass zwischen 50 und 70 Prozent der deutschen Einwanderer in die USA im 17. und 18. Jahrhundert auf diese Weise die Überfahrt finanzierte. Oft kam es vor, dass so ganze Familien getrennt wurden, wenn Mann, Frau und Kinder zwecks Abarbeitung des Kredits an unterschiedliche Dienstherren weggegeben bzw. „verkauft“ wurden.
Vor der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1776 war das Land nur ein Nebenschauplatz der deutschen Auswanderung. Etwa 65.000-75.000, vielleicht bis zu 100.000 Deutsche -vor allem aus Baden, Württemberg und der Pfalz, aber auch aus Elsass-Lothringen und der deutschsprachigen Schweiz -wanderten im 17. und 18. Jahrhundert dorthin aus. Doch der Weg „nach Amerika“ war in dieser Epoche lang und beschwerlich, insbesondere die sechs bis acht Wochen dauernde Atlantiküberquerung bedeutete eine besonders harte physische und psychische Strapaze. Auswanderer wurden in den für Frachtzwecke gebauten Segelschiffen unter primitiven Verhältnissen in einem provisorisch zwischen Oberdeck und Laderaum eingefügten Zwischendeck transportiert. Während der langen Seefahrt waren die Auswanderer meist geschwächt durch Seekrankheit, unzureichende Ernährung sowie Mangel an Frischluft und Bewegung. Aufgrund schlechter hygienischer Verhältnisse waren sie zudem anfällig für Krankheiten, die sich an Bord rasch seuchenartig ausbreiten konnten. Viele Auswanderer, häufig mehr als die Hälfte aller Passagiere, sollten deshalb ihr Zielland nie erreichen.1
Deutsche Massenauswanderungen, die nach Ursachen, Zusammensetzung und Siedlungsmustern als Vorläufer der Massenbewegung des 19. Jahrhunderts angesehen werden können, fanden erstmals im 18. Jahrhundert statt, vor allem in den Jahren 1709, 1749-1752, 1757, 1759 und 1782. Hierbei war es vor allem das Zusammenwirken verschiedener rechtlicher sowie wirtschaftlich-sozialer Faktoren, die insbesondere in Süddeutschland zu Überbevölkerung geführt hatten. Aufgrund von Hungerkrisen nach Ernteausfällen hatte dies zur Folge, dass Tausende sich entschlossen, wegzuziehen. Dies galt vornehmlich für die Pfalz, in der sich die Notlage der Bevölkerung durch die wiederholten Kriegszüge Ludwigs XIV. mit ihren erheblichen Verwüstungen noch verschärft hatte. Bereits um 1775 lebten rund 225.000 Deutsche in den britischen Kolonien Nordamerikas (etwa 8,6 Prozent der Bevölkerung).
Ein im britisch-deutsch-US-amerikanischen Verhältnis bedeutsames Ereignis war die „Vermietung“ deutscher Soldaten an den britischen König Georg III. Dies war nicht nur von großer militärischer Tragweite, sondern wird hier insbesondere unter dem Aspekt der Auswanderungsthematik kurz dargelegt.
Um 1775 waren rund 15.000 britische Soldaten in den nordamerikanischen Kolonien stationiert. Zur Unterdrückung des Aufstands in der Kolonie, der letztlich zum Freiheitskrieg führte, forderte die militärische Führung eine Verstärkung um mindestens 40.000 Mann. König Georg III. ließ deshalb in anderen Staaten Söldner anwerben. In der Kriegsführung der damaligen Zeit war das (internationale) Söldnerwesen eine keineswegs ungewöhnliche Erscheinung. Auch Offiziere sahen im Wechsel von Heeresdiensten in fremden Ländern nichts Ehrenrühriges; das Kriegshandwerk war schließlich Grundlage ihres Erwerbs. Der Soldatenhandel, das „Vermieten“ von Truppen der Herrscher deutscher Länder an ausländische Souveräne, war im 17. und 18. Jahrhundert vielmehr stark verbreitet und gehörte zu deren lukrativen Einnahmequellen.
Der britische König Georg III. hatte sich auch an die Regenten von deutschen Klein- und Kleinststaaten gewandt. Schließlich konnte er eine Armee von nahezu 30.000 Soldaten aus diesen Ländern anwerben (Braunschweig, Hessen-Kassel, Hessen-Hanau und Hessen-Darmstadt, Ansbach-Bayreuth und Anhalt-Zerbst sowie Waldeck), wobei die Soldatenkontingente der Landgrafen von Hessen-Kassel (alleine 12.000 bei einer Bevölkerung von nur 300.000 Menschen), aus Hessen-Hanau und Hessen-Darmstadt zusammen nahezu 17.000 Soldaten ausmachten. Das deutsche Kontingent stellte über die Hälfte des für die Briten kämpfenden Söldnerheeres. Die deutschen Soldaten wurden in Nordamerika daher als „Hessians“ -Hessen -bekannt. Das Söldnerheer umfasste drei Gruppen von Soldaten: vermietete Berufssoldaten aus den stehenden Heeren, angeworbene Freiwillige und, da bei der geringen Bevölkerungszahl der Staaten die zugesagten Kontingente so nicht erfüllt werden konnten, gepresste (gezwungene) Soldaten.
Bereits im August 1775 landeten britische Verbände mit den ersten deutschen Hilfstruppen in Long Island, New York. Auf den Verlauf der im Weiteren einsetzenden Kämpfe kann in diesem Kontext nicht eingegangen werden. Für die Entwicklung der deutschen Überseeauswanderung waren die Eindrücke und Erfahrungen, die die deutschen Soldaten von Land und Bevölkerung gewannen, von großer Bedeutung. Gefangen genommene deutsche Soldaten wurden bevorzugt in die deutschen Gebiete Pennsylvanias verbracht, wo sie vor allem auf den Bauernhöfen oder als Handwerksgehilfen bei deutschen Einwanderern arbeiteten. So erfuhren die Söldner unmittelbar den deutlichen Kontrast zwischen den Lebensbedingungen in ihrer Heimat und der Lage ihrer ausgewanderten Landsleute. Durch das Einschmuggeln deutschsprachiger Flugschriften in das britische Heer wurde überdies zum Überlaufen der deutschen Söldner aufgerufen. Eine Proklamation des US-amerikanischen Kongresses sicherte am 29. April 1778 jedem Überläufer Landbesitz als Prämie zu. Zudem sollten Deserteure nicht dazu verpflichtet werden können, auf Seiten der US-Amerikaner am Krieg teilzunehmen.
Der Anreiz dieser in Aussicht gestellten Maßnahmen war groß und hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Am Ende des Unabhängigkeitskrieges 1783 kehrten etwa 17.300 deutsche Soldaten in ihre Heimat zurück. Etwa 1.200 Soldaten waren in den Kämpfen gefallen, etwa 6.300 an Verwundungen oder Krankheiten gestorben. Insgesamt jedoch entschieden sich etwa 5.000 deutsche Deserteure und Gefangene für einen Verbleib in Nordamerika. Einige dieser vom vermieteten Söldner zum Siedler gewordenen Deutschen ließen ihre Familie nachziehen; auch von den Rückkehrern hatten viele den Entschluss gefasst, zusammen mit Verwandten oder Freunden endgültig in die nunmehr unabhängigen Vereinigten Staaten von Amerika auszuwandern. Die Berichte der zurückkehrenden Soldaten bestätigten und verstärkten das positive Nordamerikabild der Menschen in Deutschland; sie trugen damit zum Anstieg der Auswanderung zur Massenbewegung im 19. Jahrhundert bei.
Für Deutschland bedeutete die Massenauswanderung im 18. Jahrhundert den Verlust von mehr als einer Viertelmillion überwiegend produktiver Menschen. Dies war nicht zuletzt durch die schwierigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zustände in den deutschen Ländern verursacht worden. Das galt für diejenigen, die nach Nordamerika gegangen waren, aber auch für die deutschen Siedler im Donauraum.
Trotz vieler aufgezeigter Schwierigkeiten und besonderer Verläufe sollte sich die deutsche Nordamerikaauswanderung des 18. Jahrhunderts fortsetzen und die Grundlage zum starken deutschen Element in den Vereinigten Staaten von Amerika bilden. Nach Auffassung zeitgenössischer Beobachter haben diese Migrationsströme erheblich zu dem bemerkenswerten Aufstieg der neuen Weltmacht USA Ende des 19. Jahrhunderts beigetragen.2