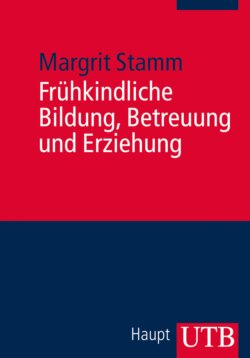Читать книгу Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung - Margrit Stamm - Страница 7
ОглавлениеEinleitung
Im 20. Jahrhundert wurde die Kindheit als eigenständige Lebensphase mit speziellen Entwicklungsbedingungen und Ansprüchen entdeckt. Erstmals wurden Rechte der Kinder formuliert, in der UN-Kinderrechtskonvention fixiert und ihre weltweite Durchsetzung angestrebt. Eines dieser Rechte ist das Recht des Kindes auf Bildung. Im Zuge der globalisierten Wirtschaft und ihren neuen Herausforderungen ist Bildung zur zentralen Ressource geworden, die ihr Potenzial im internationalen Wettbewerb unter Beweis stellen soll. Im Zusammenhang mit länderübergreifenden Schulleistungsstudien wie TIMMS und PISA haben deshalb viele Länder ihre Bildungssysteme überprüft und neu reguliert. In diesem Kontext und als Konsequenz von neuen Forschungserkenntnissen aus den Neurowissenschaften sowie der Entwicklungs- und Familienpsychologie wird die frühe Kindheit zunehmend als bedeutsame Phase in der individuellen Bildungsbiografie eines Menschen erkannt und als erster Schritt im Prozess des lebenslangen Lernens begriffen. Das internationale Interesse manifestiert sich denn auch in einem starken Anstieg der Bildungs-, Integrations-, Betreuungs- und Erziehungsarbeit in diesem Sektor (vgl. dazu auch die beiden Starting-Strong-Berichte der OECD von 2001 und 2006).
Diese Entwicklung trifft die Pädagogik relativ unvorbereitet, hat sie doch bislang die frühe Kindheit vernachlässigt. Wohl gibt es eine ausgedehnte Kindheitsforschung, doch hat das Thema Kindheit vor dem Schuleintritt noch wenig Tradition. Deshalb stehen noch wenig Antworten auf Fragen zur Verfügung, die Auskunft darüber geben, was frühkindliche Bildung ist, wie sie mit Betreuung und Erziehung verknüpft ist, wozu sie dient und mit welchen Inhalten sie versehen werden soll. Sie ist noch weitgehend eine Black Box. Angesichts der im gesamten deutschen Sprachraum entwickelten oder in Entwicklung begriffenen Bachelor- und Masterstudienprogramme im Bereich der frühen Kindheit sowie der verstärkten Etablierung von privat und staatlich verantworteten Betreuungs- und Bildungsangeboten wiegt dieser Mangel doppelt. Dazu kommt die große Meinungsvielfalt von Bildungs- und Sozialpolitikern. In den aktuellen medialen Diskursen äußert sie sich in unterschiedlichen, häufig ideologisch gefärbten Facetten, welche eine Unterscheidung von wissenschaftlich geprüften Erkenntnissen erschweren. Was uns somit mangelt, ist eine wissenschaftsbasierte, ideologiefreie Auseinandersetzung mit der Thematik.
Warum jedoch hat die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) eine so große Bedeutung erlangt? Zum einen aufgrund der Wissensexplosion in der Entwicklungspsychologie, den Neurowissenschaften und der Lehr-/Lernforschung, welche den ungeheuren Enthusiasmus und die Lernkompetenz junger Kinder ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt hat. Zum anderen sind es aktuelle bildungs- und gesellschaftspolitische Herausforderungen, welche die Brisanz der Thematik unterstreichen und sie nicht lediglich als Modeerscheinung deklassieren. Die Bedeutung von FBBE lässt sich vierfach legitimieren:
• Die ersten Lebensjahre sind die kritischste Phase für die Entwicklung eines Kindes. Dies gilt in sozialer, emotionaler und intellektueller Hinsicht. In der frühen Kindheit wird ein wichtiger Grundstein für den späteren Bildungs- und Lebenserfolg gelegt. Was hier unterlassen wird, kann später nur mit großem Aufwand aufgeholt werden. Die ersten fünf Lebensjahre sind eine Zeit enormen Anwachsens linguistischer, sozialer, emotionaler und motorischer Kompetenzen. Schon ab Geburt lässt sich dieser Kompetenzerwerb bei einem gesunden Kind beobachten, wenn es die Umgebung auszukundschaften beginnt, zu kommunizieren lernt und Ideen darüber konstruiert, wie die Dinge in seiner Umgebung ablaufen.
• Die Lerngeschwindigkeit eines jungen Kindes ist jedoch davon abhängig, inwiefern seine Neugier auf ein engagiertes, sensibles und förderliches Umfeld trifft. Der Aufwachskontext beeinflusst seine Entwicklung, seine Lern- und Bildungsprozesse in einem großen Ausmaß. Sollen junge Kinder somit Bildungsangebote annehmen können, müssen sie in gut entwickelte Beziehungsstrukturen eingebettet sein. Für den Aufbau einer allgemeinen Bildungsbereitschaft ist es deshalb besonders wichtig, dass ein Kind soziale Beziehungen sowohl in seiner Herkunftsfamilie als auch in seinem weiteren Umfeld pflegt und sich in diesem Beziehungsraum geborgen und emotional sicher fühlen kann. Deshalb kommt in den ersten Lebensjahren nicht nur Betreuungs-, sondern auch Bildungsprozessen eine grundlegende Bedeutung zu. Dies gilt sowohl für Kinder mit förderlichem als auch mit ungünstigem familiärem Hintergrund. Für diese Kinder gilt es jedoch ganz besonders.
• Insbesondere in Deutschland und der Schweiz sind Bildungschancen stark durch die soziale Herkunft bestimmt. Kinder aus unterprivilegierten, bildungsfernen Familien haben bereits beim Eintritt in den Kindergarten nicht die gleichen Chancen wie privilegiert und bildungsnah auf wachsende Kinder. Die Förderung muss deshalb bereits in den ersten Lebensjahren einsetzen. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil viele Längsschnittstudien aufzeigen, dass sich Leistungspositionierungen von Kindern über die Schuljahre hinweg nicht wesentlich verändern: Wer beim Schuleintritt vorne liegt, wird diese Position wahrscheinlich auch am Ende der Schulzeit innehaben, wer sie mit Defiziten beginnt, wird in den nachfolgenden Schuljahren mit Auf holen beschäftigt sein. Deshalb gilt: Je besser die frühen Jahre für FBBE genutzt werden, desto chancengerechter können Potenziale entdeckt, Defizite erkannt und allen Kindern gerechtere Startchancen für ihre nicht voraussehbare Zukunft gegeben werden.
• Das heute veränderte Rollenverständnis zwischen den Geschlechtern erhöht die Nachfrage nach außerfamiliären Betreuungsangeboten. In allen deutschsprachigen Ländern bestehen jedoch nach wie vor große und ungelöste Herausforderungen, Familie und Beruf ökonomisch und qualitativ verträglich zu vereinbaren. Dazu kommt, dass hochwertige Ausbildungen von jungen Frauen und Männern zu individuellen und volkswirtschaftlichen Verlusten führen, wenn ein Elternteil aus dem Berufsleben ausscheidet.
Was versteht man nun unter frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung? Diese Frage als Erstes zu beantworten ist zentral für die Lektüre dieser Publikation und das in ihr entfaltete Verständnis. Denn aktuell gibt es in allen deutschsprachigen Ländern, insbesondere in der Schweiz, einen relativ vehementen Widerstand gegenüber dem Ansinnen, die «Bildung» in der frühen Kindheit zu verankern. Nicht selten wird sie sogar als einer glücklichen Kindheit abträglich erachtet. Der Grund für diese Ablehnung liegt hauptsächlich darin, dass unter frühkindlicher Bildung die Vorverlegung schulischer Inhalte in den bis anhin bildungsfreien Vorschulraum verstanden wird. Frühkindliche Bildung ist jedoch etwas anderes. Sie meint die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit sie sich entfalten können, eine tätige Aneignung der Welt erlauben und zu einer selbst bestimmenden Individualität führen (vgl. dazu auch von Hentig, 1996). Diese kindliche Aneignungstätigkeit entspricht dem angeborenen Drang des Kleinkindes, selbsttätig zu sein, zu erkunden, zu beobachten, zu fragen und zu kommunizieren, sich Wissen anzueignen und sich ein Bild von der Welt zu machen. Solche Aneignungstätigkeiten sind jedoch auf die Unterstützung einer anregungsreichen, liebevollen und beschützenden Umwelt angewiesen. Dies ist die Aufgabe der frühkindlichen Betreuung. Sie umfasst die Einbindung in eine Gemeinschaft und die altersangemessene Pflege und Versorgung des Kindes, um seine elementaren physischen und psychischen Bedürfnisse zu stillen. Erziehung schließlich, die auf Bildung zielt und sich auf Betreuung abstützt, meint die bewusste Gestaltung der Umwelt des Kindes und die Interaktion mit ihm, um erwünschte Verhaltensweisen zu fördern und unerwünschte zu vermeiden oder zu korrigieren.
Frühkindliche Bildung und Betreuung gehören damit immer zusammen und bilden mit der Erziehung zusammen das Kürzel «FBBE». Dass für die vorliegende Publikation dieser Begriff gewählt worden ist, hat seinen Grund in der internationalen Gepflogenheit, von «Early Education» zu sprechen. In der internationalen Perspektive umfasst «Education» traditionellerweise sowohl Bildung als auch Betreuung und Erziehung. In der Vergangenheit ist zwar verschiedentlich versucht worden, andere Begriffe zu finden. So verweist Hayes (2007) auf die Wortschöpfung «educare», mit der versucht wurde, eine Balance zwischen den beiden Begriffen herzustellen und einen Zugang zu Bildung zu beschreiben, der eine entwicklungsangemessene Mischung von Betreuung («care») und Bildung («education»), von Stimulation und Pflege, offeriert. Obwohl sich der Begriff bis heute nicht durchgesetzt hat, zeigt er zumindest, wie «care», also Betreuung, rekonzeptualisierbar wird, sodass sie gleichwohl mit Bildung in die frühkindlichen Prozesspraktiken eingeordnet werden kann.
Die Elemente von FBBE zusammenzudenken, ist jedoch nur die eine herausfordernde Seite der Medaille. Die andere Seite liegt darin, sie auch strukturell-organisatorisch zusammenzubringen. Diese Forderung formuliert die OECD in ihrem Bericht Starting Strong II von 2006, der von einem einheitlichen Vorschulraum ausgeht, in dem Betreuungs- und Bildungsfunktion miteinander verzahnt sind. Trotz solcher Forderungen ist der Gedanke einer «Bildung von Anfang an» in allen deutschsprachigen Ländern noch nicht selbstverständlich. Spezifisch für die Schweiz liegt die große Herausforderung darin, dass die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) sowie die Sozial- und Gesundheitsdirektoren (SODK) die Aufgliederung der beiden Bereiche festgeschrieben haben: So soll die SODK zukünftig die Zuständigkeiten für den Frühbereich (null bis vier, fünf Jahre), der traditionell betreuende, sozial-karitative Züge trägt, übernehmen und die EDK die Verantwortung für die obligatorische Schule, die den Bildungsauftrag schlechthin verkörpert.
Diese Publikation verfolgt zwei Anliegen: Erstens will sie eine umfassende und interdisziplinäre Synthese von Theorie, Forschung und Praxis für die Ausbildung von Studierenden im FBBE-Bereich liefern. Da dieser Bereich im deutschsprachigen Europa erst seit relativ kurzer Zeit beforscht wird und wir zu großen Teilen auf die Erfahrungen anderer Länder angewiesen sind, stützt sich die Publikation auch auf angloamerikanische Erkenntnisse. Grundlage bilden jedoch die deutschsprachigen Forschungsbefunde und die in den letzten Jahren publizierte Fachliteratur (beispielsweise Fried & Roux, 2006; Thole et al., 2008; Stamm & Edelmann, 2010). Zweitens möchte die Publikation einen Beitrag zur Entideologisierung der aktuellen bildungspolitischen Diskussion liefern. Deshalb versucht sie Brücken zwischen Forschung und Praxis zu bauen und wissenschaftliche Befunde in verständliches Praxiswissen zu transferieren. Damit bekommt die Leserschaft ein Instrument in die Hand, das ihr nicht nur Wissen vermittelt, sondern sie auch anregt, sich mit den aktuellen und den zu erwartenden Diskursen auseinanderzusetzen und sich dabei ein eigenes Urteil zu bilden. Dieses Ziel ist jedoch eine große Herausforderung, sind doch viele Ergebnisse der frühkindlichen Bildungsforschung keineswegs so klar, wie sie allenthalben dargestellt werden.
Die Publikation, welche vier Schwerpunkte und 13 Kapitel umfasst, richtet sich an alle, die im FBBE-Bereich tätig sind oder planen, in ihm tätig zu werden: an Studierende an Fachhochschulen, Universitäten und höheren Fachschulen, an frühpädagogisches Fachpersonal, an Eltern und an bildungs- und sozialpolitisch Tätige sowie an interessierte Laien. Der erste Schwerpunkt behandelt in den Kapiteln 1 bis 5 die Grundlagen. Dabei geht es sowohl um die Begrifflichkeiten als auch um eine internationale Bestandsaufnahme und um die drei fundamentalen Themen der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung zwischen null und sechs Jahren, um individuelle und kulturelle Unterschiede zwischen den Kindern sowie um die Familie, ihre Rolle und die Bedeutung der familienexternen Kinderbetreuung. Der zweite Schwerpunkt widmet sich den Vorschulangeboten und ihrer Qualität. Im Mittelpunkt stehen das Was und Wie der FBBE, deren Qualität und Standards sowie die Professionalität des Personals (Kapitel 6 bis 8). Der dritte Schwerpunkt fragt nach der Wirksamkeit von FBBE. Untersucht werden ihre Auswirkungen auf den Schulerfolg und die Frage nach ihrem volkswirtschaftlichen Nutzen (Kapitel 9 und 10). Im vierten Schwerpunkt werden die wichtigsten aktuellen Diskurse unter die Lupe genommen: die Dichotomie zwischen Bildung und Betreuung, die Auseinandersetzung mit der Frage, ob frühere und intensivere FBBE-Maßnahmen in jedem Fall besser sind, sowie die Diskussionen um die frühere Einschulung (Kapitel 11, 12 und 13).