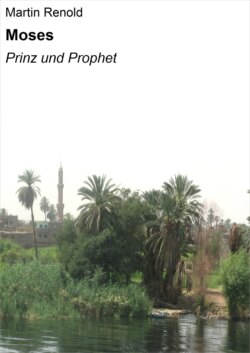Читать книгу Moses - Martin Renold - Страница 6
Im Königspalast
ОглавлениеJochebed und ihren beiden Kindern wurde ein Zimmer in jenem Teil des Palastes zugewiesen, wo vornehmlich die Dienerschaft der Königin und der Prinzessin untergebracht war.
Auch Mirjam und Aaron erhielten neue Kleider, in denen sie aussahen wie ägyptische Kinder. Ein Schreiber wurde dazu ausersehen, den beiden die ägyptische Sprache beizubringen und sie im Lesen und Schreiben der ägyptischen Schrift und im Rechnen zu unterrichten. Es sollte ihnen an nichts fehlen.
Mirjam freute sich darauf. Sie wollte viel lernen. Dass sie im Königspalast leben durfte, gefiel ihr. Sie fühlte sich wie eine kleine Prinzessin. Von Aarons Gesicht hingegen konnte man einen leisen Missmut ablesen. Er dachte an seine Spielkameraden, mit denen er nun nicht mehr in der Siedlung würde herumtollen können. Die Mauern des Palastes kamen ihm vor wie ein Gefängnis. Und die Menschen gingen so still und würdevoll durch die Gänge, dass einem fast angst wurde. Und alles war so sauber. Man konnte die Sauberkeit beinahe riechen. Bei ihm zu Hause roch es so angenehm nach Erde und Schafdung.
Mirjam, die bereits von ihren Eltern viele ägyptische Wörter kannte und sich ganz ordentlich, wie vorhin am Strand mit Henut-taui und May, unterhalten konnte, lernte die Sprache rasch und schloss bald Freundschaft mit den Mädchen der Dienerinnen. Aaron hatte mehr Mühe. Da er noch so klein war, hatten seine Eltern ihn bisher nicht auf die Begegnung mit Ägyptern vorbereitet. Niemand ahnte ja, dass dies so bald und auf diese ungewöhnliche Weise geschehen würde. Aaron kannte nur seine Muttersprache, und es dauerte längere Zeit, bis er sich mit den Jungen im Palast einigermaßen verstehen konnte.
Jochebed verbrachte so viel Zeit wie nur möglich mit dem kleinen Moses. Er verlangte oft mit lautem Schreien nach ihrer Brust. Das Glück, den Kleinen stillen zu dürfen und stets in seiner Nähe zu sein, überwog den Schmerz, ihn mit einer anderen Frau teilen zu müssen.
Natürlich blieb im Palast nicht verborgen, dass die Prinzessin ein Findelkind aufgenommen hatte und es als ihren Sohn betrachtete. Zuerst war die Königin aufmerksam geworden, als sie schon am Tag nach Moses’ Aufnahme im Palast am Zimmer ihrer Tochter vorbeigegangen war und das Schreien eines Kindes hörte. Sie war eingetreten und sah, wie Henut-taui ein Kind in den Armen hielt und gerade dabei war, es einer fremden Frau zu übergeben.
„Wer ist diese Frau?“, fragte sie.
Jochebed erschrak. Am Ton ihrer Frage erkannte sie blitzschnell, dass dies eine höher gestellte Dame sein musste oder gar die Königin selbst. Wie sonst hätte sie so mit der Prinzessin reden dürfen?
Jochebed warf sich auf den Boden, wie man es ihr gesagt hatte, dass dies so üblich sei, wenn man dem Pharao oder der Königin oder ihren Söhnen und Töchtern begegne.
„Sie ist die Amme“, sagte Henut-taui und gab Jochebed ein Zeichen aufzustehen.
Jochebed zögerte, bis die Königin zu ihr sagte:
„Steh auf!“
„Wie kommt das Kind hierher?“, fragte die Königin. „Ich erwarte eine Erklärung.“
Henut-taui schickte Jochebed mit dem Kind in ihr Zimmer, um es dort zu stillen. Dann begann sie zu erzählen, was geschehen war.
„Warum ist die Amme keine Ägypterin?“, fragte die Mutter, die trotz des ägyptischen Gewandes, das Jochebed nun trug, erkannte, dass sie eine Hebräerin war.
Auch dies berichtete Henut-taui freimütig, wie Mirjam ihrer Freundin May begegnet war, als diese das Kind gefunden hatte, und wie das Mädchen ihre Mutter als Amme empfohlen hatte. Sie erwähnte jedoch nichts von ihrem Verdacht, dass Jochebed die leibliche Mutter von Moses sein könnte.
„Es wäre besser gewesen, du hättest eine ägyptische Amme genommen. Dann hätten wir eine Familie suchen können, die das Kind aufnimmt“, sagte die Königin.
„Das möchte ich nicht. Ich hab den kleinen Moses schon so lieb gewonnen. Ich möchte ihn aufziehen wie einen eigenen Sohn“, antwortete die Prinzessin.
Und dann fügte sie schüchtern bei: „Ich vermute, es ist ein hebräisches Kind.“
„Du meine Güte“, stieß die Königin hervor, „auch das noch. Du hättest zuerst mich fragen sollen. Weißt du nicht, dass die Hebräer von niedrigstem Stande sind und dass sie von uns verachtet werden. Das Volk sieht in ihnen eine Plage, und dein Vater glaubt, dass sie eine Gefahr für uns sind und sich gegen uns verschwören.“
„Es ist doch ein unschuldiges Kind“, antwortete Henut-taui. „Ich möchte es behalten. Leg doch ein gutes Wort bei meinem Vater ein. Er hat mir noch nie einen Wunsch ausgeschlagen. Ich bitte dich!“
Die Königin versprach’s, wenn auch ungern. Dann aber fügte sie noch bei: „Sag deinem Vater nichts von dem Verdacht. Er würde es dir nie gestatten, ein hebräisches Kind anzunehmen.“
Henut-taui wusste nichts von dem Befehl ihres Vaters, dass alle neugeborenen hebräischen Knaben getötet werden sollten. Ramses, wohl ahnend, dass der Befehl, wenn er an die Öffentlichkeit käme, nicht nur bei den Hebräern und auch manchen recht denkenden Ägyptern missbilligend aufgenommen würde oder gar Unruhe auslösen könnte, hatte absolute Geheimhaltung verlangt. Selbst Satre, seiner Gemahlin, und seiner Tochter hatte er nichts davon gesagt. Dass Henut-taui ihren Verdacht verschweigen sollte, hatte damit zu tun, dass die Hebräer in Ägypten als minderwertige Menschen angesehen wurden und allein das schon für ihren Vater ein Grund gewesen wäre, den kleinen Moses aus dem Königspalast wegzuschaffen. Hätte Henut-taui von dem grausamen Befehl gewusst, so hätte sich ihre kindliche Seele gesträubt, und ein schwarzer Schatten wäre auf die Liebe zu ihrem Vater gefallen. So aber blieb auch die Liebe zu dem Neugeborenen rein und unbelastet durch den Trotz, der unweigerlich in ihr aufgekommen wäre. Denn nie hätte sie davon gelassen, Moses als ihr Kind anzunehmen, und sie hätte in ständiger Angst vor der Entdeckung seiner wahren Herkunft leben müssen.
Als Ramses in der Residenz seine Geschäfte beendet hatte und am Abend auf dem königlichen Wagen und eskortiert von den Leibwächtern in den Palast zurückgekehrt war, erzählte die Königin ihrem Gemahl die Geschichte von Moses und ihrer Tochter.
Ramses, der seiner Tochter wirklich nie einen Wunsch abschlagen konnte, war einverstanden, dass sie das Kind behalte.
Am Abend, als eine Dienerin der Prinzessin mitteilte, das Essen sei bereit, wusste Henut-taui noch nichts von ihrem Glück. Der Pharao hatte sich vorbehalten, es seiner Tochter selber zu sagen.
Das Abendessen wurde in einem kleineren Saal eingenommen. Am großen Tisch saß Ramses mit Satre, der Großen Königsgemahlin, zu seiner Rechten. An seiner linken Seite saß Seti und neben ihm Tuja. Auf der Seite ihrer Mutter hatte Henut-taui ihren Platz. Am unteren Ende des Tisches saßen die beiden Knaben Meriamun und Ramses.
Die Wände des Speisesaales waren bemalt mit Szenen von königlichen Gastmählern, bei denen der Pharao und seine Gemahlin mit ihren Gästen von eilfertigen Dienern bewirtet wurden. Auf den Tellern, die sie darreichten, sah man gebratene Enten oder die verschiedensten Früchte. Aus Krügen wurde köstliche Tranksame ausgeschenkt. Wer nicht schon Hunger hatte, musste spätestens beim Anblick dieser Bilder Appetit bekommen.
Henut-taui schaute ihre Mutter verstohlen an. Am liebsten hätte sie gleich gefragt, ob sie mit Vater gesprochen und ob dieser die Einwilligung gegeben habe. Die Mutter verstand ihren fragenden Blick und antwortete mit einem kaum merklichen Kopfnicken. Da leuchteten die Augen der Prinzessin auf.
Doch ehe Henut-taui etwas sagen konnte, richtete der Pharao sein strenges Wort an sie:
„Meine Tochter, ich habe gehört, was du hinter meinem Rücken getan hast.“
Es klang nicht gerade freundlich. Doch sie kannte ihren Vater, und der Blick der Mutter hatte ihr Sicherheit gegeben.
„Warum hast du mir nichts gesagt? Bin ich nicht der Pharao, der alles wissen muss, was in seinem Haus geschieht?“, sagte er und rückte auf dem Stuhl in Pose.
„Aber ich bin ein gütiger König und ein noch gütigerer Vater“, fuhr er fort, ohne eine Antwort abzuwarten. „Ich vergebe dir.“
Und er lachte seine Tochter freundlich an.
„Mein lieber Vater“, rief sie, „ich danke dir!“
Und sie sprang auf von ihrem Stuhl und trat hinter den Vater, schlang ihre Arme um seinen Hals, beugte sich über ihn und küsste ihn auf die Wange.
„Gibt es da etwas, von dem ich nichts weiß?“, fragte Seti ein wenig vorwurfsvoll und schaute von seiner Schwester zur Mutter und schließlich zum Vater.
„Deine Schwester ist Mutter geworden“, antwortete Ramses mit einem schelmischen Lachen um Mund und Augen.
Seti konnte sich nicht vorstellen, was das zu bedeuten hatte. Auf jeden Fall, wenn Vater einen solchen Ton aufsetzte, konnte es nicht das sein, was man sich normalerweise vorstellen müsste. Schließlich hatte er auch nicht bemerkt, dass seine Schwester schwanger gewesen wäre. Und von einem Mann wusste er auch nichts. Er schüttelte den Kopf und hob die Schultern hoch, ein Zeichen, das nach einer aufklärenden Antwort verlangte.
Auch Tuja machte ein garstiges Gesicht. Ihre Stirn über den Nasenflügeln hatte sich in dunkle Falten gelegt. Wie sollte sie das verstehen? Schließlich war sie wieder schwanger und nicht ihre kleine Schwägerin. Erlaubte sich Ramses etwa auf ihre Kosten einen üblen Scherz?
Satre bemerkte rasch die Verwunderung ihres Sohnes und die Ratlosigkeit ihrer Schwiegertochter und weihte beide in das Geheimnis der Prinzessin ein.
Vater und Sohn konnten nun kaum warten, bis das Essen vorüber war. Sie wollten den Knaben aus dem Schilf unbedingt sehen. Nur Tuja verspürte keine Lust dazu.
Trotzdem eilten denn alle, auch Tuja und ihre zwei kleinen Söhne, zum Zimmer der Prinzessin, während die Diener die Tafel abtrugen.
Jochebed, die gerade ihren Sohn stillte, war überrascht. Mit dem Kind an der Brust konnte sie sich natürlich nicht vor dem König und seiner Familie auf den Boden werfen.
Mit einem Handzeichen bat Ramses sie, sitzen zu bleiben.
Der kleine Moses war anscheinend nicht gerade erfreut, mitten im Trinken gestört zu werden. Jochebed hatte ihm beim nächsten tiefen Atemzug ihre Brust verwehrt, so dass er zu weinen begann. Doch nachdem Jochebed ihn in die Arme der Prinzessin gelegt hatte, beruhigte er sich. Alle standen um die Prinzessin herum, und der Pharao bewunderte das hübsche Kind.
„Jetzt habe ich einen dritten Enkel“, lachte er.
Tuja verzog ihr Gesicht zu einer verächtlichen Grimasse, und Seti blickte wie versteinert vor sich hin.
Enkel?, dachte er. Das ist doch kein Enkel, kein Königskind wie er und seine Kinder. Ein kleiner Bastard ist das. Wer weiß, wer seine Eltern sind!? Armes Pack, das seinen Sohn nicht zu ernähren und aufzuziehen vermag.
Und Tuja dachte: Ramses hat seine Tochter schon immer lieber gemocht als mich. Jetzt wird er auch noch diesen Balg meinen Söhnen vorziehen.
Und brüsk wandte sie sich ab und verließ das Zimmer. Seti folgte ihr mit raschen Schritten.
Nachdem die anderen königlichen Besucher das Zimmer der Prinzessin verlassen hatten, nahm Ramses seine Gattin beiseite und sagte leise zu ihr:
„Die Amme ist doch keine Ägypterin.“
„Es war gerade keine andere zur Stelle“, antwortete sie. Es war ja keine Lüge.
Der König gab sich damit zufrieden.
Einige Tage später wanderten ein Dutzend Arbeiter vom Steinbruch am Fuße der Berge zu ihren Heimstätten. Unter ihnen, die für zwei freie Tage zu ihren Angehörigen zurückkehren durften, befand sich auch Amram. Er freute sich, seine Frau und die beiden Kinder wieder zu sehen. Vielleicht war die Familie während seiner Abwesenheit sogar angewachsen. Seit den letzten freien Tagen hatte er immer daran gedacht. Denn als er seine Gattin zum letzten Mal verlassen hatte, war sie hoch schwanger gewesen. Es könnte also gut sein, dass die Geburt in diese Zeit fiel.
Als er sich nach und nach von allen seinen Kollegen verabschiedet hatte und er sich allein seiner Hütte näherte, beschleunigte er die Schritte. Er war voll ungeduldiger Erwartung und glaubte einmal sogar, bereits das Schreien eines Kleinkindes vernommen zu haben. Doch er hatte sich getäuscht. Es musste ein Schaf gewesen sein.
Er wunderte sich, dass keines der Kinder vor dem Haus zu sehen war. Es war auch alles ungewohnt ruhig. Er trat durch die Tür und fand die Hütte leer vor. Er ging durch den vorderen Raum und trat in das kleine Zimmer, wo er sonst mit seiner Frau schlief. Auch hier war niemand.
Wäre Jochebed nicht in Erwartung eines Kindes gewesen, wäre er nicht in Sorge geraten. Seine Frau wusste ja nie genau, wann er kam, und so konnte es schon einmal vorkommen, dass sie mit den Kindern für kurze Zeit zu einer Bekannten in der Nachbarschaft ging. Aber jetzt war er doch beunruhigt.
Die Nachbarin hatte gesehen, dass er gekommen war. Nun stand sie unter der Tür und klopfte an den Pfosten.
„Amram“, sagte sie, „deine Frau ist nicht da.“
„Das seh’ ich“, antwortete er, „wo ist sie? Ist etwas geschehen?“
„Es tut mir Leid, aber ich muss es dir sagen. Deine Frau hat ein totes Kind zur Welt gebracht. Jetzt ist sie im Palast. Eine Hofdame hat ein Kind, das sie nicht selber stillen kann. Da hat man Jochebed als Amme holen lassen.“
Es kam Amram äußerst seltsam vor, dass seine Frau als Amme in den Palast bestellt wurde. Eine Amme aus dem Volk Israels im Palast des Pharaos? Das war doch unmöglich!
„Und die Kinder“, fragte er, „wo sind sie?“
„Sie hat sie mitgenommen“, antwortete die Nachbarin. „Du kannst auch hingehen und dort wohnen, wenn du willst, hat sie gesagt.“
Nein, in den Palast wollte er nicht gehen. Und schon auf keinen Fall dort wohnen. Nie würde er einen solchen Verrat an seinem Volk begehen. Zwar wusste er noch nichts von dem Befehl des Pharaos, dass alle neugeborenen Knaben erwürgt werden sollten. Aber die Feindschaft, die dem Volk Israels seit längerer Zeit von den Ägyptern entgegengebracht wurde, war so groß geworden, dass er nichts mit ihren Herrschern zu tun haben wollte. Nein, auch wenn er im Palast als Diener eine leichtere Arbeit bekommen würde, da wollte er doch lieber im Steinbruch arbeiten.
Zum Glück schickte gerade in diesen Tagen Jochebed ihre Tochter, sie solle doch einmal nachsehen, ob der Vater inzwischen zurückgekehrt sei.
Amram war draußen und wollte gerade wieder in die Hütte verschwinden. Da sah er von weitem ein Mädchen herankommen.
Er hatte nur rasch hingeschaut. Dann hatte er den Blick wieder abgewandt. Doch unter der Tür besann er sich anders. Er zögerte. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. Er blieb stehen. Da stimmte doch etwas nicht. War das nicht eine Ägypterin, die daherkam? Was hatte die hier zu suchen? Er drehte sich um und trat wieder ein paar Schritte vor die Tür.
Das Mädchen war noch zu weit entfernt, als dass er sie hätte erkennen können. Er wartete, bis das Mädchen näher kam. Als sie nahe genug war, traute er seinen Augen kaum. Das war doch seine Tochter, gekleidet wie ein ägyptisches Mädchen.
„Herr, vergib mir und den Meinen“, flüsterte er vor sich hin. „Sieh ihre Sünde nicht an! Sie wissen nicht, was sie tun.“
Er musste sich beherrschen, um seine Tochter nicht barsch anzufahren. Er grüßte sie und zog sie väterlich an seine Brust. Doch als Mirjam ihm erzählte, dass der Pharao den Hebammen befohlen habe, alle männlichen Neugeborenen zu töten, da brauste er auf, und es dauerte eine geraume Zeit, bis er sich beruhigt hatte und Mirjam in ihrer Erzählung fortfahren konnte. Sie schilderte ihm das Leben, das sie im Palast führten, dass sie einen Lehrer hätten und mit den Kindern der Diener und Dienerinnen spielen und mit ihnen an reich gedeckten Tischen essen würden.
Einerseits tat es Amram weh zu hören, was seine Kinder alles hatten, was er ihnen selber nicht bieten konnte, andererseits mochte er ihnen das schöne Leben gönnen und war froh, dass sie gut erzogen wurden und etwas lernen konnten. Es waren zwiespältige Gefühle in seiner Brust. Er wusste auch nicht, ob er sich darüber freuen sollte, dass sein Sohn noch am Leben war. Ihm wäre eigentlich lieber gewesen, er wäre tot als lebend im Palast des Pharaos.
„Wie geht es dir?“, fragte Mirjam.
„Ihr braucht euch keine Sorgen um mich zu machen“, antwortete er. „Ich bin ja ohnehin meistens nicht daheim. Und wenn, dann werde ich schon zurechtkommen.“
In seinen widerstreitenden Gefühlen, fielen ihm keine anderen Worte ein, als solche, die Mirjam mit Erschrecken und Angst in sich aufnahm:
„Geh zurück zu deiner Mutter und zu ihrer Prinzessin. Sage ihr, dass ich nie und nimmer meinen Fuß in den königlichen Palast oder auch nur in seine Nähe setzen werde. Wenn die Zeit gekommen ist, da ihr, wie du sagst, zurückkehren dürft, will ich entscheiden, was weiter geschehen soll. Ich weiß nicht, wie ich das vor Gott und meinem Volk verantworten kann, euch wieder aufzunehmen, nachdem ihr uns diese Schmach angetan habt. Vielleicht gibt mir der Herr bis dann ein Zeichen.“
Tief betrübt ging Mirjam den Weg zurück. Wie nur sollte sie ihrer Mutter erklären, dass der Vater so zornig war und sie vielleicht verstoßen würde?
Doch Jochebed hatte es vorausgeahnt, und als Mirjam nur zögernd zu berichten begann, konnte ihr die Mutter leicht die richtigen Worte entlocken, die sie nicht mehr überraschten. Sie kannte ihren Mann zu gut, als dass sie etwas anderes erwartet hätte. Er würde sich schon wieder beruhigen, dachte sie.