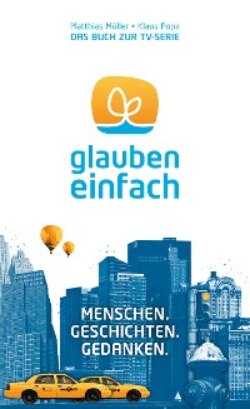Читать книгу glauben.einfach. - Matthias Müller - Страница 9
Оглавление04 WENN ES WEHTUT
Trost im Leid
KLAUS POPA
Wenn man sich als Kind wehgetan hat, ist man schnell in die Arme der Mutter gelaufen. Sie nahm uns auf den Arm und drückte uns fest an sich. Sie legte die Hand auf die Stelle, die wehtat, und sagte: „Schau mal, das ist doch gar nicht so schlimm. Es wird alles wieder gut.“ Sie streichelte uns über das Gesicht, wischte die Tränen ab und der Schmerz war weg.
Leid ist allgegenwärtig
Leid ist in unserer Welt allgegenwärtig. Wir alle kennen die Geschichten, Schlagzeilen und Bilder des Leides und der Trauer. Berichte von Kriegen füllen die Geschichtsbücher in der Schule. Manche haben selbst Krieg erlebt, Andere befinden sich momentan in Kriegsgebieten. Schreckensnachrichten und Katastrophenmeldungen hören und sehen wir täglich im Radio und im Fernsehen. In Werbeschreiben werden Hunger und Elend dargestellt, damit wir mit unseren Spenden die Not auf der Welt lindern. Leid begegnet uns auf den Straßen unserer Städte, es belastet unsere Familien, und nicht zuletzt hat wohl jeder von uns bereits einiges Leid erfahren.
Natürlich hat nicht jeder Schreckliches erlebt oder tiefste Not erfahren. Das ist auch gut so. Vieles kennen wir nur aus den Medien oder von Erzählungen der Großeltern – manchmal sprachen sie darüber, wie es damals im Zweiten Weltkrieg oder zur Zeit des Kommunismus war. Insgesamt gesehen jedoch macht es nicht wirklich einen Unterschied, wer das Leid erlebt hat. Denn das Leid bleibt.
Leiden an Nichtigkeiten
Oftmals leiden wir aber auch an Nichtigkeiten. Was ist schon ein Tsunami in Indonesien im Vergleich zu einem riesigen Pickel auf der Nase! Und als wäre ein großer Pickel nicht schlimm genug: Genau an dem Wochenende ist man zu einer Geburtstagsfeier eingeladen, zu der alle kommen werden – auch der Junge, den man so süß findet.
Das tägliche Drängen, Schubsen und Schwitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln und Zügen, dieses Eingepferchtsein und die verzweifelten Versuche, zur Tür zu kommen, wenn man aussteigen will; die Angst, ob man es schafft, bevor die Türen sich wieder schließen – ist das nicht belastender und beängstigender, als in einem Kohlebergwerk verschüttet zu sein und nicht zu wissen, ob man lebend wieder herauskommen wird? Schließlich machen wir das Tag für Tag durch und nicht nur einmal im Leben.
In der Tat, es sind oft Nichtigkeiten – eigentlich nicht der Rede wert –, aber dennoch leiden wir an ihnen. Und sich der Tatsache bewusst zu werden, dass es Nichtigkeiten sind, macht es nicht leichter, sondern nur noch schlimmer. Es wird uns offenbar, wie belanglos viele unserer Sorgen und Leiden sind, verglichen mit den existenziellen und lebensbedrohlichen Nöten anderer Menschen.
Gleichzeitig wird uns aber auch bewusst, wie zerbrechlich und angreifbar wir sind und wie gering unsere Leidensfähigkeit ist. Es ist doch nicht normal, dass wir uns bereits überfordert fühlen, wenn im Supermarkt unser Lieblingsduschgel gerade ausverkauft ist und wir uns deswegen für eine andere Duftnote entscheiden müssen. Warum sind wir eigentlich so? Und wie sind wir so geworden?, frage ich mich manchmal.
Verwöhnt und verweichlicht
Demaskiert und bloßgestellt leben wir mit einer kontinuierlichen Anklage: Wie kannst du eigentlich angesichts des ganzen echten und wirklichen Leides auf der Welt so empfinden und dich so verhalten? Wie verwöhnt und verweichlicht bist du eigentlich? Dieses unterschwellige Dauer-schlechte-Gewissen unterhöhlt unsere innere Stabilität und erodiert unsere Zufriedenheit.
Zu alledem kommt noch die Unfähigkeit, sich über das, worüber wir uns freuen könnten, auch wirklich zu freuen. Denn wir wissen, dass wir mit unserer Art zu leben, Kakaobauern in Kuba ausbeuten, Kinder in Indien 12 Stunden pro Tag arbeiten lassen, Meere leer fischen und verseuchen, Hühner quälen, Weihnachtsgänse vollstopfen, zu viel Erdöl verbrauchen und so weiter und so fort. Und das Gefühl der Unfähigkeit, etwas ändern zu können, macht es wiederum nicht leichter, sondern noch schlimmer. Wir leiden nicht die Leiden unserer Väter oder Großväter und Großmütter, aber auch wir leiden.
Die Mutter tröstet ihr Kind
Kürzlich habe ich ein Kind dabei beobachtet, wie es das Fahrradfahren erlernte. Nach mehreren Versuchen ließ die Mutter das Fahrrad los und das Kind fuhr zum ersten Mal allein. Nach ein paar Metern drehte es sich aber plötzlich nach der Mutter um, verlor die Kontrolle und fiel hin. Das Kind stand auf, die Hände aufgeschürft und die Hosenbeine voller grün-brauner Flecken. Es schaute sich nach allen Richtungen um und lief dann in die Arme seiner Mutter. Es tat dem Kind sichtlich gut, dass seine Mutter da war. Sie tröstete es, nahm ihm seine Angst und fing es in seiner Verunsicherung auf. Sie linderte seinen Schmerz und half ihm, die Situation durchzustehen. Bald darauf zog der Kleine glücklich und stolz mit dem Fahrrad seine Runden durch den Park.
In wessen Arme laufen wir?
Wenn man sich als Erwachsener wehtut, in wessen Arme läuft man dann? Wenn man den Studienplatz, die Praktikumsstelle oder den Job nicht bekommt, wenn man durch die Zwischenprüfung oder das Examen gefallen ist, wenn eine gute Freundschaft oder langjährige Beziehung zerbricht – in wessen Arme läuft man dann? Wenn man arbeitslos wird und die Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, wenn Angstzustände oder Depressionen einen in dunkle Tiefen ziehen, läuft man als Erwachsener dann in die eigenen Arme?
Freunde, Familienmitglieder und Lebenspartner helfen und trösten uns. Wie gut, dass Menschen da sind, denen man vertrauen kann und die einen lieben; doch auch sie haben ihre Grenzen. Es gibt Nöte, Ängste, Schmerzen und Einsamkeit, die auch sie nicht auffangen können. Doch wohin sollen wir uns dann wenden? Zu wem gehen wir? Uns selbst Mut und Kraft zusprechen? Sich selbst umarmen?
Wenn wir uns als Menschen oder als Menschheit insgesamt wehtun – wenn politische Unruhen und Umwälzungen uns bedrohen, Kriege uns zerstören, globale Finanzkrisen uns das Vermögen rauben, Rohstoffe knapp werden und die Umweltzerstörung und Umweltkatastrophen zunehmen -, in wessen Arme laufen wir dann? Wer ist für uns da? Wer tröstet uns und nimmt uns unsere Angst oder Unsicherheit? Es ist ratsam und notwendig, dass wir uns als Menschheitsfamilie daran erinnern und darauf besinnen, dass wir zusammenhalten und zusammenarbeiten müssen, um die globalen Probleme und Herausforderungen zu meistern. Das ist gut so, aber reicht das aus? Können wir es mit gemeinsamen, zielgerichteten und aufeinander abgestimmten Anstrengungen schaffen?
Drei magische Worte
Drei einfache, schlichte Worte elektrisierten im Herbst 2008 Menschen in den USA und weltweit. Sowohl in Penthousewohnungen in den Metropolen dieser Welt als auch in den Lehm- und Wellblechhütten der Entwicklungsländer (wie ich es in Afrika selbst erlebte) traf der Satz „Yes, we can!“ die Menschen mitten ins Herz. Wie ein Lebenselixier drangen diese Worte in den Kreislauf des blauen Planeten und schienen die Menschheit nach einem Jahrhundert der Kriege zu neuem Leben zu erwecken. War dies der Beginn einer neuen Ära für die bedrohte Menschheit?
Millionen glaubten, hofften und wünschten sich, dass diese drei Worte Wirklichkeit würden, dass sie mehr wären als nur der geniale Slogan des Präsidentschaftskandidaten Barack Obama, mehr als das Versprechen, dass das neue Persil die Wäsche jetzt noch weißer macht als zuvor. Wir hofften, dass dieses Versprechen nicht am Menschen, ja, am allzu Menschlichen – an uns – scheitern würde. Wir wünschten uns, dass dieser Satz nicht nur ein Versprechen, sondern eine Vorhersage wäre, eine vorweggenommene Erfüllung unserer Sehnsucht, dass die Welt wirklich ein besserer Ort werden könnte und würde. Gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Können wir wieder an uns glauben?, schienen sich viele zu fragen. Werden wir Menschen letztlich doch noch über uns hinauswachsen? Kann sich das Gute doch noch durchsetzen?
Eine vergebliche Hoffnung
Vielleicht hofften wir, dass unsere Generation – du und ich – nicht dazu verdammt ist, die Fehler unserer Vorväter zu wiederholen, sondern dass es den Menschen doch noch gelingt, das Gute zu vollbringen. Vielleicht hofften wir, dass wir doch nicht das sind, was wir insgeheim längst ahnten bzw. wussten – nämlich eine Bedrohung für uns selbst, für andere und für diese Welt.
Haben wir uns in die „Arme“ dieses Satzes fallen lassen? Oder in die Arme eines einzelnen Mannes? Ein postmoderner Messias, auf den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt haben?
Nein, so kann man das doch nicht sagen. Weißt du nicht, dass nur Kinder in die Arme ihrer Mutter laufen? Erwachsene machen so etwas nicht. Wir brauchen das nicht. Wir kriegen es selbst hin – ja, wir müssen es selbst hinbekommen. Denn wenn nicht der Mensch, wer soll es sonst machen?
Es ist ja niemand da. Seitdem der moderne Mensch Gott an den Rand des Universums verbannt und sich selbst ins Zentrum gestellt hat, ist außer ihm niemand da. Der Mensch wurde Anfang, Mittelpunkt und Ziel aller Bemühungen und Hoffnungen.
Hat Barack Obama es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben sich die Dinge, seitdem das Zeitalter des modernen Menschen angebrochen ist, entscheidend verbessert? Hat der Mensch die Welt zu einem besseren und sicheren Ort gemacht? Es wäre so schön, wenn es uns gelungen wäre; aber ich glaube, dass nach Jahrhunderten die Frage immer noch im Raum steht: Wer hilft uns da hindurch?
Der Mensch kann es nicht
Aus christlicher Perspektive betrachtet, ist der Slogan „Yes, we can!“ nicht nur eine Selbstüberschätzung des modernen Menschen, sondern er erinnert uns auch an eine längst verlorengegangene Würde. Nach seiner Erschaffung vertraute Gott dem Menschen die Verantwortung für die Erde an. Denn ursprünglich wurde der Mensch so geschaffen, dass er es konnte. Er sollte sich „die Erde … untertan“ machen, sie „bebauen“ und „bewahren“ (1. Buch Mose 1,28; 2,15). Die Erde hätte also ein guter Ort bleiben können.
Aufgrund der Trennung von Gott kam jedoch alles ganz anders. Das erste Menschenpaar musste den Garten Eden verlassen (siehe 1. Buch Mose 3; mehr dazu in Kap. 11). Beschämt, bedroht und verängstigt lebte es mit seinen Nachkommen von da an in einer Welt, in der nicht nur das Gute, sondern auch das Böse eine Realität war. Der Mensch hatte sich in eine Lage gebracht, aus der er bis heute nicht mehr allein herauskommt. Menschliche Anstrengungen, Fähigkeiten und unser Wissen haben uns leider kein goldenes Zeitalter des Friedens gebracht und werden uns auch keines bringen. Seit jeher sind menschliche Utopien gescheitert. Der Mensch kann es nicht.
Gott kann es!
Eine Hoffnung hatte Gott den Menschen mit auf ihren Weg gegeben: Eines Tages würde einer ihrer Nachkommen dem Elend ein Ende setzen. Einer würde das Böse und den Tod besiegen. Die Sehnsucht der Zeitalter war seit jeher der Eine, der die Menschheit aus ihrem Dilemma herausholen würde. Der Mensch wird auf der neuen Erde wieder seine ursprüngliche Würde erhalten. Dann wird der Slogan wieder stimmen: „Yes, we can“.
Der moderne Mensch hat Gott aus den Augen verloren. Aber wir sind an einem Punkt der Weltgeschichte angelangt, an dem es höchste Zeit ist, sich wieder an Gott zu wenden.
Die Menschheit braucht tatsächlich einen Messias – den wahrhaftigen Messias, Jesus von Nazareth, der die Menschen einlädt: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben.“ (Matthäusevangelium 11,28 Hfa)
Fragen zum Nachdenken
1. „Oftmals leiden wir an Nichtigkeiten.“
Neige ich auch dazu? Was hilft mir, zwischen Nichtigem und Ernstzunehmendem zu unterscheiden?
2. „Der Mensch hat Gott an den Rand des Universums verbannt und sich selbst ins Zentrum gestellt.“ Trifft das auch auf mich zu? In welchen Bereichen?
Zur Vertiefung
Larry Yeagley: Trauer durchschreiten – zum Leben zurückfinden, Deutscher Verein für Gesundheitspflege, Ostfildern 2008, 128 Seiten, Best.-Nr. 6007602
Andreas Müller (Hrsg.): Leben und Sterben mit Gott. Gedanken zu Psalm 23, Deutscher Verein für Gesundheitspflege, Ostfildern 1997, 96 Seiten, Best.-Nr. 6006892
Bezugsquellen siehe S. 168 oder www.adventist-media.de