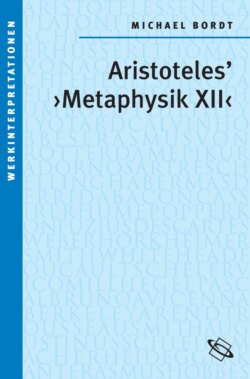Читать книгу Aristoteles'' "Metaphysik XII" - Michael Bordt - Страница 9
Kapitel 1 Das philosophische Projekt9
Оглавление1. Der Text
„(1.1) [1069a18] Über die ousia geht die theoretische Untersuchung (theōria); denn von den ousiai werden die Prinzipien (archē) und die Ursachen (aition) gesucht.
(1.2) [a19] (1.2.1) Denn sowohl wenn das All wie irgend etwas Ganzes ist, ist die ousia ein erster Teil, als auch wenn es in einer Abfolge vorliegt, ist in diesem Falle die ousia ein Erstes, darauf folgt das Wie-Beschaffen oder Wieviel. (1.2.2) [a21] Zudem sind diese nicht einmal als uneingeschränkt (haplōs) seiende Dinge anzusprechen, sondern als Qualitäten und Bewegungen, wie auch das Nicht-Weiße und das Nicht-Gerade; denn wir sagen ja doch auch von diesen, dass sie sind, z. B. ,es ist nicht weiß‘. (1.2.3) [a24] Ferner ist nichts von dem übrigen selbstständig abtrennbar (chōriston). (1.2.4) [a25] Auch legen die Alten durch die Tat Zeugnis dafür ab; denn von der ousia suchten sie Prinzipien, Elemente und Ursachen.
(1.3) [a26] Die jetzigen <Philosophen>10 nun setzen das Allgemeine in höherem Maße als ousia; denn die Gattungen, von denen sie sagen, dass sie in höherem Maße Prinzip und ousia sind, weil sie ihre Untersuchung vor allem begrifflich führen, sind etwas Allgemeines; die alten <Philosophen> hingegen setzten <in höherem Maße> die Einzeldinge <als ousia>, wie Feuer und Erde, aber nicht den allgemeinen Körper.
(1.4) [a30] Es gibt drei ousiai; (1.4.1) [a30] zunächst die sinnlich wahrnehmbare, die alle anerkennen, von der die eine vergänglich ist, wie die Pflanzen und die Lebewesen, die andere aber ewig ist. Von ihr müssen die Elemente gefunden werden, mögen es nun eines oder mehrere sein. Die andere ist die unbewegliche <ousia>, und von dieser behaupten einige, dass sie selbstständig abgetrennt ist, wobei die einen diese in zwei Bereiche scheiden, die anderen die Ideen und die mathematischen Dinge als eine einzige Natur setzen, und wiederum andere von diesen nur die mathematischen Dinge annehmen. (1.4.2) [a36] Jene <ousiai> gehören der Physik an, denn sie sind der Bewegung unterworfen, diese aber einer anderen Wissenschaft, falls sie mit jenen kein gemeinsames Prinzip hat.“
2. Überblick
Der erste Satz des Kapitels gibt das Thema des gesamten Traktats an: Der Traktat ist eine Untersuchung über die ousia. Wer nach der ousia fragt, der fragt danach, was die grundlegenden Bestandteile unserer Wirklichkeit sind. Eine Antwort auf diese Frage ist dabei unter den Philosophen nicht kontrovers: Die sinnlich wahrnehmbaren Einzeldinge wie konkrete Pflanzen, Menschen und Tiere werden von allen Philosophen als ousia anerkannt. Das bedeutet, dass alle Philosophen der Auffassung sind, dass wahrnehmbare Einzeldinge grundlegende Bestandteile der Wirklichkeit sind. Mit dieser Auffassung erübrigen sich keinesfalls alle weiteren Fragen über die Wirklichkeit. Im Gegenteil: Mit der Annahme der wahrnehmbaren ousia ist erst ein Ausgangspunkt erreicht, von dem aus man weitere Fragen nach der Konstitution der Wirklichkeit stellen kann. Es fragt sich nämlich, was die Prinzipien und Ursachen sind, von denen her wir diese wahrnehmbaren Einzeldinge verstehen können. Da diese Prinzipien und Ursachen die konkreten Einzeldinge konstituieren, konstituieren sie in einem grundsätzlicheren Sinn als die konkreten Einzeldinge die Wirklichkeit und sind selbst folglich ebenfalls ousiai (ousiai ist der Plural von ousia), und sogar in höherem Maße ousiai, als es die konkreten Einzeldinge sind.
Das erste Kapitel gliedert sich in zwei Teile (1.1)–(1.2) und (1.3)–(1.4). Der erste Teil klärt, was es heißt, nach der ousia zu fragen. In (1.1) stellt Aristoteles die Behauptung auf, dass eine Untersuchung der Konstitution der gesamten Wirklichkeit die ousia und die Prinzipien und Ursachen der ousia als ihr Objekt haben muss. Diese Behauptung wird in (1.2) in vier Punkten begründet. Erstens ist unabhängig davon, welche Auffassung man von der Wirklichkeit als Ganzer hat, die ousia immer das Erste dieser Wirklichkeit (1.2.1). Zweitens kommt nur der ousia ein uneingeschränktes Sein zu (1.2.2). Drittens ist nur die ousia selbstständig abtrennbar (1.2.3), und viertens macht auch ein Blick in die Geschichte der Philosophie deutlich, dass diejenigen Philosophen, die vor Aristoteles nach den Prinzipien und Ursachen der Wirklichkeit gefragt haben, nach der ousia gefragt haben, auch dann, wenn sie sich selbst nicht so ausgedrückt haben (1.2.4).
Im zweiten Teil diskutiert Aristoteles, was für Dingen der Status einer ousia zukommt. In (1.3) referiert Aristoteles dazu, welchen Dingen andere Philosophen den Status einer ousia zugesprochen haben. Die Platoniker, so erfahren wir, haben angenommen, dass die nicht wahrnehmbaren Gattungen in höherem Maße ousiai sind. Für sie hängt die Existenz eines konkreten Einzeldings von der Existenz einer Gattung oder mehrerer Gattungen ab. Die Philosophen vor Aristoteles haben angenommen, dass die Einzeldinge wie Feuer und Erde, d. h. die Elemente, die selbst Einzeldinge sind und die komplexeren Einzeldinge konstituieren, in höherem Maß der Status einer ousia zukommt. Aristoteles systematisiert die verschiedenen Antworten auf die Frage, was alles eines ousia ist, in (1.4). Erstens gibt es die sinnlich wahrnehmbare und vergängliche ousia, die die konkreten vergänglichen Einzeldinge umfasst, zweitens die wahrnehmbare und ewige ousia, die die Himmelskörper umfasst, und drittens die nicht wahrnehmbare ewige ousia, zu der die unterschiedlichen Philosophen verschiedene Auffassungen haben. Ob und wie diese drei Arten von ousia miteinander zusammenhängen, bleibt im ersten Kapitel offen; wir erfahren nur, dass wenn es kein gemeinsames Prinzip der wahrnehmbaren und der nicht wahrnehmbaren ousiai gibt, die wahrnehmbaren ousiai Gegenstand der Physik und die nicht wahrnehmbaren ousiai Gegenstand einer anderen Wissenschaft sind. Spätestens im achten Kapitel wird allerdings deutlich werden, dass und wie die drei Arten von ousiai miteinander zusammenhängen: Die ewigen wahrnehmbaren ousiai (die Himmelskörper also) sind Prinzip für die vergänglichen wahrnehmbaren ousiai, die nicht wahrnehmbaren ewigen ousiai sind sowohl Prinzip für die ewigen wahrnehmbaren als auch, vermittelt durch diese, für die vergänglichen wahrnehmbaren ousiai.
3. Interpretation11
(1.1) Die Untersuchung, die Aristoteles im Buch Lambda führt, wird von ihm im ersten Satz dieses Traktats als ,theōria‘ bezeichnet. Diese Wortwahl macht schon deutlich, worum es Aristoteles im Folgenden gehen wird. Unter einer theōria versteht Aristoteles nicht irgendeine Art von Untersuchung (beispielsweise eine ethische oder empirische Untersuchung), sondern eine bestimmte Form der theoretischen Untersuchung. Das Charakteristische für eine theōria ist, dass sie auf ein theoretisches Wissen letztlich um die Gesamtheit der Wirklichkeit und ihrer Prinzipien zielt.12
Diese theoretische Untersuchung hat als ihr Objekt die ousia. Zunächst ein paar Worte zum Wort ousia selbst. Wie unklar es ist, was eine ousia ist, zeigt sich schon an den verschiedenen Übersetzungen des Wortes. Rolfes übersetzt ,ousia‘ beispielsweise mit ,Substanz‘, Bonitz mit , Wesenheit‘, Seidl wechselt zwischen , Wesen‘ und ,Substanz‘ und Gadamer übersetzt ,ousia‘ mit ,Sein‘. Die Übersetzung des griechischen Wortes war bereits in der Antike ein Problem, als man das Griechische ins Lateinische übersetzt hat. Je nach Kontext übersetzten die Autoren ,ousia‘ entweder mit ,essentia‘ oder mit ,substantia‘. Manche Autoren kannten offenbar keinen sachlichen Unterschied zwischen essentia und substantia, andere Autoren übersetzten ,ousia‘, wenn es in einem logischen Kontext stand, mit ,substantia‘, und wenn das Wort in einem metaphysischen Kontext stand, mit ,essentia‘.13 Der grammatischen Form nach leitet sich ,ousia‘ vom Verb einai ab, das ,sein‘ bedeutet. Das Wort ousia besteht aus zwei Wortteilen, dem Partizip ,on‘, das ,seiend‘ bedeutet, und dem Suffix ,-ia‘, das das Partizip zu einem abstrakten Nomen macht. Das Wort ousia müsste also wörtlich mit ,Seiendheit‘ übersetzt werden. Diese Übersetzung ist aber viel zu abstrakt für das, was ,ousia‘ an vielen Stellen bezeichnet; in der griechischen Umgangssprache bedeutet ,ousia‘ beispielsweise so viel wie ,Besitz‘ oder , Vermögen‘, und damit ist vor allem der Grundbesitz eines griechischen Haushaltes gemeint. Platon ist, soweit wir wissen, der erste Grieche, der ,ousia‘ in einer philosophischen Bedeutung verwendet hat. Die ousia von einem Einzelding, z. B. von einem bestimmten Menschen, ist bei Platon u. a. das, was dieses Einzelding unabhängig von seinen wechselnden Eigenschaften eigentlich ist. Hier bietet es sich an, ,ousia‘ mit , Wesen‘ zu übersetzen. Ein bestimmter Mensch kann beispielsweise schwarze oder blonde Haare haben – diese Eigenschaften sind für das, was die ousia, also das Wesen dieses Menschen ausmacht, nicht von Bedeutung. Auch von den unveränderlichen Ideen sagt Platon an einigen Stellen seiner Dialoge, sie seien ousiai. Man kann vermuten, dass der alltagssprachliche und der philosophische Gebrauch von ,ousia‘ insofern zusammenhängen, als beide Gebrauchsweisen etwas über die Stabilität und die Verlässlichkeit sagen. Der Grundbesitz ist das, wovon ein Haushalt verlässlich lebt. Philosophisch ist die ousia das, was (umgangssprachlich gesprochen) der Kern einer Sache ist und was das Wesen einer bestimmten Sache ausmacht. Dieser Kern und das Wesen sind stabil und verändern sich nicht.
In der vorliegenden Übersetzung und im Kommentar bleibt ,ousia‘ unübersetzt. Der Grund dafür ist nicht, dass Festlegungen vermieden werden sollen, sondern dass eine Übersetzung eher dem Verständnis dessen, worum es der Sache nach geht, im Wege steht. Wir werden nämlich gleich sehen, dass für die Aristotelische Auffassung die Annahme charakteristisch ist, ein Prinzip einer ousia sei selbst eine ousia. Es gibt also die ousia einer ousia. Wenn wir ousia aber mit ,Substanz‘ oder mit , Wesen‘ übersetzen, lässt sich das Verhältnis zwischen dem Prinzip und dem, dessen Prinzip es ist, nicht mehr deutlich machen, denn wir können nicht sinnvoll von der Substanz einer Substanz oder dem Wesen eines Wesens sprechen.
Zurück zum Text! Der erste Satz von Lambda besteht aus zwei Teilsätzen und ist zunächst verwirrend. Im ersten Teilsatz kündigt uns Aristoteles an, seine theoretische Untersuchung sei eine Untersuchung über die ousia. Im zweiten Teilsatz heißt es demgegenüber, man suche die Prinzipien und Ursachen der ousiai. Was, so möchte man fragen, soll denn nun untersucht werden? Die ousia oder die Prinzipien und Ursachen der ousiai? Unklar ist ferner, wie wir die Begründung im zweiten Teilsatz verstehen sollen. Warum begründet die Tatsache, dass wir von den ousiai die Prinzipien und Ursachen suchen, die Behauptung, die theoretische Untersuchung sei eine Untersuchung der ousia?
Bei einer Antwort auf diese Fragen lassen sich drei Aspekte voneinander unterscheiden. Erstens bedeutet die Untersuchung einer bestimmten Sache für Aristoteles oft nichts anderes, als nach den Prinzipien und Ursachen dieser Sache zu fragen. Das gilt nicht nur für die theoretische Untersuchung in Lambda, sondern auch für viele andere Arten von Untersuchungen, selbst wenn Aristoteles auch andere Untersuchungsmethoden kennt. In der Physik und im zweiten und dritten Kapitel von Lambda untersucht Aristoteles beispielsweise die Dinge, die sich verändern. Diese Untersuchung besteht darin, eine Antwort auf die Frage zu finden, was für Prinzipien und Ursachen wir annehmen müssen, wenn wir Dinge, die sich verändern, und d. h. die Veränderung der Dinge, verstehen wollen. Es ist also nicht eine Sache, die ousia zu untersuchen, und eine ganz andere Sache, die Prinzipien und Ursachen der ousiai zu untersuchen. Die ousia zu untersuchen bedeutet vielmehr, die Prinzipien und Ursachen der ousia zu untersuchen. Es gibt gar keine andere sinnvolle Möglichkeit, die Untersuchung der ousia zu führen, als nach ihren Prinzipien und Ursachen zu fragen.
Zweitens ist eine Untersuchung der ousia noch in einem anderen Sinn eine Untersuchung der Prinzipien und Ursachen der ousia. Wenn eine ousia das ist, was unsere Wirklichkeit konstituiert, dann sind natürlich auch die Prinzipien und Ursachen der ousia etwas, das unsere Wirklichkeit konstituiert. Die Prinzipien und Ursachen einer ousia müssen also der Sache nach selbst ousiai sein.
Drittens muss man sich vergegenwärtigen, dass Aristoteles nicht der erste Philosoph ist, der eine theoretische Untersuchung der Prinzipien der gesamten Wirklichkeit führt. Eine theoretische Untersuchung der gesamten Wirklichkeit ist so alt wie die Philosophie selbst und zu dieser Untersuchung gehörte von Anfang an, dass nach den Prinzipien und Ursachen der gesamten Wirklichkeit gefragt wurde. Nun ist es aber nicht so, dass alle Philosophen, die nach der gesamten Wirklichkeit und ihren Prinzipien fragten, tatsächlich nach der ousia gefragt haben. Einige Vorsokratiker haben beispielsweise nach der Natur (gr. hē physis) oder nach dem Seienden (gr. to on) gefragt; Platon würde wohl darauf verweisen, dass wir, wenn wir die Prinzipien der gesamten Wirklichkeit untersuchen wollen, nach den Ideen fragen müssen. Aristoteles ist sich dessen bewusst [vgl. (1.2.4)]. An einer anderen Stelle in der Metaphysik erklärt er ausdrücklich, dass die Frage nach dem Seienden als Frage nach der ousia verstanden werden müsse.14 Es sind die ousia und deren Prinzipien und Ursachen, die die Objekte der theoretischen Untersuchung sein müssen.
(1.2) Wichtig für das Verständnis des gesamten zweiten Abschnittes ist die Tatsache, dass Aristoteles in (1.1) nicht lediglich das Thema der folgenden theoretischen Untersuchung angekündigt hat. Aristoteles hat vielmehr in dem ersten Satz vom Lambda behauptet, dass die theōria, d. h. eine theoretische Untersuchung der letzten Prinzipien der Wirklichkeit, als ihren Gegenstandsbereich tatsächlich die ousia hat und es folglich die Prinzipien und Ursachen der ousiai sind, die gefunden werden sollten. Aristoteles’ Behauptung bedarf einer Begründung, und diese Begründung wird im Folgenden mit dem ,denn‘ eingeleitet. Durch die Partikel ,zudem‘, ,ferner‘ und ,auch‘ zu Beginn von (1.2.2), (1.2.3) und (1.2.4) wird deutlich, dass das ,denn‘ nicht nur einen Zusammenhang zwischen (1.2.1) und (1.1) herstellen, sondern dass das ,denn‘ für alle vier folgenden Fälle (1.2.1)– (1.2.4) gelten soll. Die folgenden vier Punkte sollen also begründen, warum wir uns in der theōria mit der ousia beschäftigen und warum eine Untersuchung der ousia genau die Art von Untersuchung ist, die wir anstellen müssen, wenn wir über die Wirklichkeit als Ganze nachdenken wollen.
(1.2.1) Der erste Grund dafür, die ousia zu studieren, besteht darin, dass die ousia das Erste der Wirklichkeit ist, und wenn man wie Aristoteles die Prinzipien der gesamten Wirklichkeit untersuchen möchte, dann muss man natürlich vor allem untersuchen, was das Erste in der Wirklichkeit ist. Um diese Priorität der ousia zu erläutern, unterscheidet Aristoteles zwei Möglichkeiten voneinander, das All, d. h. die Gesamtheit der Wirklichkeit, zu konzipieren: Entweder ist das All so wie irgendetwas Ganzes, oder es liegt in einer Abfolge vor.
Selbst dann, wenn die genaue Bedeutung der Alternative zwischen dem Ganzen und der Abfolge noch unklar ist, lassen sich drei für die Untersuchung in Lambda wichtige Punkte festhalten. Erstens ist eine Untersuchung der ousia offensichtlich immer eingebettet in eine Untersuchung der gesamten Wirklichkeit. Eine Untersuchung über die ousia zu führen, bedeutet nicht lediglich Teilgebiete der Wirklichkeit in den Blick zu fassen, sondern in einer bestimmten Hinsicht die gesamte Wirklichkeit zu erforschen. Zweitens ist diese gesamte Wirklichkeit nicht unterschiedslos und gleichförmig. Wenn man die gesamte Wirklichkeit so wie ein Ganzes auffasst, dann hat dieses Ganze Teile, die voneinander unterschieden werden können. Wenn andererseits die gesamte Wirklichkeit eine Abfolge von verschiedenen Stufen oder Schichten der Realität ist, dann gibt es etwas, das an erster Stelle steht, etwas anderes, das an zweiter Stelle steht usw. Beide Alternativen, die Wirklichkeit zu beschreiben, gehen also davon aus, dass die gesamte Wirklichkeit strukturiert ist, auch wenn sie unterschiedliche Antworten auf die Frage geben, wie diese Struktur genauer beschrieben werden muss. Drittens ist deutlich, dass unabhängig davon, wie die Struktur zu bestimmen ist, die ousia in dieser Struktur stets den ersten Platz hat. Entweder ist die ousia der erste Teil eines Ganzen oder sie nimmt den ersten Platz in der Abfolge ein.
Welche Auffassung mit dem ersten Fall beschrieben wird, bei dem das All wie ein Ganzes aufgefasst wird, bleibt leider für uns Interpreten unklar. Einen interessanten Vorschlag zur Interpretation hat ein antiker Aristoteleskommentator, den man Pseudo-Alexander nennt,15 gemacht. Pseudo-Alexander weist darauf hin, dass Aristoteles nicht einfach sagt, dass das All ein Ganzes sei, sondern eher einen Vergleich anstellt: das All sei wie irgendetwas Ganzes und die Konstitution des Universums werde mit der Konstitution einer Ganzheit lediglich verglichen. Pseudo-Alexander verdeutlicht diesen Vergleich an einem eigenen Beispiel. Sokrates ist ein ganzer, aber Sokrates ist nicht nur Sokrates, er ist auch beispielsweise kahlköpfig, gebildet usw.16 Wenn wir diesen Sokrates als Ganzen und als Einheit sehen, dann ist klar, dass sein Sokratessein ein Teil dieses Ganzen ist, und zwar der primäre Teil des Ganzen. Er ist wohl deswegen der erste Teil, weil ohne diesen Teil Sokrates nicht das wäre, was er ist, nämlich Sokrates. Über diesen Teil hinaus gibt es aber noch andere Teile, die dann aber nicht primäre Teile des Ganzen sind. Welche Philosophen Aristoteles zufolge vertreten haben, dass das All wie ein Ganzes ist, ist nicht deutlich.17 Es gibt Interpreten, die angenommen haben, dass Aristoteles mit der These, das All sei wie ein Ganzes, seine eigene Auffassung meint,18 aber diese Interpretation hat, wie eine Interpretation des achten und des zehnten Kapitels von Lambda zeigen wird, eher wenig für sich.
Der zweite Fall, demzufolge das All in einer Abfolge vorliegt, ist durch den Zusatz „darauf folgt das Wie-Beschaffen oder das Wieviel“19 ein wenig deutlicher als der erste Fall. Die Rede vom , Wie-Beschaffen‘ und vom , Wieviel‘ verweist uns auf Aristoteles’ Kategorienschrift. Die Kategorienschrift ist ein Werk, das Aristoteles sicherlich vor Lambda geschrieben hat.20 In dieser Schrift werden zehn Kategorien voneinander unterschieden.21 Was Aristoteles im Einzelnen dazu geführt hat, genau diese zehn Kategorien zu unterscheiden, ist im Detail umstritten. Eine zumindest für die beiden vorliegenden Kategorien plausible Interpretation ist aber, dass sich Aristoteles an verschiedenen Frageformen orientiert hat. Das griechische Wort, das in der vorliegenden Übersetzung mit , Wie-Beschaffen‘ übersetzt worden ist und das der Name einer Kategorie ist, lautet poion; das Wort, das mit , Wieviel‘ übersetzt worden ist und das eine andere Kategorie bezeichnet, poson. Diese Wörter sind, je nachdem, wie sie im Griechischen akzentuiert werden, entweder Fragepronomina (, Wie beschaffen?‘ bzw. , Wieviel?‘) oder Indefinitpronomina (,irgendwie beschaffen‘ bzw. ,von irgendeiner Größe‘). Wir fassen die Wörter als Fragepronomina auf. Wenn jemand fragt, wie beschaffen etwas ist, dann erhält er kategorial andere Antworten, als wenn er fragt, wieviel etwas ist. Man kann beispielsweise auf ein Beet voller Tulpen weisen und fragen, wie beschaffen diese Tulpen der Farbe nach sind. Man erhält als Antwort dann ein Farbprädikat, z. B. ,gelb‘. Man kann ebenso fragen, wie viele Tulpen auf dem Beet blühen. Man erhält dann als Antwort eine Zahl. Es ist aber ausgeschlossen, auf die Frage nach der Beschaffenheit von etwas mit einer Zahl und auf die Frage nach der Anzahl von etwas mit einem Farbprädikat zu antworten. Insofern gehören die möglichen Antworten auf die Frage nach der Beschaffenheit und die Frage nach dem Wieviel zwei unterschiedlichen Kategorien an. Aristoteles arbeitet schon in der Kategorienschrift nicht nur mit dem Fragepronomen, sondern gebraucht auch das abstrakte Nomen zu ,poion‘, das auf griechisch ,poiotēs‘ heißt und von Aristoteles als terminus technicus gebraucht wird. Deswegen bietet es sich an, ,poiotēs‘ als terminus technicus nicht mit , Wie-Beschaffenheit‘, sondern mit ,Qualität‘ zu übersetzen. Erst nach Aristoteles werden die Namen für die Kategorien dann ausschließlich als termini technici verwandt, so dass man von Substanz (für ousia), Qualität, Quantität, Relation usw. spricht.22 Wir werden uns im Kommentar aber der Einfachheit halber der Gepflogenheit anschließen, die Kategorien mit lateinischen Ausdrücken wiederzugeben und beispielsweise statt von der Kategorie des Wie-Beschaffen von der Kategorie der Qualität sprechen.
Weil anzunehmen ist, dass die Konzeption der ousia aus der Kategorienschrift auch die Konzeption der ousia in Lambda beeinflusst hat (sei es, dass Aristoteles an sie anknüpft, sei es, dass er sie ablehnt), sei noch kurz darauf eingegangen, was Aristoteles in der Kategorienschrift unter der ousia versteht. Die ousia ist die erste Kategorie. Aus der Kategorienschrift geht deutlich hervor, welche Dinge in die Kategorie der ousia fallen: Es sind erstens und vor allem sinnlich wahrnehmbare Einzeldinge, denen der Status einer ousia zukommt. Aristoteles nennt zwei Beispiele: ,Ein konkreter Mensch‘ und ,ein konkretes Pferd‘. Über die Einzeldinge hinaus fallen zweitens auch die Arten und Gattungen der Einzeldinge, also die Gattung der Menschen und die Gattung Pferde oder Lebewesen (als eine Gattung), in die Kategorie der ousia. Die konkreten Einzeldinge bilden die so genannte erste ousia, die Arten und Gattungen die zweite ousia. Die Kategorie der ousia ist in einer wichtigen Hinsicht von allen anderen Kategorien unterschieden. Es gibt Quantitatives und Qualitatives und Dinge in den anderen Kategorien überhaupt nur dann, wenn es etwas in der Kategorie der ousia gibt, das dann durch eine bestimmte Qualität und Quantität bestimmt ist. Es gibt beispielsweise die Farbe Rot nur dann, wenn es ousiai gibt, die rot sind. Rot kann als Farbe nur dadurch wirklich sein, dass es als eine Eigenschaft die Eigenschaft von etwas ist, das ein sinnlich wahrnehmbares Einzelding ist.
Diese Wirklichkeitsauffassung aus der Kategorienschrift muss natürlich nicht die Wirklichkeitsauffassung sein, die Aristoteles im zwölften Buch der Metaphysik vertreten möchte. Sie ist aber ein Beispiel dafür, was es heißen könnte, dass das All wie eine Abfolge ist. Ross meint in seinem Metaphysikkommentar, dass Speusippos, ein Zeitgenosse von Aristoteles und der Nachfolger von Platon in der Leitung der von Platon gegründeten Akademie, die Ansicht vertreten habe, dass das All eine Abfolge sei. Aristoteles meine mit der zweiten Wirklichkeitsauffassung folglich Speusippos. Dafür spreche, dass Aristoteles selbst im zehnten Kapitel von Lambda [vgl. (10. 2. 12)(ii)] auf Speusippos’ Theorie anspiele und eine solche Theorie kritisiere. Auf ein Problem dieser Deutung hat Frede aufmerksam gemacht23: Es sei plausibler anzunehmen, dass Aristoteles mit der zweiten Wirklichkeitsauffassung nicht nur Speusippos gemeint habe, sondern viel allgemeiner eine Art von Theorie beschreiben möchte, die zwar Speusippos, aber auch andere Philosophen und vielleicht sogar Aristoteles selbst vertreten hätten.
(1.2.2) Das Argument, das Aristoteles in (1.2.2) dafür vorträgt, warum man die ousia studieren soll, wenn man das Ganze der Wirklichkeit studieren will, ist sowohl sachlich als auch sprachlich eng mit dem Argument in (1.2.1) verbunden. Das Pronomen ,diese‘ im ersten Satz bezieht sich sicherlich auf das Qualitative und das Quantitative im zweiten im (1.2.1) genannten Fall, vielleicht im ersten Fall auch auf die Teile, die nicht der erste Teil sind. Worum es der Sache nach geht, ist folgendes: Es gibt offensichtlich einerseits Dinge, denen der Status der ousia zukommt und denen das Sein uneingeschränkt zugesprochen werden kann, und andererseits Dinge, denen nicht der Status der ousia zukommt und denen das Sein nur eingeschränkt zugesprochen werden kann. Zu denjenigen Dingen, denen das Sein nur eingeschränkt zugesprochen wird, gehören beispielsweise die Qualitäten. Nehmen wir als Beispiel das Kranksein. Krank kann etwas nur dann sein, wenn es etwas anderes gibt, dem das Sein uneingeschränkt zukommt, d. h. wenn es eine ousia gibt, die krank ist. Ebenso kann etwas nur rot sein, wenn etwas aus der Kategorie der ousia rot ist. Einer Qualität kommt das Sein nur dann zu, wenn es eine ousia gibt, der die Qualität zugesprochen werden kann. Die Einschränkung in Bezug auf das Sein besteht also in der Abhängigkeit von dem Sein von etwas anderem, nämlich (zumindest als letztem Glied der Analyse) dem Sein einer ousia.
Bei der ousia selbst gibt es diese Einschränkung nicht. Sokrates kommt sein Sokratessein nicht eingeschränkt oder vermittelt über etwas anderes zu. Sein Sein ist ein Sein in uneingeschränktem, oder, wie man das griechische Wort ‚haplōs‘ auch übersetzen könnte, in unqualifiziertem Sinn. Das Sokratessein kommt ihm zu, insofern er das ist, was er ist.
Sein im uneingeschränkten Sinn kommt also nur den Dingen in der Kategorie der ousia zu. Den Dingen in den anderen Kategorien kommt das Sein nur eingeschränkt zu: Sie sind etwas nur, insofern sie es an einer ousia sind. In ähnlicher Weise, allerdings noch komplizierter vermittelt, kommt auch dem Nicht-Weißen und dem Nicht-Geraden nur in abgeleiteter Weise Sein zu. Dem Nicht-Weißen kommt ein Sein zu, insofern eine ousia beispielsweise rot ist. Der Farbe Rot kommt das Sein dann eingeschränkt zu (insofern es Farbe an einer ousia ist), dem Nicht-Weißen kommt das Sein zu, insofern der ousia eine andere Farbe als das Weiß eingeschränkt zukommt. Aristoteles wählt diese Beispiele wohl vor allem deswegen, weil es bei dem Nicht-Weißen noch weniger sinnvoll ist als bei dem Roten zu fragen, ob ihm unqualifiziertes Sein zukommt. Wer ein Platoniker ist, wird vielleicht noch der Auffassung sein, dass der Farbe Rot ein unqualifiziertes Sein zukomme und dass die Idee des Roten eben im unqualifizierten Rotsein bestehe. Aber auch ein Platoniker wird zögern, dem Nicht-Weißen oder dem Nicht-Geraden ein eigenes, unqualifiziertes Sein zuzusprechen.
(1.2.3) Die Behauptung, dass die ousia selbstständig abtrennbar ist, wird von Aristoteles nicht weiter begründet, und so ist es nicht ganz eindeutig, was Aristoteles mit der Behauptung genauer meint. Das griechische Wort, das je nach Kontext entweder mit ,selbstständig abtrennbar‘ oder mit ,selbstständig abgetrennt‘ übersetzt werden muss, ist ,chōriston‘. Es leitet sich vom Verb chōrizein ab, das ,abtrennen‘ bedeutet. Aristoteles ist der erste Philosoph, der das Wort in einer philosophisch relevanten Bedeutung gebraucht, und zwar in vor allem zwei Kontexten.24 Der erste Kontext ist derjenige der Kritik an Platon. Platon, so der Vorwurf von Aristoteles, habe die Ideen von der sinnlich wahrnehmbaren Welt abgetrennt. Das bedeutet modern gesprochen, dass er den Ideen eine von der wahrnehmbaren Welt unabhängige Existenz zukommen lässt. Der zweite Kontext, in dem Aristoteles von ,chōriston‘ spricht, ist seine eigene Konzeption der ousia. Ein Kriterium für die ousia ist, dass sie selbstständig abtrennbar ist. Dabei unterscheidet Aristoteles zwischen zwei Formen der Abtrennbarkeit, die begriffliche Abtrennbarkeit und die Abtrennbarkeit ohne weitere Qualifikationen. Im ersten Kapitel des achten Buches der Metaphysik meint er beispielsweise, dass die ousia, insofern sie die Form eines aus Form und Materie konstituierten Einzelgegenstandes ist, begrifflich abtrennbar ist, und dass die ousia, insofern mit ihr der Einzelgegenstand gemeint ist, ohne weitere Qualifikationen abtrennbar ist.25 Es gibt andere Stellen in den Werken von Aristoteles, in denen er die nicht weiter qualifizierte Abtrennbarkeit mit einer räumlichen Abtrennbarkeit identifiziert.26 Ohne weitere Qualifikationen selbstständig abtrennbar ist ein Einzelding demzufolge dann, wenn es eine eigene Stelle im Raum einnimmt, d. h. in Bezug auf den Ort von anderen Dingen unterschieden ist.
Die Behauptung in (1.2.3), die ousia sei selbstständig abtrennbar, lässt sich am besten im Sinne der räumlichen Abtrennbarkeit verstehen. Wenn Aristoteles schreibt, dass nur die ousia und „nichts von dem übrigen“ selbstständig abtrennbar ist, dann meint er damit, dass nichts von den Dingen, die in andere Kategorien als die der ousia gehören (also die Qualitäten, Quantitäten usw.), selbstständig abtrennbar ist. Die Dinge in den anderen Kategorien sind nicht selbstständig abtrennbar, weil sie nicht für sich eine Stelle im Raum einnehmen können. Sie können sich zwar an einer Stelle im Raum befinden, aber nur deswegen, weil sie Eigenschaften an einer ousia sind, der es an sich zukommt, eine Stelle im Raum einzunehmen. Die zugrunde liegende Intuition ist offenbar, dass es Dinge gibt, die selbstständig abtrennbar sind, wie beispielsweise Menschen, Tiere und Pflanzen. Ihnen kommt eine eigene, unabhängige Existenz zu. Wenn man freilich weitere Überlegungen anstellt, dann wird schnell deutlich, dass auch Menschen, Tiere und Pflanzen nicht wirklich so selbstständig abtrennbar sind, wie man zunächst annehmen möchte. Der Baum ist auf den Erdboden und die Luft angewiesen, ein Mensch stammt von seinen Eltern ab und braucht Nahrung usw. So mag man fragen, ob es vielleicht eine ousia gibt, die ohne diese Einschränkungen selbstständig abtrennbar ist und die demzufolge nicht von irgendetwas abhängt.
(1.2.4) Es ist Aristoteles’ Überzeugung, dass die Frage nach der ousia eine Frage ist, mit der die Philosophie begonnen hat. Wenn auch die so genannten Vorsokratiker nicht wörtlich davon gesprochen haben, dass sie die ousia suchen (der Terminus selbst kommt erst bei Platon in philosophischer Bedeutung vor), sondern davon gesprochen haben, das Seiende (gr. to on) oder die Natur (gr. hē physis) bestimmen zu wollen, so ist es doch der Sache nach so, dass sie – in Aristotelischer Terminologie – die Prinzipien, Elemente und Ursachen der ousia gesucht haben. Was Aristoteles in (1.2.4) nur andeutet, wird im ersten Kapitel des siebten Buches der Metaphysik näher ausgeführt.27 Dort legt er dar, dass die Frage nach dem Seienden als die Frage nach der ousia verstanden werden muss. Sein Forschungsprojekt steht also in Kontinuität mit dem, was die früheren Philosophen interessiert hat, die nach den Prinzipien und Ursachen der Wirklichkeit gefragt, diese Frage aber anders ausgedrückt haben.
(1.3) Mit (1.3) beginnt ein neuer Abschnitt, in dem sich Aristoteles der Frage zuwendet, welchen Dingen oder welchen Arten von Dingen bei den verschiedenen Philosophen der Status einer ousia zukommt.28 Die in (1.3) erwähnten jetzigen Philosophen sind die Platoniker. Sie vertreten Aristoteles’ Auffassung nach, dass die nicht wahrnehmbaren Gattungen in höherem Maße ousiai sind. Sie sprechen den Gattungen eher den Status einer ousia zu, weil sie ihre Untersuchungen vor allem begrifflich führen. An diesen Ausführungen sind mehrere Punkte interessant. Erstens behauptet Aristoteles nicht, dass die Platoniker ausschließlich den Gattungen den Status einer ousia zukommen lassen. Wir werden in (1.4.1) sehen, dass es Aristoteles zufolge bestimmte Dinge gibt, die alle Philosophen (also auch die Platoniker) für eine ousia halten: die konkreten, sinnlich wahrnehmbaren Einzeldinge. Die Platoniker sind offenbar der Auffassung, dass zwar auch die konkreten, sinnlich wahrnehmbaren Einzeldinge ousia-Status haben, es aber dennoch Dinge gibt, denen in größerem Maße der Status einer ousia zukommt, die Gattungen eben. Sie kommen dazu, weil sie sich in ihren Untersuchungen nicht so sehr an den natürlichen Phänomenen, sondern an den Begriffen orientieren. Damit ist folgendes gemeint: Wir können beispielsweise fragen, was die Ursache dafür ist, dass es Menschen gibt. Jemand, der sich an den natürlichen Phänomenen orientiert, würde darauf antworten, dass es Menschen gibt, weil Menschen Menschen zeugen. Jemand, der sich an den Begriffen orientiert, würde meinen, es gibt konkrete Menschen, weil es die Gattung ,Mensch‘ gibt, die Prinzip und Ursache dafür ist, dass es Menschen gibt. So kommt man Aristoteles zufolge zu der Auffassung, dass es die Gattungen sind, denen in höherem Maße der Status einer ousia zugesprochen werden muss.
Die alten Philosophen, gemeint sind die so genannten Vorsokratiker, setzen eher die Einzeldinge, und d. h. die Elemente, als ousia. Wenn in diesem Zusammenhang von Elementen die Rede ist, dann sind damit Feuer, Wasser, Luft und Erde gemeint. Einige Vorsokratiker sind, selbst wenn sie es nicht so ausdrücken, davon überzeugt, dass alles, was es gibt, auf eines oder mehrere dieser Elemente zurückgeführt werden kann, so dass eines oder mehrere Elemente die eigentlichen Prinzipien der Wirklichkeit sind. Dabei verstehen sie unter den jeweiligen Elementen nicht die für uns Menschen nicht sichtbaren Atome oder Molekülverbindungen. Die Elemente sind vielmehr selbst auch Einzeldinge, eben beispielsweise konkretes Wasser (oder auch alles Wasser, was es überhaupt gibt). Aristoteles nennt als Beispiele Feuer und Erde, und wir wissen, dass zwei Philosophen, Hippasus und Heraklit, angenommen haben, dass das Feuer das letzte Prinzip von allem sei; die Erde wird beispielsweise von Empedokles als ein Prinzip (neben anderen) angenommen. Ähnlich wie schon bei der Diskussion darüber, ob das All ein Ganzes oder eine Abfolge ist, geht es Aristoteles offensichtlich nicht darum, Auffassungen einzelner Philosophen zu diskutieren, sondern einen Theorietyp zu charakterisieren. Auch die Vorsokratiker nehmen an, dass wahrnehmbare Einzeldinge ousiai sind. Sie sind aber auch der Auffassung, dass die Ursachen und Prinzipien der wahrnehmbaren Einzeldinge, die selbst wieder wahrnehmbare Einzeldinge sind, in höherem Maße ousiai sind. Im Unterschied zu den Platonikern sind diese Prinzipien nicht abstrakte Entitäten wie der allgemeine Körper29 , sondern die materiellen konstitutiven Elemente der Einzeldinge wie beispielsweise Feuer oder Erde.
(1.4.1) Die folgende Einteilung dessen, was alles als ousia angenommen wird, ist auf den ersten Blick verwirrend. Uns wird angekündigt, dass es drei Arten von ousiai gibt. Aufgezählt werden im Text aber zunächst nur zwei Arten von ousiai, erstens die sinnlich wahrnehmbare und zweitens die unbewegliche ousia. Zu den drei Arten von ousiai kommt Aristoteles dadurch, dass er innerhalb der wahrnehmbaren ousia noch einmal zwischen wahrnehmbaren ousiai, die vergänglich sind, und wahrnehmbaren ousiai, die ewig (also nicht vergänglich) sind, unterscheidet. Zur ersten Art gehören alle wahrnehmbaren, vergänglichen Einzeldinge, wie konkrete Menschen, Tiere und Pflanzen. Zur zweiten Art gehören die wahrnehmbaren, ewigen Einzeldinge. Später in Lambda wird deutlich werden, dass damit die Himmelskörper gemeint sind, die Aristoteles zufolge weder entstanden sind noch vergehen werden. Das Universum ist für Aristoteles ewig, es hat keinen zeitlichen Anfang und kein zeitliches Ende.
Ein Problem bei der Interpretation von (1.4.1) besteht darin, dass alle griechischen Handschriften einen Text bringen, der der Sache nach unbefriedigend ist. Es geht um das Problem, worauf sich der Zusatz „die alle anerkennen“ eigentlich bezieht. Die Handschriften gehen davon aus, dass sich der Zusatz ausschließlich auf die vergänglichen wahrnehmbaren Einzeldinge bezieht. Wenn wir den Handschriften folgen wollten, müssten wir den in Frage stehenden Satz wie folgt übersetzen: „Es gibt drei ousiai; zunächst die sinnlich wahrnehmbare, von der die eine ewig ist, die andere aber vergänglich, die alle anerkennen, wie die Pflanzen und die Lebewesen“. Dieser Lesart zufolge wäre unter allen Philosophen unkontrovers, dass wahrnehmbare, vergängliche Einzeldinge den Status einer ousia haben. Umstritten wäre, ob wahrnehmbaren, ewigen Einzeldingen (also den Himmelskörpern) der Status einer ousia zukommt.
Es ist nun auffällig, dass ab dem 4. Jh. bei Themistius, der eine Paraphrase von Lambda geschrieben hat, und bei einigen Aristoteleskommentatoren eine Tradition beginnt, in der der Zusatz „die alle anerkennen“ sowohl auf die vergänglichen als auch auf die ewigen wahrnehmbaren Einzeldinge, die damit beide den Status einer ousia haben, bezogen wird.30 Die vorliegende Übersetzung folgt dieser Tradition. Nun wäre es sicherlich schwer rechtfertigbar, wenn man sich gegen alle überlieferten Handschriften allein auf Paraphrasen, Übersetzungen und Kommentatoren berufen würde. Es gibt aber einen Grund, gegenüber den Handschriften selbst skeptisch zu sein. Die Handschriften fügen nämlich dem Satz: „Es gibt drei ousiai; zunächst die sinnlich wahrnehmbare, von der die eine ewig ist, die andere aber vergänglich, die alle anerkennen, wie die Pflanzen und die Lebewesen“ noch einen weiteren Zusatz hinzu: „von denen die andere ewig <ist>“. Dieser Zusatz fügt sich syntaktisch nicht in den Satz ein und ist auch der Sache nach fehl am Platz. Das lässt die Annahme zu, dass wohl der ganze Satz in den Handschriften verderbt ist und keiner Handschrift zu trauen ist.
Für die Deutung, die den Handschriften folgt, scheint allerdings zunächst zu sprechen, dass Aristoteles zu Beginn des sechsten Kapitels [vgl. (6.1.2)] ein eigenes Argument für die Ewigkeit der Kreisbewegung des Fixsternhimmels (und insofern auch ein Argument für die Ewigkeit der Fixsterne selbst) bringt. Wenn nun die Ewigkeit der Himmelskörper von allen Philosophen anerkannt ist, dann, so könnte man meinen, ist ein solches Argument eigentlich unnötig. Zweitens wissen wir aus anderen Texten von Aristoteles, dass er sich bewusst gewesen ist, dass die Ewigkeit des Universums und somit die Ewigkeit der Himmelskörper kontrovers diskutiert worden ist; Aristoteles ist beispielsweise der Auffassung, Platon habe die Ansicht vertreten, dass das Universum einen zeitlichen Anfang hat. Aristoteles kann also unmöglich der Auffassung gewesen sein, dass die Ewigkeit der Himmelskörper unbestritten gewesen ist.
Für die Übersetzung, die sich an den Kommentatoren orientiert, spricht, dass Aristoteles im zweiten Kapitel von Lambda [vgl. (2.5)] sagt, dass es Dinge gibt, die eine Materie ausschließlich für die Ortsbewegung, nicht aber für das Entstehen und Vergehen haben. Damit können nur die ewigen Himmelskörper gemeint sein. Sie sind nicht entstanden und vergehen nicht, aber sie bewegen sich entlang klar definierbarer Bahnen. Weil Aristoteles die ewigen wahrnehmbaren ousiai ohne jedes weitere Argument innerhalb einer Abhandlung über die wahrnehmbaren ousiai ganz allgemein behandelt, liegt es nahe, ihm die Auffassung zuzuschreiben, auch die ewigen wahrnehmbaren ousiai seien in ihrem Status als ousia nicht kontrovers. Ein weiterer Grund dafür, die Lesart der Kommentatoren zu akzeptieren, besteht darin, dass Aristoteles an verschiedenen anderen Stellen in der Metaphysik eindeutig davon ausgeht, dass die Himmelskörper zu den allgemein anerkannten ousiai gehören.31 Aber wie, wenn diese Deutung richtig sein sollte, lassen sich die Argumente für die Deutung, die den Handschriften folgt, entkräften?
Es erscheint mir am plausibelsten, zwischen zwei verschiedenen Behauptungen zu unterscheiden. Die erste Behauptung ist, dass alle Philosophen anerkennen, dass die Himmelskörper ousiai sind. Die zweite Behauptung ist, dass alle Philosophen anerkennen, dass die Himmelskörper ousiai sind und dass diese Himmelskörper ewig sind. Aristoteles stellt in (1.4.1) nur die erste, nicht aber die zweite Behauptung auf. Er selbst ist zwar der Überzeugung, dass man zwischen wahrnehmbaren vergänglichen und wahrnehmbaren ewigen ousiai unterscheiden muss, beispielsweise weil die ewigen wahrnehmbaren ousiai nur eine Materie für die Ortsbewegung haben und sich damit in relevanter Hinsicht von den vergänglichen wahrnehmbaren ousiai unterscheiden. Er ist sich aber bewusst, dass er diese Annahme begründen muss. Das Argument für diese Auffassung findet sich zu Beginn des sechsten Kapitels [vgl. (6.1.2)]. Die Unterscheidung der drei Arten von ousiai rekapituliert also nicht nur, was für Arten von ousiai von den Philosophen tatsächlich angenommen werden, sondern enthält auch eine Behauptung, für die Aristoteles in Lambda noch wird argumentieren müssen.
Die Unterscheidungen der Arten der ousiai ist darüber hinaus deswegen kompliziert, weil Aristoteles der wahrnehmbaren ousia in seiner Aufzählung nicht, wie man es erwarten würde, die nicht wahrnehmbare ousia gegenüberstellt, sondern die dritte Art von ousia dadurch charakterisiert sein lässt, dass sie unbeweglich ist. Der Sache nach ist das kein Problem, denn Aristoteles ist zu Recht der Meinung, dass alles, was nicht wahrnehmbar ist, unbeweglich sein muss. Seine Überzeugung ist, dass sich alles, was wahrnehmbar ist, bewegt; alles, was sich bewegt, verändert sich, und diese Veränderung muss sich an einem Körper vollziehen, der eben als Körper sinnlich wahrnehmbar ist [vgl. dazu auch den Kommentar zu (2.1)]. Wenn etwas nicht wahrnehmbar ist, hat es also keinen Körper, und was keinen Körper hat, kann sich auch nicht bewegen.
Die dritte Art der ousia ist, anders als die beiden ersten Arten, unter den Philosophen in zweifacher Hinsicht umstritten. Erstens ist umstritten, ob es überhaupt eine unbewegliche ousia gibt, denn nicht alle Philosophen nehmen an, dass es unbewegliche ousiai gibt. Zweitens ist unter denen, die eine unbewegliche ousia annehmen, umstritten, wie diese zu bestimmen ist. Aristoteles zählt mehrere Auffassungen auf: Einige (und damit sind, wie die Beispiele zeigen, an dieser Stelle die Platoniker gemeint, obwohl Aristoteles selbst in Lambda für diese Auffassung argumentieren wird) behaupten, die unbewegliche ousia sei selbstständig abgetrennt [vgl. zu diesem Kriterium (1.2.3)]. Von denjenigen, die abgetrennte unbewegliche ousiai annehmen, gibt es einige, die zwei Bereiche von ousiai unterscheiden,32 andere, die meinen, die Ideen und die mathematischen Gegenstände seien der Sache nach eine einzige Natur,33 wieder andere nehmen an, dass nur die mathematischen Gegenstände abgetrennte ousiai sind.34 Wie dem auch sei – es ist deutlich, worin die Aufgabe besteht, wenn man etwas über die unbewegliche ousia sagen möchte: Es kann nicht nur darum gehen zu untersuchen, ob es überhaupt unbewegliche ousiai gibt, sondern auch darum zu zeigen, wie die unbeweglichen ousiai zu bestimmen sind, falls sie denn überhaupt existieren. Wie wir in Lambda sehen werden, wird Aristoteles gemeinsam mit Platon und den Platonikern die Vorsokratiker kritisieren, weil es tatsächlich unbewegte ousiai gibt und die unbewegten ousiai die Prinzipien der bewegten ousiai sind. Gegen Platon und die Platoniker wird Aristoteles aber dafür argumentieren, dass diese unbewegten ousiai keine Ideen, sondern vielmehr Intellekte sind.
(1.4.2) Aristoteles macht im ersten Kapitel keinerlei Aussage darüber, ob die drei Arten von ousiai der Sache nach miteinander zusammenhängen, oder ob jede ousia für sich ganz unabhängig von den anderen beiden Arten existiert. Wenn alle drei Arten von ousiai ganz unabhängig voneinander sind, dann stellt sich die Frage, welche Wissenschaft sich jeweils mit einer der Arten der ousiai beschäftigt. Wir würden annehmen, dass es mindestens zwei Wissenschaften geben muss, wobei die eine Wissenschaft die wahrnehmbare ousia und die zweite Wissenschaft die unveränderliche ousia untersucht. Wenn sich herausstellen sollte, dass die vergänglichen wahrnehmbaren und die ewigen wahrnehmbaren ousiai ebenfalls ganz unabhängig voneinander sind, dann müsste man vielleicht sogar drei verschiedene Wissenschaften annehmen, die jeweils die für ihre Wissenschaft charakteristische ousia als ihr Objekt haben. Der Frage danach, welche Wissenschaft für die Erforschung der ousia verantwortlich ist, wendet sich Aristoteles in (1.4.2) zu.
Der Satz, in dem Aristoteles die verschiedenen Arten von ousiai den unterschiedlichen Wissenschaften zuordnet, bietet erhebliche Probleme. Zunächst scheint er ganz unproblematisch zu sein: Die ersten beiden Arten der ousia gehören zur Physik. Ob die dritte Art der ousia zur Physik oder zu einer anderen Wissenschaft gehört, hängt davon ab, ob es ein Prinzip gibt, das sowohl ein Prinzip der beweglichen als auch ein Prinzip der unbeweglichen ousiai ist. Wenn Aristoteles von einer anderen Wissenschaft spricht, dann meint er damit eine Wissenschaft, die ausschließlich diejenigen ousiai, die nicht sinnlich wahrnehmbar sind, erforscht. Seinem eigenen Sprachgebrauch nach ist damit die erste Philosophie oder die theologische Wissenschaft gemeint; der Sache nach geht es um die Metaphysik.
Das Problem beginnt aber mit der Frage, ob es denn ein Prinzip gibt, das sowohl ein Prinzip der sinnlich wahrnehmbaren als auch der nicht sinnlich wahrnehmbaren ousiai ist. Viele Interpreten des zwölften Buches der Metaphysik haben diese Frage verneint. Ihnen zufolge gehören die sinnlich wahrnehmbaren ousiai, die in den Kapiteln 2 – 5 abgehandelt werden, zur Physik, und die nicht sinnlich wahrnehmbaren ousiai zur Theologie. Dass die Interpreten meinen, die nicht sinnlich wahrnehmbaren ousiai seien die Objekte der Theologie, hängt damit zusammen, dass Aristoteles außerhalb von Lambda an einigen Stellen seiner Metaphysik von einer theologischen Wissenschaft spricht und Aristoteles im siebten Kapitel für eine nicht sinnlich wahrnehmbare ousia argumentiert, die tatsächlich mit Gott identifiziert wird. Dieses Vorgehen hat der Auffassung Vorschub geleistet, Aristoteles entwerfe in den Kapiteln 6 – 10 seine eigene Theologie.
Das Problem einer solchen Deutung besteht darin, dass das zwölfte Buch in zwei unterschiedliche wissenschaftliche Abhandlungen zerfallen würde. Vor allem wird man dieser Deutung zufolge die Kapitel 2 – 5 schnell überspringen können, denn eine Analyse der sinnlich wahrnehmbaren ousiai bekommen wir viel ausführlicher in anderen Schriften von Aristoteles, nicht zuletzt in den Substanzbüchern der Metaphysik. Was dieser Deutung zufolge wichtig ist, ist die Aristotelische Theologie in den Kapiteln 6 – 10. Die Forschungsgeschichte des zwölften Buches macht denn auch deutlich, dass es vor allem diese Kapitel sind, die das Interesse der Forscher auf sich gezogen haben. Die Kapitel 2 – 5 sind demgegenüber so gut wie vollständig von den Interpreten vernachlässigt worden.
Gegen eine solche Deutung des zwölften Buches spricht vor allem eines: Im achten Kapitel, aber nicht nur dort [vgl. z. B. (6.2.3)], wird deutlich werden, dass es Aristoteles zufolge nicht nur eine einzige unbewegliche ousia gibt, die das unbewegt Bewegende der Sphäre der Fixsterne ist, sondern dass mehrere unbewegt Bewegende angenommen werden müssen.35 Es gibt zwar ein einziges oberstes unbewegt Bewegendes, das das letzte Prinzip der gesamten Wirklichkeit ist, aber es gibt noch weitere unbewegt Bewegende, die, wie unsere Interpretation ergeben wird, in einer ontologischen Abhängigkeit zu dem ersten und obersten unbewegt Bewegenden stehen. Das bedeutet aber, dass das erste und oberste unbewegt Bewegende erstens ein Prinzip der unbewegten ousiai (i.e. der anderen unbewegt Bewegenden) und zweitens auch ein Prinzip der sinnlich wahrnehmbaren ewigen ousiai (nämlich der Fixsterne) ist. Vermittelt über die Fixsterne ist das erste unbewegt Bewegende auch drittens das Prinzip der wahrnehmbaren vergänglichen ousiai. Es gibt Aristoteles zufolge also ein gemeinsames Prinzip der drei Arten von ousiai. Dieses gemeinsame Prinzip ist das erste, oberste unbewegt Bewegende. Die Bedingung, die Aristoteles in (1.4.2) nennt, ist also offenbar erfüllt.
Bedeutet das aber nun notwendig, dass die Untersuchung der nicht sinnlich wahrnehmbaren ousia in den Bereich der Physik fällt? Ein solches Ergebnis scheint der Text zunächst nahe zu legen. Dieses Ergebnis wäre aber merkwürdig, weil sich die Physik, wie wir aus (1.4.2) ja ebenfalls erfahren, mit denjenigen Dingen beschäftigt, die der Bewegung unterworfen sind, und die Dinge, die nicht der Bewegung unterworfen sind, nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der Physik fallen. Warum sollte also eine Untersuchung der unbewegten ousiai zur Physik gerechnet werden?
Einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit ist folgende Überlegung: Wir können uns mit Dingen, die der Bewegung unterworfen sind, auf zweierlei Weise beschäftigen. Wir können sie einmal untersuchen, insofern sie Dinge sind, die der Bewegung unterworfen sind, und in diesem Fall wäre die Physik tatsächlich die angemessene Wissenschaft. Wir können sie aber auch untersuchen, insofern ihnen der Status einer ousia zukommt. Etwas zu untersuchen, insofern es eine ousia ist, gehört aber nicht in den Zuständigkeitsbereich der Physik, sondern einer anderen Wissenschaft, eben der Metaphysik, oder, wie Aristoteles es selbst sagt, der ersten Philosophie. Wenn wir uns diese Interpretation zu Eigen machen, dann verfolgt das zwölfte Buch ein einheitliches Ziel: Es geht um eine umfassende Untersuchung der ousia. Dabei werden in den Kapiteln 2 – 5 die sinnlich wahrnehmbaren ousiai, und in den Kapiteln 6 – 10 die nicht sinnlich wahrnehmbaren ousiai abgehandelt. Der erhebliche Vorteil dieser Interpretation besteht darin, dass die sachliche Einheit des zwölften Buches gewährleistet bleibt. Es ist ein und dasselbe Forschungsprojekt, das in dem ganzen zwölften Buch durchgeführt wird.
Diese Deutung verträgt sich auch mit dem Text von (1.4.2). Crubellier hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Konditionalsatz „falls sie mit jenen kein gemeinsames Prinzip hat“ nicht nur auf den zweiten Teilsatz („diese aber einer anderen Wissenschaft“), sondern bereits auf den ersten Teilsatz beziehen kann („jene <ousiai> gehören der Physik an“).36 Qua ousiai gehören diejenigen Dinge, die der Bewegung unterworfen sind, eben nicht der Physik an, weil es ein Prinzip gibt, das sowohl den Dingen, die der Bewegung unterworfen sind, als auch den Dingen, die nicht der Bewegung unterworfen sind, gemeinsam ist. Wir können die Dinge, die der Bewegung unterworfen sind, in ihrem ousia-Status gar nicht verstehen, wenn wir sie lediglich innerhalb der Physik betrachten.