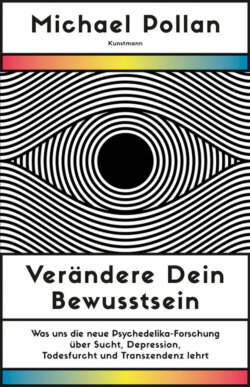Читать книгу Verändere dein Bewusstsein - Michael Pollan, Michael Pollan - Страница 6
Prolog Eine neue Tür
ОглавлениеUm die Mitte des 20. Jahrhunderts brachen zwei ungewöhnliche neue Moleküle, beides organische Substanzen mit markanter Familienähnlichkeit, über den Westen herein. Mit der Zeit veränderten sie den Lauf der Gesellschafts-, Politik- und Kulturgeschichte, ebenso wie die Lebensgeschichte von Millionen Menschen, die sie ihrem Gehirn zuführten. Wie es der Zufall wollte, fiel das Aufkommen dieser revolutionären Substanzen mit einem anderen welthistorischen Spektakel zusammen – der Explosion der Atombombe. Manche Leute setzten die beiden Ereignisse zueinander in Beziehung und hoben die kosmologische Gleichzeitigkeit hervor. Man hatte außerordentliche neue Energien auf die Welt losgelassen, und es würde nie mehr so sein wie vorher.
Das erste der beiden Moleküle1 war eine zufällige Erfindung der Wissenschaft. Lysergsäurediethylamid, landläufig unter dem Kürzel LSD bekannt, wurde 1938, kurz bevor Physikern die Kernspaltung von Uran gelang, erstmals von Albert Hofmann synthetisiert. Hofmann, der für das Schweizer Pharmaunternehmen Sandoz arbeitete, hatte nach einem kreislaufanregenden Medikament gesucht, nicht nach einer psychoaktiven Substanz. Erst als er ein paar Jahre später versehentlich eine winzige Menge der neuen Chemikalie aufnahm, begriff er, dass er etwas Gewaltiges erschaffen hatte, das zugleich beängstigend und wundersam war.
Das zweite Molekül2 existierte schon Tausende von Jahren, doch in den Industrieländern war sich dessen niemand bewusst. Nicht von einem Chemiker hervorgebracht, sondern von einem unscheinbaren kleinen braunen Pilz, war dieses Molekül, das unter dem Namen Psilocybin Bekanntheit erlangen sollte, von den Ureinwohnern Mexikos und Mittelamerikas jahrhundertelang als Sakrament verwendet worden. Der von den Azteken teonanácatl oder «Fleisch der Götter» genannte Pilz wurde nach der spanischen Eroberung von der römischkatholischen Kirche brutal bekämpft und in den Untergrund gedrängt. 1955, zwölf Jahre nachdem Albert Hofmann LSD entdeckt hatte, probierte R. Gordon Wasson, ein Bankier und Amateurmykologe aus Manhattan, den Magic Mushroom in der im südmexikanischen Staat Oaxaca gelegenen Stadt Huautla de Jiménez aus. Zwei Jahre später veröffentlichte er im Life-Magazin einen fünfzehnseitigen Artikel3 über die «Pilze, die seltsame Visionen erzeugen», und das war der Moment, als die Nachricht von einer neuen Bewusstseinsform erstmals die Öffentlichkeit erreichte. (1957 war die Kenntnis von LSD noch auf die Community von Forschern und psychologischen Experten beschränkt.) Die Leute begriffen das Ausmaß dessen, was geschehen war, erst Jahre später, doch im Westen hatte sich die Geschichte verändert.
Die Bedeutung dieser beiden Substanzen ist kaum zu überschätzen. Das Aufkommen von LSD lässt sich mit der Revolution in der Hirnforschung verknüpfen, die in den 1950er Jahren beginnt, als Wissenschaftler die Rolle der Neurotransmitter im Gehirn erkannten. Dass wenige Mikrogramm LSD psychoseähnliche Symptome hervorrufen konnten, regte Hirnforscher dazu an, nach der neurochemischen Grundlage psychischer Störungen zu suchen, die man bis dahin für psychologisch bedingt gehalten hatte. Zugleich fanden psychedelische Drogen Eingang in die Psychotherapie, wo sie zur Behandlung verschiedener Erkrankungen wie Alkoholismus, Angststörungen und Depressionen eingesetzt wurden. In den 1950er und frühen 1960er Jahren betrachteten viele im psychiatrischen Establishment LSD und Psilocybin als Wunderdrogen.
Das Aufkommen dieser beiden Substanzen ist auch mit dem Beginn der Gegenkultur in den 1960er Jahren und vielleicht ganz besonders mit deren speziellen Ton und Stil verknüpft. Erstmals in der Geschichte hatte die Jugend einen eigenen Übergangsritus: den «Acid-Trip». Statt die jungen Leute in die Erwachsenenwelt zu zwängen, wie Übergangsriten es stets getan haben, versetzte dieses sie in eine Geisteswelt, von deren Existenz nur wenige Erwachsene eine Ahnung hatten. Die Auswirkung auf die Gesellschaft war, gelinde gesagt, umwälzend.
Doch Ende der 1960er Jahre schienen die von diesen Substanzen ausgelösten gesellschaftlichen und politischen Schockwellen zu verebben. Die Schattenseite der Psychedelika rückte ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit – Horrortrips, psychotische Schübe, Flashbacks, Selbstmorde –, und von 1965 an verwandelte sich der Überschwang, der diese neuen Drogen begleitet hatte, in moralische Panik. So schnell wie sich die Kultur und das wissenschaftliche Establishment die Psychedelika zu eigen gemacht hatten, wandten sie sich jetzt schroff davon ab. Am Ende des Jahrzehnts wurden psychedelische Drogen – die fast überall legal gewesen waren – verboten und in den Untergrund verbannt. Wenigstens eine der beiden Bomben des 20. Jahrhunderts schien damit entschärft zu sein.
Dann geschah etwas Unerwartetes, Aufschlussreiches. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, beschloss in den 1990er Jahren eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, Psychotherapeuten und sogenannten Psychonauten, die glaubten, der Wissenschaft und der Kultur sei etwas Wertvolles verloren gegangen, es zurückzugewinnen.
Heute, nach jahrzehntelanger Unterdrückung und Vernachlässigung, erfahren Psychedelika eine Renaissance. Eine neue Generation von Wissenschaftlern, viele von ihnen angeregt durch persönliche Erfahrungen mit diesen Substanzen, erproben ihr Potenzial zur Heilung psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Traumata und Sucht.
Andere Wissenschaftler verwenden Psychedelika in Verbindung mit bildgebenden Verfahren der Hirnareale, um die Verbindung zwischen Gehirn und Geist zu erforschen und vielleicht einige Rätsel des Bewusstseins zu lösen.
Eine gute Methode zum Verständnis eines komplexen Systems ist, es zu stören und dann zu sehen, was passiert. Wenn ein Teilchenbeschleuniger Atome zertrümmert, zwingt er sie, ihre Geheimnisse preiszugeben. Und wenn ein Neurowissenschaftler in sorgfältig abgemessenen Dosen Psychedelika verabreicht, kann er das normale Wachbewusstsein von Versuchspersonen hochgradig stören, die Strukturen des Ichs auflösen und etwas hervorrufen, das man als mystische Erfahrung bezeichnen kann. Währenddessen können bildgebende Verfahren die Veränderungen in Hirnaktivität und Verbindungsmustern aufzeigen. Diese Arbeit liefert bereits überraschende Einblicke in die «neuronalen Korrelate» des Selbstempfindens und spiritueller Erfahrung. Der alte Gemeinplatz aus den 1960er Jahren, dass Psychedelika einen Schlüssel zum Verständnis – und zur «Erweiterung» – des Bewusstseins bieten, wirkt plötzlich nicht mehr so lächerlich.
Verändere dein Bewusstsein ist die Geschichte dieser Renaissance. Obschon anders geplant, ist es eine sehr persönliche und zugleich eine allgemeine Geschichte. Das war vielleicht unvermeidlich. Alles, was ich über die allgemeine Geschichte der Psychedelik-Forschung erfuhr, weckte in mir den Wunsch, diese neue Landschaft des Geistes auch höchstpersönlich zu erforschen – zu erleben, wie sich die Bewusstseinsveränderungen, die diese Moleküle erzeugen, wirklich anfühlen, was ich daraus womöglich über meinen Geist lernen und was sie zu meinem Leben beisteuern könnten.
Das war für mich eine unerwartete Wende der Ereignisse. Die Geschichte der Psychedelika, die ich hier zusammengefasst habe, habe ich selbst nicht erlebt. Ich wurde 1955 geboren, in der Mitte des Jahrzehnts, in dem Psychedelika erstmals in die amerikanische Wissenschaft hineingeplatzt sind, aber erst als mein sechzigster Geburtstag allmählich in den Blick rückte, überlegte ich ernsthaft, zum ersten Mal LSD auszuprobieren. Aus dem Munde eines Babyboomers mag das unwahrscheinlich klingen, wie ein Versäumnis der Generationenpflicht. Doch ich war 1967 erst zwölf Jahre alt, so jung, dass ich mir des Sommers der Liebe oder des Acids in San Francisco nur schemenhaft bewusst war. Mit vierzehn war es mir nur möglich, nach Woodstock zu gelangen, wenn meine Eltern mich hinfuhren. Vieles von den 1960er Jahren erfuhr ich aus dem Time-Magazin. Als der Gedanke, LSD auszuprobieren, in meine bewusste Wahrnehmung trieb, hatte die Substanz in den Medien schon den Bogen geschlagen von psychiatrischer Wunderdroge über Sakrament der Gegenkultur zum Zerstörer jugendlicher Gehirne.
Ich muss in der Junior Highschool gewesen sein, als ein Wissenschaftler (wie sich herausstellte, fälschlicherweise) berichtete, LSD schädige die Chromosomen;4 die gesamten Medien und auch mein Lehrer in Gesundheitserziehung sorgten dafür, dass wir alles darüber erfuhren. Ein paar Jahre später startete der Fernsehmoderator Art Linkletter eine Kampagne gegen LSD, das er dafür verantwortlich machte, dass seine Tochter aus dem Fenster einer Wohnung in den Tod gesprungen war. Angeblich hatte die Substanz auch etwas mit den Manson-Morden zu tun. Als ich Anfang der 1970er Jahre aufs College ging, schien alles, was man über LSD hörte, der Abschreckung zu dienen. Bei mir wirkte das: Ich bin stärker von der moralischen Panik geprägt, die von LSD ausgelöst wurde, als von den psychedelischen 1960ern.
Ich hatte auch einen persönlichen Grund, Psychedelika zu meiden: eine überaus angstvolle Pubertät, nach der ich (und mindestens ein Psychiater) an meinem Verstand zweifelte. Als ich aufs College kam, fühlte ich mich stabiler, doch der Gedanke, meine geistige Gesundheit mit einer psychedelischen Droge aufs Spiel zu setzen, schien noch immer eine schlechte Idee zu sein.
Jahre später, als ich Ende zwanzig und beständiger war, probierte ich zwei-, dreimal Magic Mushrooms aus. Ein Freund hatte mir ein Einmachglas voll getrockneter, knubbeliger Psilocybes geschenkt, und bei ein paar unvergesslichen Gelegenheiten schluckten meine Freundin (und heutige Frau) Judith und ich zwei oder drei Stück, ließen eine kurze Welle der Übelkeit über uns ergehen und verbrachten dann vier, fünf interessante Stunden zusammen, die uns vorkamen wie eine wunderbar verschnörkelte Version der vertrauten Realität.
Psychedelikfans würden das wahrscheinlich als niederdosiges «ästhetisches Erlebnis» einstufen und nicht als vollendeten ichauflösenden Trip. Wir verabschiedeten uns jedenfalls nicht aus dem bekannten Universum und machten auch keine Erfahrung, die man als mystisch bezeichnen könnte. Aber es war wirklich interessant. Ganz besonders erinnere ich mich an die übernatürliche Lebhaftigkeit des Grüns im Wald und die Samtigkeit der hellgrünen Farne. Ich verspürte den starken Drang, splitternackt im Freien zu sein, möglichst weit weg von allem, was aus Metall oder Plastik war. Da wir allein auf dem Land waren, war all das machbar. Von einem weiteren Trip an einem Samstag im Riverside Park in Manhattan weiß ich nur noch, dass er bei Weitem nicht so angenehm und unbefangen verlief und wir zu viel Zeit dafür aufwendeten, uns zu fragen, ob die anderen Leute merkten, dass wir unter Drogen standen.
Damals wusste ich noch nicht, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Erfahrungen mit derselben Droge etwas Wichtiges und Spezielles über Psychedelika zeigte: den entscheidenden Einfluss von «Set» und «Setting». Set ist die Einstellung oder Erwartung, die man mitbringt, und Setting die Umgebung, in der die Erfahrung stattfindet. Im Gegensatz zu anderen Drogen haben Psychedelika selten zweimal die gleiche Wirkung, da sie nur verstärken, was schon im Kopf und außerhalb vorgeht.
Nach diesen beiden kurzen Trips stand das Pilzglas jahrelang unangetastet in unserer Speisekammer. Der Gedanke, einen ganzen Tag psychedelischer Erfahrung zu widmen, war inzwischen unvorstellbar. Wir arbeiteten zielstrebig an unseren Karrieren, und die Unmengen an Freizeit, die das College (oder die Arbeitslosigkeit) gewährt, waren nur noch eine Erinnerung. Inzwischen war eine ganz andere Droge verfügbar, die sich viel leichter in das Gefüge einer Manhattan-Karriere einbauen ließ: Kokain. Das schneeweiße Pulver ließ die verschrumpelten braunen Pilze schäbig, unberechenbar und zu anspruchsvoll erscheinen. Als wir an einem Wochenende die Küchenschränke reinigten, stießen wir auf das vergessene Glas und warfen es zusammen mit den aufgebrauchten Gewürzen und abgelaufenen Lebensmitteln in den Müll.
Dreißig Jahre später wünschte ich, ich hätte das nicht getan. Ich würde viel dafür geben, jetzt ein Einmachglas voll Magic Mushrooms zu haben. Inzwischen frage ich mich, ob diese bemerkenswerten Moleküle an junge Leute vielleicht verschwendet sind und uns später im Leben, wenn der Beton unserer geistigen Gewohnheiten und unseres Alltagsverhaltens ausgehärtet ist, mehr zu bieten haben. C. G. Jung hat mal geschrieben, es seien nicht die jungen Leute, sondern Menschen in mittlerem Alter, die eine «Erfahrung des Numinosen» zur Bewältigung der zweiten Hälfte ihres Lebens benötigen.
Als ich wohlbehalten in meinen Fünfzigern angelangt war, schien das Leben in geordneten, bequemen Bahnen zu verlaufen: eine lange, glückliche Ehe und eine ebenso lange befriedigende Karriere. Wie wir alle hatte ich eine Reihe ziemlich verlässlicher Algorithmen entwickelt, um mich, ob zu Hause oder auf der Arbeit, durchs Leben zu navigieren. Vermisste ich irgendwas? Mir fiel nichts ein – das heißt, bis ich von der neuen Forschung über Psychedelika erfuhr und mich fragte, ob ich das Potenzial dieser Substanzen als Mittel zum Verständnis und zur Veränderung des Bewusstseins vielleicht nicht erkannt hatte.
Die folgenden drei Punkte überzeugten mich davon, dass es sich so verhielt:
Im Frühling 20105 erschien in der New York Times eine Titelstory mit der Überschrift «Ärzte wenden sich wieder Halluzinogenen zu». Dort wurde berichtet, dass Forscher einigen Krebspatienten im Endstadium große Dosen Psilocybin – der Wirkstoff in Magic Mushrooms – verabreicht hatten, damit sie im Angesicht des Todes mit ihrer «existenziellen Not» fertig wurden.
Diese Experimente, die gleichzeitig an der Johns Hopkins, der UCLA und der New York University stattfanden, klangen nicht nur unwahrscheinlich, sondern verrückt. Konfrontiert mit einer Todesdiagnose, wäre das Allerletzte, was ich tun wollte, psychedelische Drogen einzunehmen – d. h. die Kontrolle über mein Denken aufzugeben und dann in diesem psychisch verletzlichen Zustand direkt in den Abgrund zu starren. Doch viele der Versuchspersonen berichteten, dass sie im Verlauf einer einzigen begleiteten psychedelischen «Reise» ihre Sichtweise auf ihren Krebs und die Aussicht zu sterben überdacht hätten. Mehrere von ihnen sagten, sie hätten die Angst vor dem Tod völlig verloren. Die Gründe, die für diese Veränderung angeführt wurden, waren faszinierend, aber schwer nachvollziehbar. «Menschen transzendieren die primäre Identifikation mit ihrem Körper, erleben einen ichfreien Zustand», wurde einer der Forscher zitiert. Sie «kehren mit einer neuen Perspektive und tief greifender Akzeptanz zurück».
Ich heftete den Artikel ab, bis Judith und ich ein, zwei Jahre später eine Dinnerparty in einem großen Haus in den Berkeley Hills besuchten und mit einem Dutzend Leuten an einem langen Tisch saßen, an dessen anderem Ende eine Frau über ihre LSD-Trips zu sprechen begann. Sie schien ungefähr in meinem Alter zu sein und war, wie ich erfuhr, eine bekannte Psychologin. Ich war anfangs in ein anderes Gespräch vertieft, aber sobald die Phoneme L-S-D herüberdrangen, musste ich (buchstäblich) die Hand ans Ohr legen und versuchen mich einzuschalten.
Zuerst dachte ich, sie krame eine aufpolierte Anekdote aus ihrer Collegezeit hervor. Aber dem war nicht so. Schon bald wurde klar, dass der fragliche LSD-Trip erst wenige Tage oder Wochen zuvor stattgefunden hatte und tatsächlich einer ihrer ersten war. Die Stirnen der Versammelten kräuselten sich. Sie und ihr Mann, ein pensionierter Software-Entwickler, hatten den gelegentlichen Gebrauch von LSD geistig stimulierend gefunden und betrachteten ihn als wertvoll für ihre Arbeit. Insbesondere hatte die Psychologin das Gefühl, LSD verschaffe ihr ein Verständnis davon, wie kleine Kinder die Welt sehen. Die Wahrnehmungen von Kindern würden nicht durch Erwartungen und Konventionen im Dort-gewesen-das-getan-Stil der Erwachsenen vermittelt; als Erwachsene, erklärte sie, nähmen wir die Welt nicht einfach auf, wie sie sei, sondern stellten fundierte Vermutungen darüber an. Sich auf diese Vermutungen, die auf früheren Erfahrungen beruhen, zu verlassen, erspart dem Geist Zeit und Energie, zum Beispiel wenn er herauszufinden versucht, was dieses fraktale Muster aus grünen Punkten in seinem Blickfeld sein könnte. (Wahrscheinlich die Blätter an einem Baum.) LSD scheine solche konventionalisierten, vereinfachenden Wahrnehmungsweisen außer Kraft zu setzen und unserer Erfahrung der Realität eine kindliche Unmittelbarkeit und Unbefangenheit zurückzugeben, als würden wir alles zum ersten Mal sehen. (Blätter!)
Ich meldete mich zu Wort, um zu fragen, ob sie vorhabe, darüber zu schreiben, woraufhin sich die gesamte Aufmerksamkeit am Tisch mir zuwandte. Sie lachte und warf mir einen Blick zu, der offenbar sagte: Wie naiv kann man denn sein? LSD ist eine Schedule-One-Substanz, das heißt, der Staat betrachtet es als Rauschmittel ohne anerkannten medizinischen Nutzen. Natürlich wäre es für jemanden in ihrer Position töricht, in gedruckter Form anzudeuten, dass Psychedelika irgendetwas zu Philosophie oder Psychologie beisteuern, dass sie für die Erforschung der Rätsel des menschlichen Bewusstseins wirklich ein wertvolles Hilfsmittel sein könnten. Die seriöse Forschung über Psychedelika war vor ungefähr fünfzig Jahren, kurz nachdem Timothy Learys Harvard Psilocybin Project 1963 die Segel strich, aus den Universitäten verbannt worden. Anscheinend war nicht einmal Berkeley bereit, sich wieder damit zu beschäftigen, zumindest noch nicht.
Dritter Punkt: Das Tischgespräch rief mir vage ins Gedächtnis, dass mir vor ein paar Jahren jemand per E-Mail eine wissenschaftliche Arbeit über Psilocybin-Forschung geschickt hatte. Da ich damals mit etwas anderem beschäftigt gewesen war, hatte ich den Anhang nicht mal geöffnet, doch eine Schnellsuche mit dem Begriff «Psilocybin» fischte die Arbeit sofort aus dem virtuellen Stapel abgelegter E-Mails in meinem Computer. Die Arbeit war mir von Bob Jesse, einem der Co-Autoren, zugeschickt worden, dessen Name mir nichts sagte; vielleicht hatte er etwas gelesen, das ich über psychoaktive Pflanzen geschrieben hatte, und dachte, ich könnte daran interessiert sein. Der Artikel, den dasselbe Team an der Hopkins University verfasst hatte, das Krebspatienten Psilocybin verabreichte, war in der Zeitschrift Psychopharmacology veröffentlicht worden. Für eine von Fachkollegen geprüfte wissenschaftliche Publikation hatte die Arbeit einen äußerst ungewöhnlichen Titel: «Psilocybin kann mystischartige Erfahrungen auslösen, die eine wesentliche und nachhaltige persönliche Bedeutung und spirituelle Aussagekraft haben.»6 Das Wort «Psilocybin» tut nichts zur Sache; es waren die Worte «mystisch», «spirituell» und «Bedeutung», die auf den Seiten einer pharmakologischen Zeitschrift ins Auge sprangen. Der Titel wies auf eine interessante Grenzlinie der Forschung hin und überbrückte zwei Welten, die wir im Allgemeinen für unvereinbar halten: Wissenschaft und Spiritualität.
Jetzt stürzte ich mich fasziniert auf die Hopkins-Arbeit. Man hatte dreißig Versuchspersonen, die noch nie Psychedelika genommen hatten, eine Pille verabreicht, die entweder eine synthetische Version von Psilocybin oder ein «aktives Placebo» – Methylphenidat oder Ritalin – enthielt, um ihnen weiszumachen, sie hätten ein Psychedelikum erhalten. Dann legten sie sich mit Schlafmaske auf ein Sofa und hörten sich im Beisein von zwei Therapeuten über Kopfhörer Musik an. (Die Schlafmaske und die Kopfhörer fördern eine mehr nach innen gerichtete Reise.) Nach etwa dreißig Minuten begannen sich im Kopf der Probanden, die die Psilocybin-Pille erhalten hatten, außergewöhnliche Dinge abzuspielen.
Die Studie zeigte, dass eine hohe Dosis Psilocybin gefahrlos eingenommen werden konnte und zuverlässig eine mystische Erfahrung «auslöste» – die den Schilderungen zufolge typischerweise die Auflösung des eigenen Ichs beinhaltete, gefolgt von dem Gefühl, mit der Natur oder dem Universum zu verschmelzen. Das dürfte für Leute, die psychedelische Drogen nehmen, und für die Forscher, die sich in den 1950er und 1960er Jahren damit beschäftigten, nichts Neues sein. Aber als die Arbeit 2006 veröffentlicht wurde, war es weder der modernen Wissenschaft noch mir selbst klar.
An den im Artikel dokumentierten Ergebnissen war am erstaunlichsten, dass die Probanden ihr Psilocybin-Erlebnis als eine der bedeutendsten Erfahrungen ihres Lebens einstuften, vergleichbar «mit der Geburt des ersten Kindes oder dem Tod eines Elternteils». Zwei Drittel der Teilnehmer zählten die Sitzung zu den fünf «spirituell bedeutendsten Erfahrungen» ihres Lebens; für ein Drittel war es die bedeutendste. Vierzehn Monate später hatte sich diese Einschätzung nur unwesentlich verändert. Die Probanden berichteten von erheblichen Verbesserungen in ihrem «persönlichen Wohlbefinden, der Lebenszufriedenheit und positiver Verhaltensänderung», was von ihren Familienangehörigen und Freunden bestätigt wurde.
Auch wenn es damals noch niemand wusste, die Renaissance der Psychedelik-Forschung, die inzwischen im Gange ist, begann mit der Veröffentlichung dieser Arbeit. Sie führte direkt zu einer Reihe von Studien – an der Hopkins und mehreren anderen Universitäten –, bei denen Psilocybin zur Behandlung verschiedener Indikationen eingesetzt wurde, darunter Ängste und Depressionen bei Krebspatienten, Nikotin- und Alkoholsucht, Zwangsneurosen, Depressionen und Essstörungen.
Das Erstaunliche an diesem ganzen Forschungsstrang ist die Prämisse, dass nicht die pharmakologische Wirkung der Droge, sondern die Art der geistigen Erfahrung, die von ihr ausgelöst wird – darunter auch die zeitweilige Auflösung des eigenen Ichs –, der Schlüssel zur Veränderung im Denken der Patienten sein dürfte.
Da ich mir nicht sicher war, auch nur eine einzige «spirituell bedeutende» Erfahrung gemacht zu haben, geschweige denn so viele, dass ich eine Rangfolge erstellen konnte, merkte ich, dass die Arbeit von 2006 meine Neugier, aber auch meine Skepsis weckte. Viele der Versuchspersonen schilderten, sie hätten Zugang zu einer alternativen Realität bekommen, einem «Jenseits», in dem die gewohnten physikalischen Gesetze nicht gelten und verschiedene Erscheinungsformen kosmischen Bewusstseins oder einer Göttlichkeit sich als unverkennbar real präsentieren.
All das fand ich schwer hinnehmbar (konnte es nicht einfach eine durch Drogen verursachte Halluzination sein?), zugleich aber faszinierend; irgendwie wollte ich, dass es stimmte, egal was «es» genau war. Das überraschte mich, denn ich hatte mich nie für einen sonderlich spirituellen, geschweige denn mystizistischen Menschen gehalten. Das liegt wohl teils an meiner Weltanschauung, teils an meiner Gleichgültigkeit: Ich habe nie viel Zeit damit zugebracht, spirituelle Pfade zu erkunden, und wurde auch nicht religiös erzogen. Meine vorgegebene Sichtweise ist die eines gelassenen Materialisten, der glaubt, dass Materie der Grundstoff der Welt ist und die physikalischen Gesetze, denen sie gehorcht, imstande sein sollten, alles, was geschieht, zu erklären. Ich gehe von der Annahme aus, dass die Natur alles ist, was es gibt, und tendiere zu wissenschaftlichen Erklärungen der Phänomene. Vor diesem Hintergrund bin ich auch empfänglich für die Begrenztheit der wissenschaftlich-materialistischen Perspektive und glaube, dass die Natur (der menschliche Geist inbegriffen) noch tiefe Geheimnisse birgt, gegenüber denen die Wissenschaft manchmal überheblich und ungerechtfertigt abweisend zu sein scheint.
War es möglich, dass eine einzige psychedelische Erfahrung – die auf nichts anderem beruhte als der Einnahme einer Pille oder eines Stücks Löschpapier – eine große Delle in solch eine Weltanschauung machte? Die eigene Meinung über die Vergänglichkeit korrigierte? Das eigene Denken tatsächlich dauerhaft veränderte?
Der Gedanke ließ mich nicht los. Es war fast so, als bekäme man eine Tür in einem vertrauten Zimmer gezeigt – dem Zimmer des eigenen Geistes –, die einem vorher nie aufgefallen ist, als würden Menschen, zu denen man Vertrauen hat (Wissenschaftler!), einem sagen, dass auf der anderen Seite eine ganz andere Art des Denkens – des Seins! – wartet. Man musste bloß den Türknauf drehen und eintreten. Wer wäre da nicht neugierig? Mag sein, dass ich mein Leben nicht ändern wollte, doch der Gedanke, etwas Neues darüber zu lernen und ein neues Licht auf diese alte Welt zu richten, begann meinen Geist zu beschäftigen. Vielleicht fehlte wirklich etwas in meinem Leben, etwas, das ich bloß nicht benannt hatte.
Ich wusste schon etwas über solche Türen, da ich zu einem früheren Zeitpunkt meiner Karriere über psychoaktive Pflanzen geschrieben hatte. In Die Botanik der Begierde habe ich mich ausführlich mit Bewusstseinsveränderung befasst, und zu meiner Überraschung stellte diese sich als universelles menschliches Verlangen heraus. Es gibt auf der Erde keine Kultur (nun ja, eine einzige*), die nicht bestimmte Pflanzen benutzt, um die Inhalte des Denkens zu verändern, ob zur Heilung, aus Gewohnheit oder als spirituelle Praxis. Dass ein so seltsames, scheinbar fehlangepasstes Verlangen neben unserem Verlangen nach Nahrung, Schönheit oder Sex – die evolutionär gesehen alle offenbar sinnvoller sind – existieren sollte, schrie nach einer Erklärung. Die einfachste war, dass diese Substanzen Schmerzen und Langeweile lindern. Doch die intensiven Gefühle und aufwendigen Tabus und Rituale, die viele dieser psychoaktiven Arten umgeben, deuten darauf hin, dass es um mehr gehen muss.
Bei uns Menschen wurden, wie ich gelernt habe, Pflanzen und Pilze, die das Potenzial haben, unser Bewusstsein radikal zu verändern, lange und weitverbreitet zur Heilung des Geistes, bei Übergangsriten und der Kommunikation mit der übernatürlichen Welt oder dem Geisterreich eingesetzt. Diese Verwendungen waren in sehr vielen Kulturen uralt und geschätzt, doch ich habe eine weitere Nutzung angedeutet: die Bereicherung der kollektiven Vorstellungswelt – der Kultur – mit den neuen Ideen und Visionen, die wenige Auserwählte von ihren «Reisen» mitbringen.
Jetzt, da ich eine intellektuelle Wertschätzung für den potenziellen Wert dieser psychoaktiven Substanzen entwickelt hatte, könnte man denken, ich wäre begieriger gewesen, sie auszuprobieren. Ich weiß nicht genau, worauf ich gewartet habe; auf Mut vielleicht oder auf die passende Gelegenheit, die ein arbeitsreiches, überwiegend gesetzestreues Leben nie zu bieten schien. Aber als ich den potenziellen Nutzen, von dem ich hörte, gegen die Risiken abwog, lernte ich zu meiner Überraschung, dass Psychedelika bei Weitem nicht so gefährlich sind, um sich dermaßen davor fürchten zu müssen. Viele der allbekannten Gefahren sind übertrieben oder frei erfunden. Es ist beispielsweise so gut wie unmöglich, an einer Überdosis LSD oder Psilocybin zu sterben, und keine der beiden Drogen macht süchtig. Wenn Tiere die Drogen einmal probiert haben, streben sie es kein zweites Mal an, und beim Menschen beraubt sie wiederholter Gebrauch ihrer Wirkung.* Es stimmt, dass die furchterregenden Erfahrungen, die manche Menschen auf Psychedelika machen, bei entsprechender Disposition Psychosen auslösen können, weshalb niemand, der familiär vorbelastet ist oder eine Veranlagung zu psychischen Erkrankungen hat, diese Substanzen einnehmen sollte. Allerdings sind Einlieferungen in die Notaufnahme wegen Psychedelikakonsums äußerst selten, und viele der Fälle, die von Ärzten als Psychosen diagnostiziert werden, stellen sich als vorübergehende Panikattacken heraus.7
Es stimmt ebenfalls, dass Menschen auf Psychedelika zu gefährlichen Dummheiten neigen: Sie betreten verkehrsreiche Straßen, fallen irgendwo herunter oder begehen in seltenen Fällen Selbstmord. «Horrortrips» sind sehr real und können laut einer großen Umfrage unter Konsumenten psychedelischer Drogen, in der die Leute zu ihren Erlebnissen befragt wurden, eine der «schlimmsten Erfahrungen des Lebens» sein.* Es ist jedoch wichtig, zwischen dem zu unterscheiden, was passieren kann, wenn diese Drogen unbeaufsichtigt eingenommen werden, ohne auf Set und Setting zu achten, und dem, was unter klinischen Bedingungen, nach sorgfältiger Untersuchung und unter Aufsicht, passiert. Seit der Wiederaufnahme genehmigter Psychedelik-Forschung in den 1990er Jahren bekamen knapp tausend Versuchspersonen die Substanzen verabreicht, und kein einziger ernsthafter Zwischenfall wurde gemeldet.8
Um diese Zeit kam mir der Gedanke, «die Schneekugel zu schütteln», wie ein Neurowissenschaftler die psychedelische Erfahrung beschrieb, allmählich eher verlockend als beängstigend vor, auch wenn die Angst nicht völlig verschwand.
Nach mehr als einem halben Jahrhundert einer ziemlich beständigen Gemeinschaft wird das eigene Ich – diese allgegenwärtige, unaufhörlich kommentierende, interpretierende, abstempelnde, verteidigende Stimme im Kopf – vielleicht etwas zu vertraut. Ich rede hier nicht von etwas so Tiefgehendem wie Selbsterkenntnis. Nein, nur davon, wie wir im Lauf der Zeit unsere Reaktionen auf das, was das Leben bringt, optimieren und konventionalisieren. Jeder von uns entwickelt solche vereinfachenden Wege, alltägliche Erfahrungen einzuordnen und zu verarbeiten oder Probleme zu lösen, und obwohl das zweifellos eine Anpassungsleistung ist – es hilft uns, unsere Aufgaben ohne viel Aufhebens zu erledigen –, wird es irgendwann mechanisch. Es stumpft uns ab. Die Muskeln der Aufmerksamkeit verkümmern.
Gewohnheiten sind unbestreitbar nützliche Hilfsmittel, die uns von der Notwendigkeit befreien, jedes Mal eine komplexe geistige Tätigkeit auszuführen, wenn wir vor einer neuen Aufgabe oder Situation stehen. Doch sie befreien uns auch von der Notwendigkeit, der Welt gegenüber wach zu bleiben: daran teilzunehmen, zu fühlen, zu denken und dann wohlüberlegt zu handeln. (Das heißt, eher aus freiem Willen als unter Zwang.) Um sich ins Gedächtnis zu rufen, wie sehr geistige Gewohnheiten uns blind gegenüber Erfahrungen machen, muss man bloß in ein fremdes Land reisen. Plötzlich wacht man auf! Und die Algorithmen des täglichen Lebens fangen gewissermaßen bei null an. Das ist der Grund, warum die verschiedenen Reisemetaphern für die psychedelische Erfahrung so treffend sind. So nützlich die Effizienz des erwachsenen Geistes auch sein mag, sie macht uns blind für den gegenwärtigen Augenblick. Wir springen ständig zur nächsten Sache. Wir behandeln Erfahrungen wie ein Programm künstlicher Intelligenz (KI), denn unser Gehirn übersetzt ständig Daten aus der Gegenwart in Begriffe der Vergangenheit, sucht dort nach der maßgeblichen Erfahrung und benutzt diese, um möglichst gut einzuschätzen, wie man die Zukunft vorhersagt und bewältigt.
Eins der Dinge, das für Reise, Kunst, Natur, Arbeit und bestimmte Drogen spricht, ist die Art, wie diese Erfahrungen im günstigsten Fall jeden geistigen Pfad in Vergangenheit und Zukunft abriegeln und uns in den Strom der Gegenwart tauchen, der wahrhaft erstaunlich ist – denn Staunen ist die Nebenwirkung des unbelasteten ersten oder jungfräulichen Blicks, dem sich das erwachsene Gehirn verschlossen hat. (Das ist so ineffizient!) Wenn ich meine Zeit in der nahen Zukunft verbringe, ist mein psychisches Thermostat leider Gottes größtenteils auf ein niedriges Simmern von Erwartung und allzu oft auf Sorge eingestellt. Das Gute ist, ich werde nur selten überrascht. Was wiederum zugleich das Schlechte ist.
Was ich hier zu beschreiben versuche, ist die Voreinstellung meines Bewusstseins. Sie funktioniert recht gut, erledigt alle Aufgaben, aber was, wenn sie nicht die einzige oder zwangsläufig beste Art ist, durchs Leben zu gehen? Die Prämisse der Psychedelik-Forschung ist, dass diese spezielle Gruppe von Molekülen uns Zugang zu anderen Bewusstseinsformen verschaffen kann, die uns spezielle Vorteile bringen könnten, ob therapeutischer, spiritueller oder kreativer Natur. Psychedelika sind bestimmt nicht die einzige Tür zu diesen anderen Bewusstseinsformen – ich erforsche in diesem Buch auch nichtpharmakologische Alternativen –, doch an diesem Knopf lässt sich offenbar am leichtesten drehen.
Der Gedanke, das Repertoire unserer Bewusstseinszustände zu erweitern, ist keine völlig neue Idee – Hinduismus und Buddhismus sind davon durchdrungen, und auch in der westlichen Wissenschaft gibt es faszinierende Beispiele. William James, der wegweisende amerikanische Psychologe und Autor von Die Vielfalt religiöser Erfahrung, wagte sich schon vor mehr als einem Jahrhundert in diese Welt. Er kehrte mit der Überzeugung zurück, dass unser normales Wachbewusstsein «nur ein besonderer Typ von Bewußtsein ist, während um ihn herum, von ihm durch den dünnsten Schirm getrennt, mögliche Bewußtseinsformen liegen, die ganz andersartig sind».9
Mir war klar, dass James von den ungeöffneten Türen in unserem Denken spricht. Für ihn war Lachgas der «Kontakt», der die Tür aufstoßen und die Welt auf der anderen Seite enthüllen konnte. (Meskalin, die psychedelische Substanz, die aus dem Peyote-Kaktus gewonnen wird, stand den Forschern damals bereits zur Verfügung, doch James hatte offenbar zu große Angst, es auszuprobieren.)
«Keine Betrachtung des Universums kann abschließend sein, die diese anderen Bewußtseinsformen ganz außer Betracht läßt.10 Auf jeden Fall», folgerte James, verböten diese anderen Zustände, deren Existenz er für so real wie die Tinte auf dieser Seite hielt, «einen voreiligen Abschluß unserer Rechnung mit der Realität».11
Als ich diese Sätze zum ersten Mal las, begriff ich, dass James mich durchschaute: Als überzeugter Materialist und Erwachsener in einem gewissen Alter hatte ich meine Rechnung mit der Realität abgeschlossen. Vielleicht war das voreilig gewesen. Tja, hier war die Aufforderung, sie wieder aufzumachen.
Wenn das normale Wachbewusstsein nur eine von mehreren möglichen Arten ist, eine Welt zu konstruieren, dann ist es vielleicht sinnvoll, eine größere neuronale Vielfalt auszubilden. In diesem Sinne nähert sich Verändere dein Bewusstsein dem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und setzt verschiedene Darstellungsformen ein: Gesellschafts- und Wissenschaftsgeschichte, Naturkunde, Memoir, Wissenschaftsjournalismus und Fallstudien von Versuchspersonen und Patienten. In der Mitte der Reise liefere ich einen Bericht von meiner eigenen Erkundung (oder vielleicht sollte ich Suche sagen) in Form einer geistigen Reisebeschreibung.
Bei der Schilderung der Geschichte der Psychedelik-Forschung in Vergangenheit und Gegenwart versuche ich nicht, umfassend zu sein. Das Thema Psychedelika als Gegenstand der Wissenschaft und der Gesellschaftsgeschichte ist zu umfangreich, um zwischen die Deckel eines einzigen Buchs zu passen. Statt zu versuchen, den Leser mit all den Menschen bekannt zu machen, die für die Psychedelik-Renaissance verantwortlich sind, konzentriert sich meine Schilderung auf eine kleine Anzahl von Pionieren, die eine bestimmte wissenschaftliche Linie vertreten, mit dem unvermeidlichen Resultat, dass die Beiträge vieler anderer nur kurz abgehandelt werden. Und im Interesse einer stringenten Erzählung habe ich mich auf bestimmte Drogen konzentriert und andere ausgeschlossen. MDMA (auch bekannt als Ecstasy), das bei der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen vielversprechende Ergebnisse zeigt, kommt hier beispielsweise kaum vor. Manche Forscher zählen MDMA zu den Psychedelika, die meisten jedoch nicht, und darin folge ich ihnen. MDMA wirkt im Gehirn auf andere Weise und hat im Wesentlichen einen anderen gesellschaftlichen Hintergrund als die sogenannten klassischen Psychedelika. Von diesen konzentriere ich mich vornehmlich auf die Substanzen, denen die Wissenschaft die größte Aufmerksamkeit widmet – Psilocybin und LSD –, das heißt, dass andere Psychedelika, die ebenso interessant und wirksam, aber im Labor schwieriger zu testen sind – wie beispielweise Ayahuasca –, weniger Aufmerksamkeit erhalten.
Ein letztes Wort zu Fachausdrücken. Der Klasse von Molekülen, zu der Psilocybin und LSD (sowie Meskalin, DMT und eine Handvoll andere) gehören, wurden seit ihrem Bekanntwerden viele Namen gegeben. Anfangs wurden sie Halluzinogene genannt. Doch sie haben so viele andere Eigenschaften (und richtiggehende Halluzinationen sind eher ungewöhnlich), dass die Forschung schon bald nach präziseren, aussagekräftigeren Begriffen suchte, wie ich im dritten Kapitel ausführe. Der Begriff «Psychedelika», den ich größtenteils verwende, hat seine Nachteile.12 In den 1960er Jahren bereitwillig angenommen, schleppt der Begriff den unseligen Ballast der Gegenkultur mit sich herum. In der Hoffnung, diesen Assoziationen zu entkommen und die spirituelle Dimension dieser Drogen hervorzuheben, haben einige Forscher vorgeschlagen, sie stattdessen «Entheogene» zu nennen – was im Griechischen «das Göttliche im Innern» heißt. Das erscheint mir zu hochgestochen. Trotz der 1960er-Jahre-Symbolik ist der 1956 geprägte Begriff «Psychedelikum» etymologisch korrekt. Abgeleitet aus dem Griechischen, bedeutet es einfach «den Geist offenbarend» – und genau das bringen diese außergewöhnlichen Moleküle zustande.
* Die Inuit scheinen die Ausnahme zu sein, die die Regel bestätigt, aber nur weil dort, wo sie leben, keine psychoaktiven Pflanzen wachsen. (Zumindest noch nicht.)
* David J. Nutt: Drugs Without the Hot Air: Minimising the Harms of Legal and Illegal Drugs. Cambridge, U.K.: UIT 2012. Das ist der der Grund, warum Leute, die Psychedelika «mikrodosieren», sie nie an aufeinanderfolgenden Tagen nehmen.
* Theresa M. Carbonaro et al.: «Survey Study of Challenging Experiences After Ingesting Psilocybin Mushrooms: Acute and Enduring Positive and Negative Consequences.» In: Journal of Psychopharmacology (2016), S. 1268–1278. Die Umfrage ergab, dass 7,6% der befragten Personen sich wegen «eines oder mehrerer psychologischer Symptome, die sie ihrer schlimmen Psilocybin-Erfahrung zuschrieben», in Behandlung begaben.