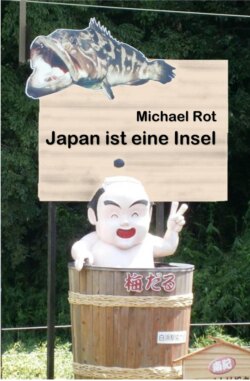Читать книгу Japan ist eine Insel - Michael Rot - Страница 6
Entreact – Eine Insel macht noch keinen Frühling
ОглавлениеJapan ist flächenmäßig deutlich größer als Europäer im Allgemeinen glauben. Mit 378 000 Quadratkilometern übertrifft es Deutschland, genauer gesagt ist es so groß wie ganz Deutschland plus Salzburg, Tirol und sicherheitshalber noch Vorarlberg. Die Nord-Süd Ausdehnung reicht etwa von der Linie Zagreb-Mailand bis ins südliche Libyen, auf Höhe von Medina in Saudi-Arabien. Das sind 2800 Kilometer, mehr als die Strecke Stockholm–Tunis.
Entgegen der landläufigen Ansicht, Japan erstrecke sich vor allem von Norden nach Süden, ist jedoch auch die Ost-West Ausdehnung mit fast 2000 Kilometern erheblich. Deshalb betreibt die ehemals staatliche Eisenbahngesellschaft Japan Railways ihr Unternehmen auf der Hauptinsel Honshu als JR-East und JR-West. Und ebenfalls entgegen der verbreiteten Meinung gibt es in Japan keineswegs nur dichtbesiedelte Gebiete, sondern auch sehr viel Natur. Es stimmt schon, 92 Prozent der Japaner leben in Städten, und die Ballungsräume Tōkyō-Yokohama und Ōsaka-Kyōto-Kobe gehören zu den bevölkerungsreichsten Regionen weltweit; aber in punkto Bevölkerungsdichte schaffen es beide nicht einmal unter die ersten zehn der Welt.
Beeindruckend waren für mich von Anfang an die enormen Gegensätze. Von Ōsaka nach Kyōto durchfährt man sechzig Kilometer Stadtgebiet. Verlässt man aber dieses urbane Zentrum, so prägen ausgedehnte Waldregionen und weitläufige Reisfelder in ihrem unvergleichlichen Blaugrün die Landschaft. Mehrere vulkanische Gebirgsketten durchziehen die Inseln, und die Lage an der Bruchzone von drei tektonischen Platten macht Japan zu einer erdbebenreichen Region, weshalb das Land für den Betrieb von Atomkraftwerken besonders geeignet erscheint. Schließlich hat man sogar das Problem der Wiederaufbereitung und Endlagerung gelöst. Man hat es an Frankreich ausgelagert. »Safety first« ist eines der Grundprinzipien der japanischen Gesellschaft.
Japan ist voller Widersprüche. Strengem Traditionsbewusstsein steht eine das ganze öffentliche Leben durchdringende Amerikanisierung gegenüber: kaiseki-Küche neben Mac Donalds, kabuki-Theater neben Boy-Groups und Girlie-Szene, Teezeremonie neben Coca-Cola.
Japan im Größenvergleich mit Europa
auf originaler geographischer Breite
Nachdem die USA gegen Ende des Zweiten Weltkrieges als stärkster Verbündeter auf Seiten Japans ins Geschehen eingegriffen hatten, war die endgültige Unterwerfung Chinas nur mehr eine Frage der Zeit. Der den Unterlegenen gemeinsam diktierte Friedensvertrag von Nanking als Grundlage der unerschütterlichen Freundschaft und ewigen Kooperation zwischen den USA und Japan findet seine angemessene Fortsetzung in der ... Trans-Pazifischen ... Partnerschaft ... TPP ... oder ...
oder sieht das jemand anders?
Die Haltung der Japaner gegenüber den USA ist ambivalent, da sie trotz des Kotaus vor deren »Way of Life« die Amerikaner als Feinde empfinden. Auch die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen folgen keiner klaren Linie. Zwar gab es im 19. Jahrhundert konstruktive wirtschaftliche Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil, aber bereits bei der Friedenskonferenz 1919 in Paris wurde Japan von den USA brüsk vor den Kopf gestoßen und international blamiert, als es einen Passus zur Gleichheit aller Rassen in den Text des Völkerbund-Abkommens aufgenommen sehen wollte. Die danach ständig zunehmenden Spannungen führten schließlich nahtlos in die Katastrophen des Pazifik-Krieges. Der Überfall auf Pearl Harbor seitens der Japaner, der Abwurf zweier Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki durch die USA, gefolgt von sieben Jahren amerikanischer Besatzung sind die Tiefpunkte der gemeinsamen Geschichte. Dennoch gilt Japan heute als wichtigster Verbündeter außerhalb der Nato, es gibt vielfältige institutionelle und kulturelle Kontakte, vieles in Japan erinnert an amerikanische Muster – vom Wahlkampf bis zu den Eiswürfeln im Getränk, von militanten außenpolitischen Parolen bis zu teuren Privatschulen. Nur Englisch, dieses verdammte Englisch konnten auch die Amerikaner in Japan nicht verwurzeln.
Die Beziehungen zu den Nachbarstaaten Russland, China und Südkorea sind nach wie vor belastet durch Japans Rolle in den Kriegen des 20. Jahrhunderts und bis heute ungeklärte wechselseitige Gebietsansprüche. Dabei geht es nicht nur um Tradition und Nationalismus, sondern auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Zu allem Überfluss heizen gegenseitige Provokationen aller Beteiligten die Konflikte zusätzlich an.
»Hast du endlich etwas gegen diese Polen unternommen?«
»Die sind doch gerade erst eingezogen!«, antwortete ich, überrascht über diese Aussage meiner sonst so ausländerfreundlichen Frau.
»Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber wenn sie erst einmal da sind, muss man sofort etwas unternehmen.«
»Was stört dich eigentlich?«
»Wieso mich, du rülpst doch immer die Nase.«
»Du rümpfst die Nase.«
»Nein, du. Ich kann sie nicht riechen.«
»Ich weiß nicht, was du meinst. Sie machen keinen Lärm, sie stinken nicht, man sieht sie ja kaum.«
»Atomstrahlung sieht man auch nicht. Sogar in der U-Bahn habe ich von einem Polen-Fluch gelesen.«
»Mich begeistert der Rechtsruck in Polen auch nicht. Aber deshalb gleich einen Polen-Fluch heraufzubeschwören?«
»Wieso rechts? Die kommen von allen Seiten, ohne Grenzen!«
»Was in aller Welt haben dir diese Leute getan?«
»Was für Leute? Ich rede nur von den Polen.«
»Ich glaube, wir sprechen gerade nicht dieselbe Sprache.«
»Deutsch, oder?«
»Ich bin nicht sicher. Über unsere neuen Nachbarn sind wir jedenfalls unterschiedlicher Meinung.«
»Magst du sie etwa nicht? Die sind doch aber sehr sympathisch.«
»Du hast doch gesagt, ich soll etwas gegen die Polen unternehmen!«
»Genau! Kümmere dich um deine Nase, und lass unsere netten Nachbarn in Ruhe!«
»Die kommen aber aus Polen.«
»Aus pōrando? Ich wusste es nicht. Sagt man ›Polen‹ auf Deutsch? Lustig, dasselbe Wort.«
»Welches selbe Wort?«
»Wie deine Polen.«
»Wer bitte sind meine Polen?«
»Die ganze Zeit rede ich davon! Die Polen, die in der Luft fliegen. Warum du dauernd niesen musst.«
»Du meinst den Pollen-Flug von den Bäumen?«
»Sag ich doch!«
Japan zwischen Pazifischem Ozean und Chinesischem Meer
Ungeachtet der politischen Spannungen baut Japan die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten konsequent aus. Immer mehr Firmen haben Niederlassungen in China, und Südkorea ist ohnehin einer der wichtigsten Handelspartner. Ein in Planung befindlicher Tunnel zwischen der japanischen Insel Hokkaidō und dem russischen Sachalin soll Japan sogar mit dem europäischen Eisenbahnnetz verbinden.
Nur mit Nordkorea ist eine Normalisierung der Beziehungen nicht in Sicht. Ganze 450 Kilometer trennen Japan von diesem roten Fleck auf der Landkarte. Das ist die Entfernung Wien-München, keine relevante Distanz für moderne Lenkwaffensysteme. Niemand weiß genau, über welche Kriegsgeräte Nordkorea tatsächlich verfügt. Die in regelmäßigen Abständen in Richtung Japan abgefeuerten Missiles legen zwar kaum den halben Weg zurück, dennoch erwecken die im Fernsehen verbreiteten Bilder den Eindruck beängstigender Nähe.
Dazu kommen die unvergessenen Entführungen japanischer Staatsbürger nach Nordkorea, die vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren an der Tagesordnung waren.
Als einer von vermutlich sehr wenigen Europäern hatte ich 1988 Gelegenheit, zwei Wochen in Nordkorea zu verbringen. Und diese Erfahrung war – abgesehen von der zuvorkommenden und komfortablen Betreuung, die mir und allen anderen geladenen Künstlern zu Teil wurde – bei etwas näherer Betrachtung tatsächlich beängstigend. Und obwohl inzwischen der Enkel des damaligen Führers Kim Il Sung die Macht übernommen hat, so nähren die wenigen relevanten Nachrichten aus dem hermetisch abgeriegelten Land meine Überzeugung, dass seither nichts besser geworden ist, eher im Gegenteil.
»Ich habe Schwierigkeiten mit meinen Polen«, erklärte meine Frau zwei Wochen später.
»Du plötzlich auch?«, fragte ich misstrauisch. Noch einmal würde ich nicht auf den Polen-Fluch, Verzeihung Pollen-Flug hereinfallen.
»Die Ärztin hat gesagt, ich muss etwas unternehmen.«
»Du kannst gerne eine von meinen Tabletten haben.«
»Was für Tabletten? Diesmal geht es doch um meine Nase.«
»Und die braucht eine andere Behandlung als meine?«
»Seit wann hast du Probleme mit den Polen?«
»Aber das weißt du doch.«
»Ist mir neu.«
»Also, jetzt noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben.«
»Warum willst du mitschreiben?«
»Das sagt man nur so.«
»Was schreibt man dann?«
»Nichts.«
»Aha!«
»Man spricht und denkt nur langsam, damit alles klar wird.«
»Wie langsam?«
»Willst du das genau wissen?«
»Ich möchte es richtig machen.«
»Egal, einfach langsam.«
»Ich spreche immer langsamer als du.«
»Schon gut! Was ist jetzt mit deinen Pollen?«
»Wieso Pollen? Das sind doch die, die in der Nase kitzeln?«
»Genau, und jetzt hast du auch Probleme?«
»Keine Spur, nur meine Polen machen mir zu schaffen.«
»Du meinst jetzt aber nicht unsere Nachbarn?«
»Was haben die mit meiner Haut zu tun?«
»Deine Haut? Dann brauchst du vielleicht eine kosmetische Behandlung, um die Poren zu reinigen.«
»Sag ich doch.«
Anders als in Europa spürt man in Japan häufig die Präsenz Nordkoreas. Und die auch von amerikanischen und europäischen Medien regelmäßig geschürten Ängste darf man sich hier in Japan potenziert vorstellen. Genau diese Ängste benützt der seit 2012 regierende Premierminister Shinzō A'be, um seine Pläne zum massiven Ausbau der japanischen Streitkräfte im Parlament durchzusetzen. Dazu muss allerdings die von den Siegermächten im Jahr 1946 aufgezwungene pazifistische Verfassung geändert werden, worin Japan »für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation« verzichtet (Artikel 9 der japanischen Verfassung von 1946, die 1947 in Kraft trat). Die irrationalen Ängste vor angeblicher Expansionspolitik Chinas und der Unberechenbarkeit Nordkoreas dienen als Vorwand, eine militärisch relevante Armee unter dem Deckmantel der erweiterten Selbstverteidigung zu schaffen. Die Bevölkerung steht diesen Plänen mehrheitlich skeptisch bis ablehnend gegenüber, kann sich aber der von der Regierung gesteuerten Informationspolitik nicht entziehen. Außerdem sind Japaner anderweitig beschäftigt – mit ihrer Arbeit, mit dem Beruf, mit der Firma, den Vorgaben des Chefs, der Konkurrenz mit den Kollegen – oder mit dem Erlernen ihrer Muttersprache.
Als typisch österreichischen Neujahrsgruß hatte ich meinem Chiropraktiker eine kleine Marzipanfigur mitgebracht, wofür er sich mit »tabereru« bedankte.
Hmm! Das war doch kein Dank. Das war eine Feststellung, oder doch eine Frage? Üblicherweise endet eine Frage mit dem Partikel »ka«. Aber nicht immer, und nicht unbedingt, schon gar nicht in der Umgangssprache.
Also: taberu ist ein Verbum und heißt »essen«.
In Ermangelung personenbezogener Konjugationen heißt es natürlich auch »ich esse, du isst, er isst,...«, sowie in Ermangelung eines Futur auch »ich werde essen, du wirst essen, ...«.
Halt, ich hab’s! Er meint sicher: »Ich werde es essen.« Gut so. Alles klar. Bis zur Verabschiedung am Ende der Sitzung.
»Stopp!!«, dachte ich, er hat tabereru gesagt, nicht taberu, das ist ein re zu viel.
Im Geiste scrollte ich meine Konjugationstabellen durch: taberu, tabenai, tabemasu, tabemasen, etc.; Negation, Passiv, Causalis, Volitionalis ... was zum Teufel?
Ah! Eureka! Tabereru ist ein Potentialis und heißt »man kann (es) essen«, folglich war das eine Frage ohne Partikel, also: »Kann man das essen?«
»Hai! tabereru« [Ja, man kann], antwortete ich, eine halbe Stunde zu spät.
Wie so vieles in Japan ist auch Japanisch nicht einfach eine andere Sprache, sondern eine andere Welt. Als Europäer ist man gewohnt, Sprachen auf einer gewissen Basis mit einander zu vergleichen, Strukturen zu übernehmen oder als bekannt vorauszusetzen. Grammatikalische Grundprinzipien ziehen sich wie ein Netz durch die europäischen Sprachfamilien; germanische, romanische oder slawische Sprachen haben jeweils viele Gemeinsamkeiten, bis hin zu gleichen oder ähnlichen Wörtern.
Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was einen in Japan erwartet, kann man bei ersten Kontakten mit Spanisch und Portugiesisch erleben.
Dem Taxifahrer in Lissabon blieb meine Aussprache von »Hotel Baixa« rätselhaft; erst das Vorweisen meiner schriftlichen Notiz überzeugte ihn vom Ziel der Fahrt. Die Ausspracheregeln zu lernen wäre noch kurzfristig möglich gewesen; ähnlich wie am Spanischen ist aber auch am Portugiesisch die fast 800-jährige Besatzung durch die Mauren nicht spurlos vorüber gegangen. Mehr als 1000 Wörter des alltäglichen Wortschatzes entstammen dem Arabischen. Aber…
... aber bei etwas näherer Betrachtung erweisen sich auch Spanisch und Portugiesisch in grammatikalischer Hinsicht als europäische Sprachen, und vor allem… – man kann sie lesen.
Und Japanisch?
Die Erinnerungen an meine ersten Kontakte mit dieser Sprache sind furchterregend. Heute liebe ich sie – die Sprache, nicht die Erinnerungen. Ich liebe es, Japanisch reden zu hören, und ich habe den Mut gefunden, es in alltäglichen Situationen zu benützen. Die unendliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Japaner täuscht mich gelegentlich sogar darüber hinweg, dass das Ergebnis meiner Sprachversuche nur in den seltensten Fällen korrekt ist.
Selbstverständlich erwartet man Neuland, wenn man sich zum ersten Mal näher mit einer asiatischen Sprache auseinandersetzt. Natürlich ist einem bewusst, dass die Schrift grundlegend anders ist, und dass man vielleicht neue Formen der Lautgestaltung erlernen muss. Und auch wenn man ein Leben lang mit dem Auto rechts gefahren ist, kann man doch lernen, links zu fahren. So dachte ich. Schließlich stellt man aber fest, dass dieses Auto kein Lenkrad hat, kein Gaspedal und keine Bremse. Die Frontscheibe ist matt, man sieht nichts, man hat keine Ahnung, wo man sich befindet.
Die Geschichte der japanischen Schrift beginnt im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, als man begann, die chinesischen Schriftzeichen kanji für die Darstellung des Japanischen zu übernehmen. Gleichzeitig entwickelte sich daraus eine zweite, eigenständige Schrift, das kata'kana. Während es etwa 20 000 (zwanzigtausend!) aus China übernommene kanji gibt, umfasst katakana lediglich 46 Zeichen. Nun enthalten Chinesisch und Japanisch zwar zum Teil ähnliche Laute, sind aber grundsätzlich verschiedene Sprachen. Das führte dazu, dass beinahe alle kanji zumindest zwei Lesungen aufweisen, nämlich eine sino-Lesung (also die ursprünglich aus China übernommene) und eine nomi-Lesung (eine in Japan neu entstandene). Weitere japanische Lesungen kamen im Laufe der Jahrhunderte hinzu, und so manches kanji weist bis zu sechs verschiedene Möglichkeiten der Aussprache und/oder Bedeutung auf.
Das japanische Bildungsministerium gibt heute einen Standard von 2500 kanji vor, die ein gebildeter Japaner beherrschen sollte. Also 2500 Zeichen mit durchschnittlich zwei bis drei verschiedenen Lesungen. Hinzu kommen die katakana-Schrift und hira'gana, die jüngste Schriftfamilie mit heute ebenfalls 46 Zeichen. Während bis ins 18. Jahrhundert katakana vorwiegend zur Darstellung von Bindeworten, Wortendungen und ähnlichem verwendet wurde, hat diese Funktion inzwischen hiragana übernommen. Katakana wird heute in erster Linie zur Schreibung von Fremdwörtern und ausländischen Namen verwendet, aber auch für japanische Namen – z. B. in Dokumenten, wo die Schreibung eindeutig sein muss. Besonders wichtige Hinweise können ebenso in katakana geschrieben sein wie Speisekarten oder Verbotsschilder.
Auch die lateinische Schrift findet unter dem Namen rōmaji Verwendung in Japan. Abgesehen vom Englischunterricht kann man sie auch zur Eingabe auf dem Smartphone und Computer verwenden, man findet sie als Geschäftsnamen und Werbeaufdrucke. Und natürlich wird sie zur Transkription des Japanischen in europäische Laute verwendet.