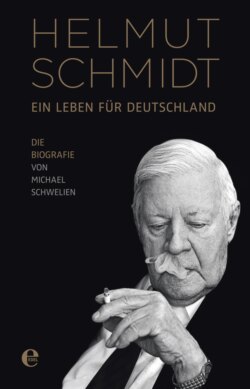Читать книгу Helmut Schmidt - Ein Leben für Deutschland - Michael Schwelien - Страница 10
»Vater unbekannt«
ОглавлениеGustav Schmidt, Helmut Schmidts Vater, wurde 1888 in Hamburg geboren – als uneheliches Kind. Der leibliche Vater war ein jüdischer Kaufmann namens Gumpel, der sich nach einer finanziellen Zuwendung an den Adoptivvater, den Helmut Schmidt zunächst für seinen richtigen Großvater hielt, nach Sachsen absetzte. Ende des 19. Jahrhunderts, als Schwangerschaftsabbrüche noch lebensgefährliche, von Kurpfuschern und Engelmacherinnen vorgenommene, streng verbotene Eingriffe waren, bezahlten – bestenfalls – leibliche Väter Adoptivväter dafür, dass diese sich ihres Kindes annahmen und so die Affäre aus der Welt schafften. Und dieser Adoptivvater, der Gustav Schmidt hieß und sich gar nicht erst die Mühe machte, für das Kind einen anderen Namen als den eigenen zu suchen, dürfte das Geld alsbald versoffen haben. Er war ein, wie es seinerzeit hieß, »unständiger Hafenarbeiter« und wohnte im proletarisch geprägten Barmbek.
Der heutige Hamburger Hauptbahnhof war zu jener Zeit noch nicht einmal in Planung, die Hochbahn ebenso wenig.
Gustav Schmidt ging zu Fuß zum Hafen – ein Weg von einer guten Stunde. Dort fragte er wie die anderen Stauer herum, ob es Schiffe zu be- oder entladen gab. Fand er eine Arbeit, dann hieß es zehn, zwölf und mehr Stunden lang für ein paar Pfennige hart anpacken. Der schmale Lohn wurde gern aufgebessert, indem die Stauer in unbeobachteten Momenten eine Kiste aus der Winsch fallen oder einen Sack aufplatzen ließen. Jeder hatte seinen »Zampelbüdel« dabei, einen Jutesack für das Arbeitszeug. In diese Zampel wanderten dann Kaffee, Bananen oder Sardinen, wahre Luxusgüter für die Hafenarbeiter. Hatte der unständige Gustav Schmidt aber kein Glück bei der Arbeitssuche, was oft genug passierte, dann ging er meist schnurstracks in die nächste Spelunke.
Das Jahr 1888 war für Hamburg schicksalhaft. Die Stadt war in den Jahren zuvor dem deutschen Zollverband ferngeblieben, also nicht völlig ins Deutsche Reich eingegliedert worden. Seit 1878 forderte Otto von Bismarck von den Hamburger Kaufleuten die Aufgabe der liberalen Freihandelspolitik und den Eintritt in den Zollverband. Der Reichskanzler führte diesen Kampf unnachgiebig und übte Druck aus, wo er nur konnte. 1888 wurde der Zollanschluss schließlich vollzogen, nachdem den Hamburgern vom Reich ein Zuschuss für die Anschlusskosten in Höhe von 112,7 Millionen Mark zugesprochen worden war. Dies erwies sich als geschickter Schachzug Bismarcks: Der Hamburger Senat stimmte der Annahme der ungeheuren Summe zu. Dadurch verlor Hamburg den größten Teil seiner politischen Selbstständigkeit. Das politische Konzept des Freihandels war besiegt worden. Aber der Anschluss, der den Zugang zum Binnenmarkt des Deutschen Reiches erleichterte und zugleich Ausnahmeregelungen von der nach außen geltenden Schutzzollpolitik gewährte, brachte Hamburg einen einzigartigen wirtschaftlichen Aufschwung.
Das Jahr 1888 leitete aber auch das Ende der Herrschaft des »Eisernen Kanzlers« ein. Nach dem Tod Kaiser Wilhelms I. bestieg dessen liberal gesinnter, aber vom Tode gezeichneter Sohn Friedrich III. den Kaiserthron. Er starb drei Monate später, worauf sein Sohn als Wilhelm II. zum Kaiser gekrönt wurde. Der noch nicht einmal dreißigjährige Wilhelm II. strebte ein persönliches Regiment an und wollte den alten Kanzler loswerden. Knapp zwei Jahre später erhielt die Sozialdemokratie erstmals die meisten Stimmen bei einer Reichstagswahl – 1,5 Millionen, was fast 20 Prozent entsprach. Damit hatten die Gegner Bismarcks eine Mehrheit im Parlament. Doch es waren nicht die Kräfteverhältnisse im Reichstag, sondern die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Kanzler, die zur Entlassung Bismarcks am 20. März 1890 führten.
Auf dem Gebiet des Kaufleuteviertels Grasbrook und auf den Elbinseln entstand der neue Freihafen. Gut 50 000 Menschen mussten umgesiedelt werden; Mietskasernen wie jene, die der Stauer Gustav Schmidt bewohnte, entstanden in den neuen Vororten Barmbek und Eimsbüttel. Zuvor konnten Arbeiter wie er zum Essen in ihre hafennahe Wohnung gehen. Jetzt mussten sie sich selbst versorgen – wenn sie Glück hatten, stand eine der öffentlichen »Volkskaffeehallen« in der Nähe.
Bei der Planung für den Freihafen hatten die Hamburger noch geglaubt, sie würden mit einer Wasserfläche von 426 Hektar auskommen. Innerhalb des Jahrzehnts, in dem der Zollanschluss verhandelt und vollzogen worden war, wuchs der Bedarf aber schon auf 726 Hektar. 1910 beanspruchte der Hafen bereits über 1000 Hektar Fläche. Ebenso rasant überholte der Umschlag alle Erwartungen. Man rechnete mit Schiffsankünften von fünf Millionen Bruttoregistertonnen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Als das 20. Jahrhundert anbrach, landeten die Schiffe bereits acht Millionen Bruttoregistertonnen an. Hamburg wurde nach New York und London zum drittgrößten Handelszentrum der Welt, die Reederei Hapag unter Führung des Kaufmanns Albert Ballin sogar zum größten Schifffahrtunternehmen der Welt. Die weitreichenden städtebaulichen Veränderungen wurden mit dem Bau des Elbtunnels 1911 und der ersten Untergrundbahn – vom 1906 vollendeten Hauptbahnhof zum Hafen – 1912 fortgesetzt.
In den dreißig Jahren zwischen der Reichsgründung im Jahr 1871 und der Jahrhundertwende wuchs Hamburgs Bevölkerung sprunghaft an, von 300 000 auf 750 000. Weit über die Hälfte der neuen Bewohner waren Zuwanderer. Diese prosperierende Wirtschaft bescherte den oberen Schichten unerhörten Reichtum. Wohlhabende Kaufleute luden zu Abendessen ein, die um Mitternacht serviert wurden und den Gastgeber gut und gern 15 000 Reichsmark kosten konnten – ein exklusives Vergnügen für die zwei Dutzend geladenen Gäste. Fritz Schumacher, nach der Jahrhundertwende Baudirektor der Stadt, beschrieb sie als Diners von »spätrömischer Üppigkeit«. Menschen wie Gustav Schmidt blieben solche sagenhaften Vergnügungen natürlich versagt.
Die Zahl der Prostituierten stieg sprunghaft an, ebenfalls die Zahl der Selbstmorde von Hausmädchen. Beides hing mit der Angst vor ungewollten Schwangerschaften und deren Folgen – gesellschaftliche Ächtung und wirtschaftliche Not – zusammen. Nur selten nahm jemand wie Gustav Schmidt den aus einer Liaison eines Kaufmanns mit dem Küchenmädchen hervorgegangenen Nachwuchs an Kindes statt an.
Noch 1888 floss in Hamburg ungefiltertes Wasser durch die Leitungen. Im Sommer 1892 brach die Cholera in der Stadt aus. Der Bahnverkehr mit Köln, Wien und Prag wurde eingestellt, und im Hafen saßen Tausende von Auswanderern fest, weil ihre Schiffe nicht auslaufen durften. Am schlimmsten wütete die Epidemie in den berüchtigten Gängevierteln unweit des Hafens. In einem einzigen Hof an der Steinstraße zum Beispiel wohnten 42 Familien, insgesamt 224 Menschen. Sie holten sich ihr Wasser aus zwei Leitungen. 27 von ihnen starben an der Cholera – 27 von mehr als 10 000 Toten in ganz Hamburg.
»Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen angetroffen wie in den sogenannten Gängevierteln«, schrieb Robert Koch, der Entdecker des Cholera-Erregers, der eigens aus Berlin angereist war: »Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde.«
Von all dem blieb der in Barmbek wohnende Hafenarbeiter Gustav Schmidt verschont. Er lebte mit den Seinen in einer Kate, die sie mit drei anderen Familien teilten. Sie stand an der Hufnerstraße, nahe der Heiligengeistkirche. Wasser bekamen sie von einer Pumpe außerhalb der Kate. Auch das stille Örtchen, ein Plumpsklo, befand sich außerhalb des Hauses. Vielleicht waren diese altmodischen sanitären Einrichtungen etwas hygienischer als die in den Gängevierteln. Jedenfalls blieben »Opa Schmidt«, wie Helmut und sein Bruder Wolfgang ihn nannten, und seine Familie von der Cholera verschont.
Der adoptierte Gustav war ein fleißiger, intelligenter Junge. Opa Schmidt, der ihn angenommen hatte, konnte ihm nichts an Bildung bieten, war er selbst doch praktisch Analphabet. Da grenzt es schon fast an ein Wunder, dass der Junge die Volksschule mit Bravour absolvierte und dann auch noch eine Lehrstelle in einer Rechtsanwaltskanzlei bekam, von denen es nach der Jahrhundertwende in der Hansestadt bereits unzählige gab. Er wurde Kanzleischreiber – das allein war schon ein ungeheurer Aufstieg für den Sohn eines ungelernten Arbeiters. Aber damit war seine Ausbildung noch nicht beendet. Er besuchte mithilfe eines »privaten Gönners«, wie Helmut Schmidt es ausdrückte, ein Lehrerseminar beim Lübecker Tor und konnte noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, gerade 26 Jahre alt, seine zweite Lehrerprüfung ablegen. In diesem Jahr heiratete er auch, wurde im August eingezogen und blieb bis zum Ende des Krieges Soldat. Dank einer nicht allzu schweren Verwundung wurde er zur Garnison in Schleswig versetzt, wohin er auch seine Frau mitnehmen konnte. Nach dem Krieg war er dann endlich Volksschullehrer, ließ in seinen Bildungsanstrengungen jedoch nicht nach. Im Abendstudium belegte er Volkswirtschaftslehre und schloss mit dem Examen ab. Gustav Schmidts enorme Energie schien nicht zu versiegen, er wurde Diplom-Handelslehrer und bekam, wie sein Sohn Helmut es salopp formulierte, »in den Zwanzigerjahren eine kleine Berufsschule in die Hand gedrückt«. Er wurde vom Kollegium zum Schulleiter gewählt und blieb es bis 1933, als die Nazis ihn absetzten.
Zum leiblichen Vater, dem Kaufmann Gumpel, von dem er vielleicht die Intelligenz und den Ehrgeiz geerbt – und wiederum an seine Söhne weitergereicht – hatte, suchte er den Kontakt. Und er fand ihn tatsächlich. Nach Auskunft von Helmut Schmidt gab es sogar einen Briefwechsel, der jedoch nicht mehr auffindbar ist.
Die Geschichte der jüdischen Gemeinde Hamburgs ist gut erforscht. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts kamen sephardische, aus Portugal stammende Juden nach Hamburg. Wenig später ließen sich auch deutsche Juden in der Stadt am Zusammenfluss von Alster und Elbe nieder. Die deutschen Juden, die ärmlichsten, wurden auf Betreiben der christlichen Geistlichkeit als »Ungeziefer« schon Mitte des 17. Jahrhunderts wieder verjagt. Sie fanden in der Nachbarstadt Altona als Untertanen des dänischen Königs Zuflucht, der sich aber seinen Schutz versilbern ließ. Als wenig später die Schweden Altona einzunehmen versuchten, flohen die deutschen Juden zurück nach Hamburg. Nun durften sie zwar bleiben, mussten sich aber auf wenige Berufe beschränken: Pfandleiher, Geldwechsler, Edelsteinhändler und Tabakverarbeiter – und eine besonders hohe Vermögenssteuer entrichten, die »Schoßabgabe« genannt wurde.
Die wohlhabenden portugiesischen Juden wurden aufgrund ihres frühen Einflusses auf den Handel nie vertrieben. Sie konnten bereits Mitte des 17. Jahrhunderts drei Gebetshäuser unterhalten. Gleichwohl kam es auch in Hamburg zu Pogromen, das schlimmste fand im August 1730 statt. Jedoch: Die Hetzer und Aufrührer wurden bestraft. Es hatte sich früh eine gewisse Rechtschaffenheit in Hamburg durchgesetzt. Bereits im Jahr 1687 war ein angesehener Gastwirt, der einen jüdischen Geldwechsler umgebracht hatte, zum Tode verurteilt worden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten mehr Juden in Hamburg als in jeder anderen deutschen Stadt, über 6000 deutsche und, streng getrennt von ihnen, mehr als hundert portugiesische. In Hamburg wurden die Juden nie in ein Ghetto gezwungen, wiewohl sie auch hier keine Krankenhäuser in der Stadt unterhalten durften und ihre Friedhöfe weit nach außerhalb legen mussten. Die größte – nach französischem Dekret von 1812 »Israelitische Gemeinde« genannte – jüdische Gemeinschaft in Deutschland brachte viele kleine Händler hervor und, dank der frühen Beschränkungen, die sich letztlich vorteilhaft auswirkten, eine Reihe von Bankiers, Juwelieren und Tabakfabrikanten. Aus welcher dieser Familien mag Helmut Schmidts leiblicher Großvater hervorgegangen sein? Zu den ganz Armen dürfte er nicht gehört haben.
Auch die Großeltern mütterlicherseits standen höher auf der sozialen Leiter als »Opa Schmidt«. »Opa Koch«, der Vater von Helmut Schmidts Mutter, hatte zwei Berufe gelernt, Setzer und Drucker. Solche Männer wurden »Schweizerdegen« genannt. Sie waren die höchstgestellten Arbeiter. Opa Koch war auf Wanderschaft aus Rheinhessen nach Hamburg gekommen, wo er eine Stelle als Setzer beim Hamburgischen Correspondent fand, einem Blatt, das später unter den Nazis eingestellt wurde. Die Familie Koch wohnte im Souterrain eines Wohnhauses am Mundsburger Damm und betrieb dort ein Wäsche- und Kurzwarengeschäft, in dem Helmut Schmidts Großmutter sowie ein Onkel und eine unverheiratete Tante ihr Auskommen hatten. Damit gehörten sie zur »Arbeiter-Aristokratie«.
Gebildete Arbeiter wie Heinrich Koch wurden oft Redakteure der sozialdemokratischen Zeitungen und der Gewerkschaftsblätter, sie stiegen von dort auch häufig in die Führungsetagen der Partei auf. Großvater Koch jedoch, ein Mann mit weißem Vollbart und von derart aufbrausender Natur, dass der junge Helmut nicht wagte, ihn anzusprechen, dachte nicht sozialdemokratisch. Helmut Schmidt erinnerte sich an diesen »Patriarchen« als einen »Liberalen«, der stolz darauf war, den großen Liberalen Friedrich Naumann persönlich gekannt zu haben. Koch verstarb im Jahr 1932. Helmut Schmidt hatte noch den Stoßseufzer der Oma bei der Machtergreifung Hitlers 1933 im Ohr: »Welch ein Glück, dass Heinrich das nicht mehr erleben muss.«
Die Kochs hatten fünf Kinder. Das zweitjüngste, Ludovika, half manchmal im Wäschegeschäft am Mundsburger Damm, wo Tante Lotte und Onkel Heinz bedienten und die Oma an der Kasse saß. Aber Ludovikas Begeisterung galt der Musik: Schon als junges Mädchen hatte sie im Chor der Hauptkirche St. Michaelis gesungen, und eine ältere Schwester, Marianne, wurde sogar zur Sängerin ausgebildet. Die Liebe zur Musik bekam Helmut Schmidt also eindeutig von der mütterlichen Seite der Familie in die Wiege gelegt. Wie die aus der Sicht Helmut Schmidts »vollkommen unpolitische« Ludovika Koch später den Lehrer Gustav Schmidt kennenlernte, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren.
Das Ehepaar Gustav und Ludovika Schmidt wohnte nach der Rückkehr von der Schleswiger Garnison in Hamburg in der Richardstraße. Die liegt zwar auch im Arbeiterviertel Barmbek, galt aber damals als eine der besseren Straßen. Das Haus stammte aus der Gründerzeit, und die Jungs hatten ein eigenes Zimmer – ein Privileg in diesem Stadtteil. Die Eltern konnten sich sogar den Luxus eines abgetrennten Schlafzimmers leisten. Es lag über der eigentlichen Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss. Maisonette würde man heute eine solche Wohnung nennen. Helmut Schmidt sagte über seine Jugend, dass zwar »geknapst« wurde, aber »keine Entbehrungen zu ertragen« waren. Die Namensgebung war jedenfalls großzügig, fast ein wenig hochtrabend: Die Schmidts nannten ihren Sohn Helmut Heinrich Waldemar.
Das Klischee vom »strengen Elternhaus« mochte Schmidt nicht gelten lassen. Allenfalls sei der Vater streng gewesen. Wie hat sich das gezeigt? »Wolfgang und ich bekamen jeder ein Taschengeld von 20 Pfennig pro Woche und mussten genau Buch führen, wie wir es ausgaben … Diese Buchführung hielt mein Vater für Erziehung«, sagte Helmut Schmidt mit einem schelmischen Lächeln, das man von ihm sonst nicht gewohnt war »aber wir haben sowieso dauernd geschwindelt.«
Im Wohnzimmer stand ein schwarzes Klavier. Helmut und sein zwei Jahre jüngerer Bruder hatten sogar eine private Klavierlehrerin, auch das konnte die Familie sich leisten. Angeblich will er nur ungern geübt haben. Bei anderen Gelegenheiten hat er indes erzählt, es habe ihm Spaß gemacht – und auf jeden Fall sei er mit Freude zum Klavierunterricht gegangen. Das Problem war wohl weniger der Unterricht selbst, sondern der Weg dorthin. Anfang der Dreißigerjahre zogen die Schmidts um, von der Richardstraße im Stadtteil Barmbek in die Schellingstraße in Eilbek. Die Wohnung war günstiger – dem Vater war, wie vielen in der Weltwirtschaftskrise, das Gehalt gekürzt worden, und die Familie musste sich einschränken. Diese Wohnung hatte eine fensterlose Kammer, in der abwechselnd Helmut und sein Bruder schliefen. Immerhin konnten die Schmidts es sich noch leisten, ihren älteren Sohn im Sommer 1932 im Rahmen eines Schüleraustausches für drei Wochen nach Manchester zu schicken, wo Helmut Englisch lernte. Die Prioritäten der Familie lagen eindeutig im Bereich der Bildung. Ein Fahrrad blieb dagegen noch lange ein Wunschtraum, und so musste Helmut, der wegen der Geldknappheit erst mit 13 den ersehnten Drahtesel bekam, zum Klavierunterricht laufen. Das war anstrengend, denn die Klavierlehrerin der Jungen, Lilly Sington-Rosdal, unterrichtete weit entfernt von der neuen Wohnung, am Winterhuder Weg in Uhlenhorst.
Viel bequemer war da der Singkreis, der sich regelmäßig in der elterlichen Wohnung traf. »Onkel Ottomar«, ein Cousin der Oma Koch, leitete ihn an dem Klavier, das die Familie aus der Richardstraße mitgenommen hatte. Die ganze Großfamilie der Kochs sang mit, Freunde kamen dazu. Der junge Helmut liebte diese Treffen.
Politik kam in der frühen Jugend Helmut Schmidts nicht vor. Wenn zu Hause darüber gesprochen wurde, mussten die Kinder das Zimmer verlassen. Eine der wenigen anderen Vorschriften, die der Vater machte, war diese: Kinder haben keine Zeitung zu lesen.