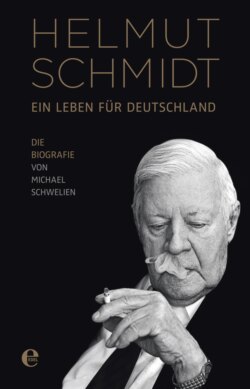Читать книгу Helmut Schmidt - Ein Leben für Deutschland - Michael Schwelien - Страница 13
»Wir konnten uns so gut zanken« – Loki
ОглавлениеLoki Schmidt hatte da eine ganz andere Erinnerung, jedenfalls hinsichtlich ihrer eigenen Person. Wenn sie über ihre Einschulung sprach, dann blitzten ihre Augen verschmitzt, und ihre Stimme bekam einen leicht belustigten, aber auch verliebten Unterton: »Wir haben uns Ostern 1929 in der Sexta kennengelernt, bei der Einschulung.« Sie und Helmut waren die beiden jüngsten Schüler. Sie war es, die auf die Jungs, auch auf Helmut, zuging, nicht umgekehrt. Es gibt ein Foto von einem Kindergeburtstag im Juni 1929. Darauf zu sehen sind nur Jungs und sie, Loki, ein Leuchtturm, der über die anderen hinausragt. »Ich war die Längste«, erzählte sie weiter, »Helmut war der Kleinste.« Es war der Beginn einer Kinderfreundschaft, die zu einer Ehe führen sollte, die ein Leben lang hielt. Warum hat sie ihn – umgekehrt wird es wohl kaum gewesen sein – ausgewählt? »Wir konnten uns so gut zanken.« Dass der kleine Helmut rotzfrech war, auch das war ihr lebhaft in Erinnerung.
Helmut war von seinen Eltern in den ersten vier Jahren auf eine strenge Jungenschule geschickt worden. Dort wurde noch geschlagen, mit der Hand ins Gesicht oder mit dem Rohrstock auf die Finger. Einmal im Jahr wurde der Sedantag gefeiert, der Tag des Sieges von 1870 über Frankreich. Loki hingegen war schon in der Grundschule auf eine fortschrittliche Schule geschickt worden, eine, wie sie noch im hohen Alter genau wusste, freundliche, offene Schule mit weiß gestrichenen Wänden.
Hamburg war in Deutschland führend, was Schulreformen betraf. Nach den acht Pflichtjahren an der Volksschule durften in Hamburg die besten Schüler ein weiteres Jahr zur Schule gehen, zur »Selekta«, eine frühe Form des zweiten Bildungswegs. Die Mutter von Helmut Schmidt ging auf die Selekta, ebenso beide Eltern von Loki Schmidt. Das war – wegen des teuren Schulgelds, das Gymnasien und andere höhere Schulen erhoben – für Kinder aus armen Verhältnissen die einzige Möglichkeit, über die Grundbildung hinaus mehr zu lernen. Loki Schmidt besuchte eine von fünf »Versuchsschulen« in Hamburg. Diese waren mit Tischen und Stühlen eingerichtet, die zum großen Teil von den Eltern selbst gebaut worden waren. Aber wesentlich war die Abkehr von der überkommenen Paukschule, wie Helmut sie besucht hatte, in der die Hände stets streng auf dem Tisch liegen mussten. Kritisches, selbstständiges Lernen war das Ziel. Die Lehrer suchten neue Wege. Sie waren fast alle pädagogisch stärker motiviert als ihre Kollegen an den herkömmlichen Schulen. Und die Versuchsschulen hatten eine deutliche soziale Ausrichtung, zum Beispiel wurden an manchen Nachmittagen die Kleider besonders bedürftiger Schüler geflickt.
Loki Schmidt kam als Hannelore Glaser am 3. März 1919 zur Welt. Sie entstammte ebenfalls einer Arbeiterfamilie, der es aber nicht so gut ging wie der ihres späteren Mannes. Doch sie hatte, wie sie liebevoll sagte, »verrückte Eltern«. Von dem wenigen Geld, das sie hatten, wurde immer etwas für die Volkshochschule abgezweigt. Dies nun war ein Merkmal des klassischen, an Bildung interessierten Arbeitermilieus. Bei Loki zu Hause galt das Motto der aufstrebenden Arbeiterbewegung, wie sie es sagte, die Bacon’sche Formel: »Wissen ist Macht.«
Die Glasers lebten gemeinsam mit den Großeltern in einer regelrechten Großfamilie. Sie hatten im Februar 1919 gerade eine neue Wohnung in der Schleusenstraße im Hamburger Stadtteil Hammerbrook nahe dem Hafen bezogen. Diese war ungewöhnlich groß für einen Polsterer und eine Köchin. Aber bei diesen Großeltern mütterlicherseits lebten noch die vier Töchter, von denen Hannelores Mutter die älteste war, der Schwiegersohn, Hannelores Vater, sowie ein Nachbarskind, dessen Mutter gestorben war und das die Großeltern zur Pflege aufgenommen hatten. Die Wohnung lag in einem prächtigen Haus aus der Gründerzeit und hatte fünfeinhalb Zimmer. Zwei ineinander übergehende Räume waren den Glasers zugeteilt. Hier wurde Hannelore geboren – einen Tag nach der schönen Einweihungsfeier für diese eher großbürgerliche Wohnung.
Die Großeltern hatten allen vier Töchtern eine Ausbildung zuteil werden lassen. Hannelores Mutter wurde Schneiderin, die drei Schwestern alle Kontoristinnen. Das war mindestens so ungewöhnlich wie der Aufstieg von Helmut Schmidts Vater zum Kanzleischreiber und später zum Lehrer. In der großen Wohnung wurde viel gefeiert, und – auch hier ein kräftiger Schuss Bildungsbürgertum – es wurden selbst geschriebene Theaterstücke aufgeführt. Die Glasers bekamen noch zwei Kinder. Sie suchten sich eine eigene Wohnung und fanden sie 1922.
Sie lag fast auf der anderen Seite der Stadt, in Borgfelde. So verlief der Umzug: Der Vater und einige Freunde zogen einen Handwagen, auf dem der gesamte eigene Hausrat Platz hatte. Die Mutter schob einen Kinderwagen, in dem das Jüngste lag. Oben auf dem Wagen saß der Zweite, Hannelore ging an der Hand, zum Schutz in der Dunkelheit hing eine Papierlaterne am Kinderwagen.
Die neue Wohnung lag in einem Hinterhaus. Hier war alles anders als im bürgerlichen Hammerbrook. Dort lebten acht Menschen in fünfeinhalb Zimmern, hier fünf in zweieinhalb. Zwei dunkle Räume gingen vorn ineinander über, in einem standen die drei Bettchen der Kinder, in dem anderen ein Sofa, drei Stühle und die Nähmaschine der Mutter mit einem vierten Stuhl. Hinten befanden sich die Küche mit einem Wasserhahn und einem Ausguss sowie das Schlafzimmer der Eltern, gerade doppelt so groß wie das Bett. Insgesamt maß diese neue Bleibe 28 Quadratmeter. Die Toilette war im Treppenhaus. Die Monatsmiete betrug 27 Mark, einen Wochenverdienst des Vaters. Die kleine Hannelore liebte die Wohnung dennoch, weil sie sie mit niemandem außer der unmittelbaren Familie teilen musste.
Nach hinten war es noch dunkler als nach vorn. Die nächste Häuserreihe stand beinahe zum Greifen nahe, nur vier Meter war der Hof breit. Außer ein wenig Löwenzahn wuchs in diesem dunklen Hinterhof nichts. Und die Topfpflanzen, die der Vater vom Blumenmarkt mitbrachte, gingen im Gaslicht der Wohnung schnell ein. Loki Schmidts lebenslange Liebe zu den Pflanzen wurde nicht in der düsteren Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Borgfelde geweckt sondern bei einem Besuch bei der kranken Großmutter, als sie eine rote Rose sah, auf die in Goldschrift die Worte »Gute Besserung« geschrieben waren.
Was sie als Kind über Literatur und Architektur, Kunstgeschichte und Biologie erfuhr, wusste sie von ihren Eltern, die dreimal in der Woche die Volkshochschule besuchten. Aus den Erzählungen der Eltern entstand ein Kindertraum. Die Tochter des Elektrikers und der Schneiderin wollte Naturforscherin werden. Und diesen Traum erfüllte sie sich insofern, als sie Mitte der Siebzigerjahre begann, in exotischen Ländern die Pflanzenwelt zu studieren. Als Erstes arbeitete sie in Kenia, am Nakuru-See, der auch Flamingo-See genannt wird. 1976 gründete sie die Stiftung zum Schutze gefährdeter Pflanzen, 1980 kürte sie als Erste die »Blume des Jahres«. Eine Pflanze ist nach ihr benannt, die Pitcairnia loki-schmidtiae nov. spec. Es ist eine Bromelie, aber eine untypische. Normalerweise wachsen Bromelien epiphytisch, also auf Bäumen oder anderen Gewächsen. Loki Schmidt entdeckte »ihre« Pitcairnia in Mexiko, wo sie wie eine Ananas auf dem Boden wuchs. Sie brachte sie mit nach Deutschland und übergab sie dem Botanischen Garten in Bonn. Eines Tages rief dessen Direktor an, er hatte die Pitcairnia blühen gesehen: Es handele sich zweifelsfrei um eine bisher nicht entdeckte Art. Für die Frau, die in ihrer Kindheit zu Hause ohne Grün auskommen musste, war es ein Moment des »großen Gücksgefühls«.
Loki war das erste Kind der Glasers. Nach dem Bruder und der Schwester kam dann noch eine weitere Schwester. Entbunden wurde zu Hause. Loki durfte – das war sicher nicht nur der aufgeklärten, modernen Haltung ihrer Eltern zu verdanken, sondern auch schlicht der Enge der Wohnung geschuldet – den wachsenden Bauch der Mutter sehen, durfte bei der Geburt dabei sein und die kleine Schwester in den Armen halten, noch bevor sie gebadet wurde.
Der Verdienst des Vaters, Betriebselektriker beim Arbeitsamt, reichte nicht vorn und nicht hinten. Deshalb ging die Mutter alsbald außer Haus zum Schneidern. Sie konnte so nicht nur die Haushaltskasse aufbessern, sondern brachte auch Essen und abgelegte Kleider von den Familien mit, bei denen sie arbeitete. Den Haushalt versorgte derweil die Pflegetochter der Großeltern, die mittlerweile erwachsen war, aber keine Anstellung gefunden hatte. Zwar musste die Frau in der ohnehin schon engen Wohnung der Glasers unterkommen und miternährt werden. Aber so brachten die Eltern zusammen gut 50 Mark pro Woche nach Hause – und Loki wurde schon als Achtjährige zum Geigenunterricht geschickt.
1929 bekamen sie dann eine Wohnung für kinderreiche Familien in einem Neubau im östlichen Stadtteil Horn. Loki erschien es wie purer Luxus: ein eigenes Zimmer für sie und ihre Schwester, eines für den Bruder und Platz genug für das Baby im Schlafzimmer der Eltern. Ein »richtiges Badezimmer« mit Boiler, eine Zentralheizung – es war einfach herrlich. Doch die Pflegetante fand nun endlich eine eigene Arbeit als Lernschwester im Krankenhaus, und Loki musste fortan helfen, den Haushalt zu führen. Der Vater war zwar zu jener Zeit arbeitslos, aber damals wurden die Arbeitslosen häufig zu Arbeitseinsätzen eingezogen, mussten zum Beispiel die ganze Woche über bei der Obsternte im Alten Land helfen und kamen daher nur am Wochenende nach Hause.
Die »verrückten« Eltern aber hatten ihr zuvor noch mehr gegeben als Bildung daheim und Geigenunterricht, nämlich die einzigartige Chance, die ebenso verrückte Lichtwarkschule zu besuchen. An ihrem ersten Tag wurden die Schüler in die Aula gebeten, wo die Lehrer vorgestellt wurden. Und, unerhört, die Schüler durften selbst entscheiden, zu wem sie gehen wollten. Ostern 1929 waren eine Frau, Ida Eberhardt, und ein Mann, Ernst Loewenberg, für die neuen Klassen eingeteilt. Loki wählte Frau Eberhardt. Diese trug ein blaues Kleid mit einem weißen Kragen, ganz ähnlich wie das Kleid von Lokis Mutter, deshalb entschied sie sich für die Lehrerin.
Weshalb der zweieinhalb Monate ältere Helmut Frau Eberhardt wählte, weiß niemand mehr. Aber Loki Schmidt betonte: »In der Pubertät denselben Einflüssen ausgesetzt zu sein, ist die wichtigste Voraussetzung für eine lange Ehe.« Und sie meinte damit vor allem die Bildungsinhalte, die an der Hamburger Lichtwarkschule vermittelt wurden.
Sie sah auch das Elitäre dieser Schule. »Ein bisschen eingebildet waren wir schon«, räumte sie ein, »die Lichtwarkschule war eben etwas Besonderes.« Auch bei ihr war der starke Einfluss der Lehranstalt zu erkennen. Für eine jener Jahresarbeiten wählte sie als Thema die Untersuchung eines Moores auf der anderen Seite der Elbe. Bestimmt hat die Beschäftigung mit diesem – wie wir heute sagen würden – Biotop ihren Kindheitstraum vom Naturschutz verstärkt und ihre Fantasie in einem Maße angeregt, dass die Liebe zur Flora ein Leben lang erhalten blieb.
Loki und Helmut hatten einen langen Schulweg, noch ein Hinweis darauf, wie sehr die Eltern an einer Ausbildung in dieser außergewöhnlichen Einrichtung interessiert waren. Das Schulgeld wurde ihr aus sozialen Gründen erlassen. Aber Loki musste zwanzig Minuten zu Fuß zum S-Bahnhof gehen, dann zwanzig Minuten mit der S-Bahn fahren, schließlich noch einmal zwanzig Minuten durch den Stadtpark laufen, an dessen Rand der von Fritz Schumacher entworfene Klinkerbau stand.
Sie freundete sich mit Helmut Schmidt an. Dass damals schon eine Art Kindheitsliebe aufkeimte, wollte sie ebenso wenig gelten lassen wie ihr Mann. So etwas hätten sie sich auch in jener Zeit nicht eingestanden. Die Musik verband sie. Trotz der Armut war auch Lokis Elternhaus musikalisch. Der Vater spielte Cello, die beiden Schwestern Geige, bei Loki kam noch die Bratsche hinzu. Als Loki auf die Lichtwarkschule kam, war ihr Vater schon lange arbeitslos. Er hatte seine Stelle beim Arbeitsamt bereits 1925 verloren. 13 Wochen lang bezog er Arbeitslosenunterstützung, damals die Höchstzeit, die folgenden sieben Jahre lebte die Familie von der Fürsorge. Die Musik bot Trost und Halt. Und wegen der ein Leben währenden Liebe und Freundschaft zu Helmut Schmidt brachte sie ein Opfer, das größer kaum sein konnte: Als ihr Mann so schwerhörig geworden war, dass er nicht mehr ins Konzert gehen mochte, blieb auch sie zu Hause – es hätte sie zu sehr gegrämt, die Musik zu genießen und zu wissen, dass er nicht daran teilhaben kann.
Auch eine schlechte Angewohnheit verband die beiden zeitlebens. Die kleine Loki rauchte mit zehn Jahren ihre erste Zigarette. Der noch kleinere Helmut auch. In beiden Elternhäusern war es geduldet. Ja, Vater Glaser belohnte seine Tochter gelegentlich nach der Hausarbeit, indem er ihr am späten Abend eine Tasse Kaffee kochte und eine Zigarette auf die Untertasse legte. Im Laufe der Jahre wurde aus diesen seltenen geschnorrten oder geschenkten Zigaretten ein Päckchen pro Tag – bei beiden. Und es schien immer, als würden sie sogar noch weit mehr rauchen, aber nur ein Päckchen zugeben.
Beide reagierten unsicher auf das Thema. Helmut Schmidt hatte sich eine Standardausrede zurechtgelegt. Seine Adern seien inzwischen »auszementiert«, er solle bloß nicht auf irgendwelche »Doktoren« hören, habe, wie gesagt, sein Internist ihm geraten, für ihn sei es gefährlicher aufzuhören als weiterzurauchen. Später hat er einmal zugegeben, dass er diese Geschichte erfunden hätte. Er wollte nur nicht mehr die unangenehmen Fragen nach seiner Sucht beantworten müssen.
Loki Schmidt machte es sich nicht ganz so leicht. Sie achtete auch darauf, dass im Hause Schmidt gesund gegessen wurde morgens Obstsalat, abends viel Gemüse und wenig Fleisch. Sie reagierte beim Thema Rauchen ein bisschen kiebig. Von »schlechtem Vorbild« wollte auch sie nichts hören. Aber sie arbeitete dreißig Jahre lang als Lehrerin. Sie wusste was eine Vorbildfunktion ist. Und schon als kleines Mädchen erfuhr sie von gesunder Ernährung. Die Mutter hatte in der Volkshochschule die Bircher-Benner-Lehre gehört. Bei den Glasers hatte es daraufhin viel gedünstetes Gemüse, Bananen, Gurken, Feigen und weißen Käse, aber nur wenig Fleisch zu essen gegeben. Sicher war das nicht nur der Aufklärung in der Volkshochschule geschuldet, sondern schlicht auch Folge des Geldmangels. Aber das, was heute als gesunde Ernährung angepriesen wird, war Loki Schmidt von frühester Jugend an vertraut. Und ein klein wenig spricht wohl doch schlechtes Gewissen aus ihrer Abwehr. Dennoch ist es trotz ihrer Lungenentzündung und seiner Bypassoperation auch in ihrer neunten Lebensdekade bei einem Päckchen pro Tag geblieben.
»Verliebt sein ist wie ein Feuer aus Reisig und Stroh«, davon war Loki Schmidt überzeugt, »Dreck und Not und Kummer, wie unsere Generation sie erlebt haben, verbinden mehr.« Das Rauchen, das einzige Laster, das sie sich gönnten, war zu ihrer Jugendzeit – und noch lange danach – ein kurzer Moment, eine schöne Illusion, um der Not zu entrinnen. Aber die Art, wie sie miteinander umgingen, dass sie nicht aneinander herumnörgelten, dass sie nicht versuchten, einander zu verändern, dass Loki Schmidt ihren Mann nicht ständig fragte, wann er denn nach Hause komme – all das sind Zeichen für eine Vernunftehe, deren Grundlagen wohl in der aufgeschlossenen Atmosphäre der Lichtwarkschule gelegt wurden.
Natürlich gab es die Berührungsängste und Peinlichkeiten, die zu allen Zeiten zwischen Jungen und Mädchen aufkommen. Loki Schmidt sprach von einer Begebenheit, als sei sie gestern erst passiert: Mit einer Freundin ging sie durch den Stadtpark. In der Ferne entdeckte sie Helmut und seinen Bruder, der auch Lichtwarkschüler war. »Lass uns bloß hier abhauen«, rief sie der Freundin zu, »da hinten kommen die Schmidt-Jungen!« Was sie aber als »zanken« bezeichnet hat, meint sicher nicht nur kicherndes Versteckspielen. Die beiden Kinder haben auf dem langen Schulweg viel miteinander gestritten, heute würde man sagen: diskutiert. An der Lichtwarkschule herrschte die Meinung vor, dass der Umgang mit der Kunst, die Ausübung von Kunst, einen guten, einen besseren Menschen schaffe. Damit einher ging die Erziehung zur Selbstständigkeit. Die »Zankereien« der beiden kreisten, wenn auch oft unwissentlich, immer wieder um dieses Generalthema: der gute, selbstständige Mensch.