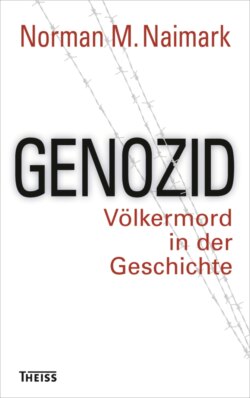Читать книгу Genozid - Norman Naimark - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеGenozide sind seit je Teil der Menschheitsgeschichte. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, unsere vorgeschichtlichen Vorfahren seien bei der Begegnung mit anderen Völkern und mutmaßlichen Feinden oder bei deren Vernichtung mehr oder weniger zivilisiert gewesen als wir. Großfamilien, Clans und Stämme beteiligten sich regelmäßig an genozidalen Aktionen gegen ihre Rivalen, so, wie antike Reiche und moderne Nationalstaaten ihren mörderischen Hass auf imaginierte oder reale Feinde durch Massenmorde zum Ausdruck brachten. Genozide haben im Lauf der Jahrhunderte interne und externe Dimensionen gehabt. Führende politische Akteure kleiner und großer, primitiver und moderner Gesellschaften haben sich gegen interne Gruppen – Stammesangehörige, ethnische, religiöse und soziale Gruppen – gewandt und diese zu vernichten versucht, um so ihre Privilegien zu wahren, Opposition zu vermeiden, ihre Macht zu konsolidieren und Reichtümer anzuhäufen. Aus unterschiedlichsten imperialen Gründen haben sie benachbarte (oder entfernte) Gebiete erobert und die indigenen Völker dieser Regionen getötet, unterdrückt oder für ihre Zwecke vereinnahmt, um Macht über sie auszuüben und sich ihres Bodens und ihrer Ressourcen zu bemächtigen.
Jede Betrachtung der Weltgeschichte des Genozids muss sich mit der Frage seiner Definition auseinandersetzen, denn, um den Völkermord von anderen im Lauf der Jahrhunderte verübten entsetzlichen Gräueln gegen Menschen zu unterscheiden, müssen wir seinen spezifischen Charakter als „Verbrechen aller Verbrechen“ verstehen. Genozid fällt in eine andere Verbrechenskategorie als etwa Kriegsverbrechen, die ursprünglich von der Haager Friedenskonferenz von 1898 definiert wurden und deren Bestimmung dann bei den Nürnberger Prozessen 1946 und von der Genfer Konvention 1949 weiterentwickelt wurde. Zu Kriegsverbrechen zählen etwa kriegsspezifische Verbrechen wie Plünderungen, die Ermordung von Geiseln, die Verwendung von Gas und das Töten von Kriegsgefangenen. Völkermord unterscheidet sich auch von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (1998) als vorsätzliche Tötung, Ausrottung, Versklavung, rechtswidrige Vertreibung oder Überführung der Bevölkerung, Folter und verschiedene Sexualverbrechen, darunter Vergewaltigung, klassifiziert.1 Der Genozid hat seine eigene Geschichte, deren Beschreibung auf das Denken und Wirken des polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin zurückgeht. Ihm und seinen Bemühungen um die Verbreitung der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 verdankt die internationale Gesellschaft heute das Konzept des Genozids. Lemkin war zudem der Erste, der einen weltgeschichtlichen Ansatz für den Genozid entwickelte.
Raphael Lemkin wurde 1900 im polnischen Teil Russlands geboren und studierte in den 1920er-Jahren in Lemberg (dem heutigen Lwiw) und Heidelberg.2 Bereits als junger Anwalt war Lemkin im Warschau der frühen 1930er-Jahre auf Massenmord als internationales Verbrechen fixiert. Er beschäftigte sich mit dem Völkermord an den Armeniern 1915 ebenso wie mit dem Massaker von Semile 1933 an assyrischen Christen im Nordirak. Die einzige Möglichkeit, ähnliche Verbrechen zu vermeiden oder abzuwenden, sei internationales Recht, so Lemkins Überzeugung. Er verfasste daraufhin einen Aufsatz, den er auf einem vom Völkerbund finanzierten Treffen internationaler Anwälte 1933 in Madrid präsentierte. Darin definierte er zwei Verbrechen, die durch internationales Recht verboten werden sollten. Das erste nannte er „Barbarei“ – Lemkins erster Versuch, das später von ihm als „Genozid“ bezeichnete Konzept zu definieren. „Wer aus Hass gegen eine rassische, religiöse oder soziale Gruppe oder zum Zwecke ihrer Ausrottung eine strafbare Handlung gegen Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Würde oder wirtschaftliche Existenz einer Person, die einer solchen Gruppe angehört, unternimmt, macht sich des Verbrechens der Barbarei schuldig.“ Lemkin entwickelte auch eine Vorstellung dessen, was man als kulturellen Genozid betrachten kann und was er damals als „Vandalismus“ bezeichnete. „Wer aus Hass gegen eine rassische, religiöse oder soziale Gruppe oder zum Zwecke ihrer Ausrottung ihre Kunst- oder kulturellen Werke vernichtet, macht sich des Verbrechens des Vandalismus schuldig.“3 Der Völkerbund schenkte Lemkins Ideen wenig Beachtung und sah sich bald mit der Bedrohung durch die Nazis konfrontiert, die Lemkins Leben für immer verändern sollte.
Am 1. September 1939 überfiel Hitler Polen, ermordete Zehntausende Polen und trieb die Juden des Landes in Ghettos zusammen, wo sie bald massenhaft an Hunger und Krankheit starben. Lemkin erkannte die Zeichen der Zeit und floh über Schweden in die USA, wo er eine erste Anstellung als Dozent an der Duke University Law School erhielt. Bald darauf wurde er als Berater für die Carnegie Peace Foundation und das US-Kriegsministerium in Washington engagiert. In der amerikanischen Hauptstadt sammelte er weiteres Material über die Besetzung Europas durch die Nazis, darunter die Gesetze und Erlasse, die die Grundlage der nationalsozialistischen Repressalien in Europa bildeten. 1944 veröffentlichte Lemkin seine Recherchen in einem Buch mit dem Titel Axis Rule in Occupied Europe [Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa], in dem er die Herleitung des Begriffs „Genozid“ erläuterte: „Mit ‚Genozid’ meinen wir die Vernichtung einer Nation oder einer ethnischen Gruppe. Der von dem Autor geprägte Neologismus, der eine alte Praxis in ihrer modernen Entwicklung bezeichnet, besteht aus dem griechischen Wort genos (Rasse, Stamm) und dem lateinischen cide (Mord) und entspricht damit seiner Bildung nach Wörtern wie Tyrannizid [Tyrannenmord], Homizid [Mord], Infantizid [Kindstötung] usw.“4 Lemkin hatte offenbar einen Begriff gefunden, der angesichts des Holocaust und anderer ungeheuerlicher Verbrechen von Massenmorden in der öffentlichen Meinung des Westens Widerhall fand. Angesichts seiner Erfahrungen mit den Nazis und seiner berechtigten Angst vor dem, was seiner eigenen Familie in Polen widerfahren war – viele seiner Familienangehörigen wurden ermordet –, konzentrierte sich ein Großteil seiner Bemühungen auf das Bekanntmachen der dramatischen Lage der Juden.
Als unermüdlicher Lobbyist war Lemkin im Spätherbst 1946 in Nürnberg, um die Kläger davon zu überzeugen, den Völkermord in die Anklage gegen die vor Gericht stehenden Nazikriegsverbrecher mit aufzunehmen. Der internationale Militärgerichtshof war hingegen viel mehr daran interessiert, einen Angriffskrieg als den Massenmord an Juden oder anderen zu verurteilen. Lemkin betrieb daraufhin Lobbyarbeit bei den neu gegründeten Vereinten Nationen, um die Verabschiedung eines internationalen Gesetzes zum Genozid zu forcieren. Hier war ihm mehr Erfolg beschieden, da Vertreter der Sowjetunion, Polens, Jugoslawiens und einiger anderer Länder sich mit jüdischen Gruppen zusammenschlossen und die Generalversammlung von der Verabschiedung einer Resolution im Dezember 1946 überzeugten, die das Verbrechen des Genozids – „ganz gleich, ob er aus religiösen, rassischen, politischen oder irgendwelchen anderen Gründen begangen wurde“ – verurteilte und den sechsten Hauptausschuss (Rechtsausschuss) der Vereinten Nationen mit dem Entwurf einer Völkermordkonvention beauftragte.5 In den anschließenden Verhandlungen über die Abfassung dieser Konvention bestanden die Sowjetunion und ihre Verbündeten neben anderen Ländern darauf, soziale und politische Gruppen nicht explizit zu erwähnen. Die einstimmig von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 verabschiedete Konvention über die Verhütung und Bestrafung von Völkermord – Lemkin saß während der Versammlung auf der Zuschauertribüne – definierte Völkermord bekanntlich als eine Vielzahl von „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“.6
Bei der Auslegung der Konvention wird häufig übersehen, dass ihre Präambel Lemkins Auffassung von der Allgegenwart von Genoziden in der Geschichte der Menschheit bekräftigte: „In Anerkennung der Tatsache, dass der Völkermord der Menschheit in allen Zeiten der Geschichte große Verluste zugefügt hat.“ Tatsächlich beteiligte sich Lemkin an einem breit angelegten eigenständigen Projekt, in dessen Rahmen er zu den weltgeschichtlichen Dimensionen des Genozids recherchierte und über sie schrieb.
Die von Lemkin in seinem Buch von 1944 vorgelegte und in der Konvention von 1948 präzisierte Definition bleibt bis zum heutigen Tag die grundlegende, von Wissenschaftlern und internationalen Gerichten in ihrer Arbeit zu Genoziden in Vergangenheit und Gegenwart anerkannte Definition von Völkermord. Dieser Definition schließt sich der vorliegende Band an, wenngleich in veränderter Form, um Lemkins ursprünglicher Idee bei Genoziden Rechnung zu tragen, auch die gezielte Vernichtung sozialer und politischer Gruppen einzubeziehen. Die adjektivische Form genozidal wird hier verwendet, um „wie Völkermord oder Völkermord betreffend“ auszudrücken, wobei sie nicht notwendigerweise das Äquivalent zu einem Genozid als solchem ist.
Die in diesem Buch verwendete Definition von Genozid stützt sich ebenfalls auf die spätere Weiterentwicklung des Begriffs, wie sie von verschiedenen internationalen Tribunalen vorangetrieben wurde.7 Die internationale Rechtsprechung hat es beispielsweise nützlicher gefunden, sich bei der Bewertung von Völkermorden auf die zentrale Bedeutung von Massentötungen zu fokussieren als auf andere damit verknüpfte und in der Konvention geächtete Aspekte wie „Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind“, oder „gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“. Diese Handlungen, die sich von Massentötungen unterscheiden, werden vor Gericht im Allgemeinen nicht als Genozid anerkannt, sondern gelten in Verbindung mit vorsätzlichem Massenmord als Beleg für genozidale Absichten, Methoden und Folgen.
Angesichts der Auseinandersetzungen darüber, ob ein bestimmter Ereigniskomplex ein Genozid ist oder nicht, ist die Enttäuschung mancher Wissenschaftler, Juristen und Entscheidungsträger nachvollziehbar, denn bereits die Verwendung des Wortes hat Auswirkungen darauf, wie wir die Frage von Interventionen in Krisensituationen angehen. Diskussionen über die Verwendung des Begriffs prägen auch die historischen Forderungen zahlreicher Völker nach Anerkennung der mörderischen Tragödien oder Angriffe auf Kulturen, unter denen ihre jeweilige ethnische Gruppe oder Nation zu leiden hatte. In beiden Kontexten ist wichtig, die Definition von Genozid weder zu breit und vage noch zu eng und restriktiv zu fassen. Manche Kommentatoren würden Völkermord – wie auch „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und „Kriegsverbrechen“ – gern unter die allgemeine Kategorie „Gräuel“ subsumiert sehen.8 Gräuel hingegen können eine Vielzahl von Verbrechen abdecken, von Verbrechen von Drogenbanden an unschuldigen Schulkindern bis hin zu Verbrechen, die von einzelnen Soldaten oder Soldatengruppen in einer Besatzungs- oder Bürgerkriegssituation begangen werden. Ähnlich können und sollten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Völkermord unterschieden werden, wenngleich sie sich an den Rändern zweifellos überlappen.
Viele finden das Wort Genozid außerdem zu allgemein und zu weitgehend verwendet. Sie würden je nach Situation und dem genauen Charakter der Zielbevölkerung präzisere Wörter wie Soziozid, Politizid, Ethnozid, Demozid, ja sogar Genderozid bevorzugen. Die Bezeichnung Genozid hat sich jedoch in der Praxis wie nur wenige andere in jüngster Zeit erfundene Begriffe bewährt. Die wissenschaftliche und juristische Fachliteratur ist umfangreich genug, um eine gängige Bedeutung und ein gemeinsames Verständnis festzulegen, wiewohl Behauptungen eines Genozids mitunter von der Berufung auf einen Sonderfall missbraucht werden und Regierungen wie Einzelpersonen Genozid durch definitorische Winkelzüge leugnen. Lemkin fand einen Begriff für vorsätzlichen Massenmord, der aussagekräftig und nachhallend, effektiv und von Dauer ist.
Dieses Buch geht ebenfalls davon aus, dass Genozid ein weltweites historisches Phänomen ist, das mit dem Beginn der menschlichen Gesellschaft in die Welt kam. Fälle von Völkermord müssen in ihrem zeitlichen Verlauf und ihrem jeweiligen Kontext untersucht werden. Sie sind mitunter auch als Ereignisse in einem zusammenhängenden Narrativ verknüpft, in dem frühere Fälle Einfluss auf spätere haben können. In manchen Fällen kann man von direkten Beispielen sprechen; in anderen sind diese Einflüsse in speziellen Kulturen verwurzelt. Das Alte Testament dient als Gründungstext für den Genozid in der abendländischen Kultur und seine Dramaturgie findet im Lauf der Jahrhunderte ihren Nachhall in Kommentaren und literarischen Darstellungen, die die vom Gott Israels verlangten Zerstörungsmuster widerspiegeln. Ähnlich begründeten die Schriften Thukydides über die Eroberung von Melos durch die Athener und über die verschiedenen Formen der Kriegsführung und Vernichtung der Spartaner philosophische Auseinandersetzungen über das Wesen des Genozids – in Abgrenzung zur Kriegsführung –, die in römische, mittelalterliche und frühneuzeitliche Texte Eingang fanden.9 Kein klassischer Fall eines Genozids hat sich vielleicht stärker in die abendländische Erinnerung der Neuzeit eingebrannt als die Erstürmung Karthagos durch die Römer, die durch die Reden Catos und die Werke Vergils in die Geschichte eingegangen ist.
Schriftliche Aufzeichnungen aus der Zeit der genozidalen spanischen Eroberung der Neuen Welt beriefen sich wiederholt auf die alten Griechen und Römer. Unterdessen wurde die spanische Conquista zum Modell für die Politik späterer Kolonialregierungen, so, wie Gegner der Auslöschung von Ureinwohnern in Australien und Nordamerika häufig auf die Schriften von Bartolomé de Las Casas, dem spanischen Dominikanermönch und Kritiker des brutalen Vorgehens der Spanier in der Neuen Welt, verwiesen.
Eine der ersten Beobachterinnen der Verflechtungen von verschiedenen Fällen von Völkermord war Hannah Arendt, die auf die Rolle kolonialer Brutalität und kolonialen Rassismus für die Entwicklung von Hitlers völkermörderischer Politik in Europa hingewiesen hat.10 Das weitverbreitete Töten der Ureinwohner in den französischen, britischen, italienischen und insbesondere deutschen Kolonien fand in gewisser Weise in den Massenmorden des Zweiten Weltkriegs seinen Niederschlag.11 Eine Reihe von Historikern hat auf die Kontinuität von Personal und Politik beim Vernichtungsfeldzug der deutschen Armee gegen die Herero und Nama in Südwestafrika (1904–1907), ihre beratende Rolle beim Völkermord an den Armeniern (1915) und die Rolle der Wehrmacht im Holocaust hingewiesen.12 Kurz vor dem Überfall auf Polen höhnte Hitler in seiner Rede vor Wehrmachtsgenerälen: „Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier.“ In derselben Rede führte Hitler das leuchtende Vorbild Dschingis Khans als Staatengründer an. Seine Botschaft war klar: Die deutsche Kriegsführung solle bei dem Angriff nicht vor der Ermordung einer großen Anzahl von Polen und Juden zurückschrecken.13
Nicht alle Genozide sind gleich. Manche werden innerhalb von Tagen oder Wochen verübt, andere dauern Jahrzehnte. Manche widerfahren Millionen Menschen, andere Tausenden. Manche sind stark zentralisiert, andere sind eher dezentral und sporadisch. Jeder Fall von Genozid ist in gewisser Weise einmalig, doch ebenso wahr ist, dass sie räumlich und zeitlich in mehr oder weniger ähnliche Arten von mörderischen Ereignissen eingeteilt werden können. Zu unterschiedlichen Zeiten fanden verschiedene Arten und Typen von Tötungen statt. Natürlich wissen wir sehr viel weniger über Genozide in der fernen Vergangenheit, in entlegenen Regionen und an den Peripherien großer Weltreiche ohne relativ umfangreiche schriftliche Aufzeichnungen. Dennoch besteht eine bemerkenswerte, ja geradezu beängstigende Ähnlichkeit im Hinblick auf die völkermörderische Gewalt der letzten drei Jahrtausende Menschheitsgeschichte.