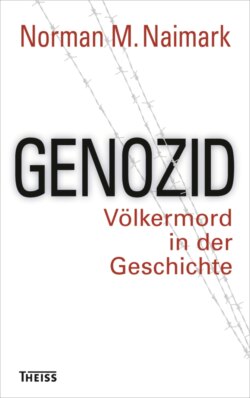Читать книгу Genozid - Norman Naimark - Страница 8
Die Antike
ОглавлениеEs lässt sich unmöglich mit Bestimmtheit sagen, ob die Vorgeschichte der Menschheit genozidale Situationen hervorgebracht hat. Aus der Untersuchung von ausgehobenen Gräbern schließen Archäologen und Anthropologen, dass es in vorgeschichtlicher Zeit zu Massakern und in einzelnen Fällen zu verschiedenen Formen von Folter und Kannibalismus kam. Homo sapiens, der Vorläufer des modernen Menschen, so wird mitunter behauptet, habe die letzten Spuren der Neandertaler-Population physisch ausgelöscht. Grabstätten haben zudem Hinweise auf Massentötungen durch Stämme und Clans von der Steinzeit bis zum Ende der Bronzezeit gegeben, was uns etwa bis ins Jahr 1200 v. Chr. führen würde. Vorgeschichtliche Grabstätten sind gleichwohl so verstreut und selten, dass es schwierig ist, zu verbindlichen Schlussfolgerungen über den Genozid als inhärentes Element der menschlichen Zivilisation vor den ersten schriftlichen Aufzeichnungen zu gelangen.
Die ersten Berichte von Völkermorden in der Antike sind uns durch schriftliche Zeugnisse überliefert, die Ereignisse von Jahrhunderten zuvor beschreiben. Die hebräische Bibel (das Alte Testament), die in verschiedenen Büchern und Schriften am Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. während der Herrschaft von König Joschija geschrieben wurde und angeblich Ereignisse um das Jahr 1200 v. Chr. beschreibt, kann selbstverständlich nicht als historische Quelle dienen, die das Leben der Israeliten korrekt wiedergibt. Wie das zweite Buch von Vergils Aeneis, das den legendären Untergang Trojas durch die Achäer um 1200 v. Chr. beschreibt, sollte die hebräische Bibel als literarisches Werk und als Mischung aus Fakt und Fiktion betrachtet werden, die den religiösen und politischen Zwecken der Gesellschaft, in der sie geschrieben wurde, diente. Der Nutzen der Archäologie ist sehr begrenzt, was insbesondere den Charakter und das Ausmaß an Massenmorden zu biblischen Zeiten angeht.
Leichter rechtfertigen lassen sich die historische Richtigkeit von Thukydides’ Peloponnesischem Krieg und seiner Schilderung der Unterwerfung von Melos (416–415 v. Chr.) sowie der Wahrheitsgehalt von römischen Berichten über die Zerstörung von Karthago (ca. 140 v. Chr.). Auch sie wurden jedoch wie die hebräische Bibel nicht so sehr als Geschichte geschrieben und rezipiert, sondern vielmehr als Möglichkeit, die Herausforderungen und Probleme für die Autoren, ihr Publikum und ihre Kulturen zu interpretieren.
Diese Darstellungen wurden noch Jahrhunderte und Jahrtausende später von Generationen von Staatenlenkern zur Rechtfertigung und als Modell für ihre eigenen Neigungen zum Völkermord verwendet. Diese Art von Bildern und Metaphern, die die Bibel und die „Klassiker“ durchdrangen, ist in den weltweiten Diskurs über Tötung und Vernichtung eingegangen.
Der Auszug der Juden aus Ägypten, ihre Wanderschaft durch die Wüste und die Eroberung des Landes Israel stellen den zentralen Erzählstrang des Alten Testaments dar. Als Gegenleistung für die Führung seines auserwählten Volkes und seine Zusicherung, die Israeliten gegen zahlenmäßig überlegene und mächtigere unheilvolle Feinde zu unterstützen, verlangte Gott Gehorsam. Insbesondere die Amalekiter, in der Wüste lebende Halbnomaden, zogen sich durch Angriffe auf die Israeliten den Zorn Gottes zu. Moses beauftragte Josua und seine Männer, gegen diese Feinde anzugehen, und sicherte den Sieg, indem er, gestützt von seinem Bruder Aaron und seinem Schwager Hur, von einem Hügel aus die Hand emporhielt. Dem Gott Israels reichte der militärische Sieg jedoch nicht und er sprach zu Moses: „Halte das zur Erinnerung in einer Urkunde fest und präg es Josua ein! Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen.“ Und Moses sprach: „Krieg ist zwischen Jahwe und Amalek von Generation zu Generation.“1
Zum Abschluss der Schilderung von der Zerstörung Amaleks erzählt das Buch Samuel eine der eindringlichsten Geschichten von Völkermord im Alten Testament, ja der Menschheitsgeschichte überhaupt. Der Prophet Samuel kam zu Saul, um ihn zum ersten König des Volkes Israel zu salben. (Saul soll von 1079 bis 1007 v. Chr. gelebt haben.) Wie Samuel erklärte, habe Gott Saul angewiesen, die Amalekiter aufgrund ihrer Übergriffe auf die Israeliten bei der Flucht aus Ägypten anzugreifen und zu töten. „Darum zieh jetzt in den Kampf und schlag Amalek! Weihe alles, was ihm gehört, dem Untergang! Schone es nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel!“2 Dem Buch Samuel zufolge versammelte Saul daraufhin 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Soldaten aus Juda – zweifellos maßlos übertriebene Zahlen – und griff die Amalekiter in ihrer Hauptstadt an. Dabei weihte Saul „das ganze Volk […] mit scharfem Schwert dem Untergang“, verschonte jedoch den edlen König Agag und erlaubte seinem Volk, die besten der Schafe und Rinder zu behalten. Diese Ausnahmen erzürnten den Gott Israels; Saul hatte seine Befehle nicht vollständig ausgeführt. Aus Verärgerung hieb Gott Samuel vor den Augen des „Agag in Stücke“, entriss Saul das Königtum und ersetzte ihn schließlich durch David,3 denn Saul war der Anweisung des Herrn nicht gefolgt und hatte nicht alles restlos der Vernichtung geweiht.
Später führte König David selbst Feldzüge gegen die Amalekiter, steckte ihre Städte in Brand, tötete Knaben und Männer und nahm ihre Frauen gefangen. Einmal gelang es ihm, seine zwei Frauen vor ihnen zu retten und ihre Beute aus dem Land Juda zurückzugewinnen. Als er die Räuberbande eingeholt hatte, fiel David „im Morgengrauen über sie her [und der Kampf dauerte] bis zum Abend des folgenden Tages; keiner von ihnen entkam, außer vierhundert jungen Männern, die sich auf ihre Kamele setzen und fliehen konnten.“4
Die Amalekiter waren nicht das einzige Volk in der Region, das den Zorn Gottes und seines auserwählten Volkes auf sich zog. Der Gott Israels versprach den Israeliten, viele Völker – die Amoriter, Hethiter, Perisiter, Kanaaniter, Hiwiter und Jebusiter – „auszutilgen“. So lesen wir im Alten Testament: „Wenn der Herr, dein Gott, sie dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du sie der Vernichtung weihen. […] Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen.“5 Hier spricht der Gott Israels nicht nur von Genozid, sondern auch von kulturellem Genozid. Diese Völker konnten die Israeliten potenziell mit ihren Religionen und Bräuchen verderben und mussten daher ausgelöscht werden. „Sie sollen nicht in deinem Land bleiben. Sonst könnten sie dich zur Sünde gegen mich verführen, sodass du ihre Götter verehrst; denn dann würde dir das zu einer Falle.“6 Die Sprache der Massentötung im Deuteronomium ist sogar noch schärfer. „Wenn der Herr, dein Gott, sie [die in Kanaan lebenden Völker] dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du sie der Vernichtung weihen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht verschonen.“7 Das Deuteronomium ruft die Israeliten außerdem nachdrücklich zum kulturellen Genozid auf: „So sollt ihr gegen sie vorgehen: Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen.“8 Als wäre dies nicht genug, versprach Gott, den Überlebenden und Flüchtigen dieser Völker eine Seuche aufzuerlegen und sie so zu zerstören.
Um diese und andere Fälle von „Vernichtungsweihe“ zu beschreiben, verwendet das Alte Testament das hebräische Wort herem, das sowohl physische als auch metaphysische Vernichtung bezeichnet.9 Das Schicksal der Bewohner innerhalb der Grenzen der neuen Heimat der Israeliten war damit besiegelt: „Aus den Städten dieser Völker jedoch […] darfst du nichts, was Atem hat, am Leben lassen.“10 Völker in entlegeneren Regionen, in denen die Israeliten keine direkten Hegemonieansprüche stellten, konnten mit mehr Nachsicht behandelt werden. Wenn ihre Städte zur Kapitulation bereit waren, konnten ihre Einwohner zum „Frondienst“ verpflichtet werden. Andernfalls würden ihre Städte belagert, ihre Männer erschlagen und ihre Frauen, Kinder und ihr Vieh als Beute genommen.11
Obwohl die Zerstörung Jerichos selten als Genozid behandelt wird, ist sie die vielleicht bekannteste Kriegserzählung der Bibel. Bei der ersten Begegnung der Israeliten mit ihrem neuen Gebiet, ein manchmal auf 1200 v. Chr. datiertes Ereignis, sandte Gott Josua, um die Hochburg der Kanaaniter, Jericho, „die Palmenstadt“ westlich des Jordans, zu zerstören. Nach der anschaulichen Schilderung der Schlacht im Alten Testament marschierten Josua und seine Krieger, angeführt von Hörner blasenden Priestern, siebenmal um die Stadtmauer herum, bis der Hörnerschall die Mauer zum Einstürzen brachte. In typischer Manier weihten Josuas Krieger dann „mit scharfem Schwert alles, was in der Stadt war, dem Untergang, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel“.12 Jericho wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht. Josua beendete seinen Feldzug mit einem schaurigen Eid, der den Wiederaufbau der Stadt verbietet.
Damals schwor Josua: Verflucht beim Herrn sei der Mann, der es unternimmt, diese Stadt Jericho wiederaufzubauen. Seinen Erstgeborenen soll es ihn kosten, wenn er sie neu gründet, und seinen Jüngsten, wenn er ihre Tore wiederaufrichtet.13
Es gibt nur wenige archäologische Zeugnisse oder damit verbundene Textstellen, die irgendeinen dieser vermeintlichen Vorfälle von Genozid im Alten Testament als geschichtliches Ereignis stützen.14 Wichtiger als die Historizität der beschriebenen Zerstörung von Völkern und Städten ist jedoch das, was die biblischen Genoziddarstellung über die Vorstellungswelt von Männern und Frauen in der Antike sowie die möglichen oder gar wahrscheinlichen Beziehungen zwischen Nationen aussagen und welche Vorbilder, Muster und Normen sie für die Zukunft schufen. Die Anführer der Israeliten – Moses, Samuel, David und Josua – führten bei ihren Massenmorden Gottes Willen aus. In manchen Fällen waren die Tötungen Vergeltungsakte für angebliche Taten gegen das Volk Israel. In den meisten Fällen wurden Menschen jedoch angegriffen und vernichtet, weil sie in dem Gelobten Land lebten, dass Gott den Israeliten versprochen hatte. Die Getöteten seien selbst schuld an ihrem Schicksal, hieß es – ein weitverbreitetes und im Lauf der Jahrhunderte wiederkehrendes Phänomen bei Massenmorden. Frauen und Kinder wurden mitunter verschont und zu Sklaven und Konkubinen oder Ehefrauen gemacht.
Kultureller Genozid war ebenfalls ein wichtiger Teil der biblischen Erzählung. So wurden nicht nur ganze Völker ausgelöscht, sondern auch ihre Tempel niedergerissen und ihre Städte in Schutt und Asche gelegt. Sicherlich betrifft keine dieser in der hebräischen Bibel beschriebenen Handlungen ausschließlich die Israeliten der Antike (oder späterer Zeiten). Wie Wissenschaftler des alten Israel anhand von archäologischen Funden festgestellt haben, beteiligten sich die Nachbarn der Israeliten – die Philister, Phönizier, Aramäer, Moabiter und Edomiter – an vielen ähnlichen Aktionen.15 Der Gebrauch bestimmter literarischer Stilmittel in der hebräischen Bibel lässt sich außerdem besser verstehen, wenn wir ihn mit anderen großen historischen, mythenschweren Dokumenten aus der Zeit und der Region vergleichen: mit der Lehre des Amenemope, dem Gilgamesch-Epos und den Archiven von Ugarit.16
Von überragender Bedeutung für die weitere Geschichte des Genozids waren jedoch die Vorstellungen und Bilder, die über die Jahrtausende fortdauerten und Leser unabhängig von ihrer Wahrheitstreue bei Massentötungen an ein biblisches Ausmaß denken ließen. Der schockierende moralische Imperativ, der mit dem Beharren des Gottes Israels auf Massenmord verbunden ist, hat auch die Geschichte des Genozids in Kulturen gefärbt, die von den ersten Anfängen bis zur Neuzeit der jüdisch-christlichen Tradition zuzuordnen sind.
Auch in der Kultur des alten Griechenlands von der mykenischen Zeit im zweiten Millennium v. Chr. über die klassische und hellenistische Zeit bis zur Eroberung durch die Römer 146 v. Chr. war Genozid kein unbekanntes Phänomen. Das grundlegende Modell der Zerstörung stammt dort aus den gesammelten mythologischen Erzählungen und Geschichten über den Trojanischen Krieg, wie sie in den Werken Homers und anderer griechischer Dichter im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. auftauchen. (Der Trojanische Krieg wird von den klassischen Griechen, selbst dem vorsichtigen Thukydides, auf das 13 oder 12. Jahrhundert v. Chr. datiert.) Homers Beschreibungen des letzten Jahrs der Belagerung Trojas am Ende der seit beinahe zehn Jahren immer wieder aufflammenden Kämpfe in der Ilias sind blutrünstig und voller Brutalität. Agamemnon, der König von Mykene und Heerführer der Achäer gegen Troja, ermahnt seinen Bruder Menelaos (den Ehemann der entführten Helena):
O Lieber! o Menelaos! Was sorgst du dich so sehr um diese Männer? Oder ist dir zu Haus von den Troern das Beste geschehen? Nein, von denen soll keiner entgehen dem jähen Verderben Und unseren Händen. Auch nicht, wen im Leib die Mutter Trägt als einen Knaben: auch er soll nicht entrinnen! Sondern allesamt Sollen sie gänzlich vertilgt sein aus Ilios, unbestattet und spurlos!17
Die Achäer metzelten daraufhin die heroischen Verteidiger Trojas nieder. Niemand durfte sich ergeben; trojanische Kämpfer wurden getötet, die Frauen vergewaltigt und ermordet, ihre Kinder vom Erdwall geworfen. Homer schildert eine große und reiche Stadt, deren Bewohner massakriert und deren Reichtümer geplündert und beschlagnahmt wurden. Die Stadt wurde schließlich in Schutt und Asche gelegt und viele Bewohner kamen in den Flammen ums Leben. Vergils Aeneis, die die Geschichte des letzten Trojaners, Aeneas, und seiner Flucht aus Kleinasien bis zu seiner Gründung von Rom erzählt, zeichnet ein ähnliches Bild des trojanischen Blutbades. „Oh, wer kann das Gemetzel der Nacht und die Menge der Leichen schildern? Wer hat für die Not und Qual hinreichende Tränen? […] Rings in den Straßen und Häusern umher, auf der Götter geweihten Schwellen zerstreut sieht man hilflos die Gefallenen liegen. […] Rings grausiger Jammer, rings Entsetzen und ringsum Tod in tausend Gestalten!“18 Ob diese Darstellung der erfolgreichen Unterwerfung Trojas durch die Achäer (Archäologen bezeichnen sie als Troja VII) ein Fall von Völkermord war, ist historisch nicht abgesicherter als die Beschreibung von Josuas mörderischer Zerstörung Jerichos in der hebräischen Bibel. Wie die biblischen Ereignisse wurde die blutige Gewalt des Trojanischen Krieges jedoch von späteren Kulturen, die diese Verse lasen, vortrugen und ihre Schönheit sowie ihren Schmerz noch einmal durchlebten, abgerufen, erinnert und übernommen.
Thukydides schrieb seine Geschichte des Peloponnesischen Kriegs im Lauf des 27-jährigen Konflikts zwischen Athen und Sparta gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. Der zu Recht als der erste „kritische Historiker“ geltende Thukydides war als Stratege an dem Krieg beteiligt gewesen und hatte aus dem langen und bitteren Kampf wichtige Lehren in Militärgeschichte und internationaler Politik gezogen. In dem Melierdialog aus dem 16. Kriegsjahr erzählt er eine Geschichte von Völkermord, die den „rationalen“ Charakter seiner Wurzeln in der Antike betont. Die Athener nutzten ihre mächtige Marine, um nach und nach ihre Herrschaft auf alle ägäischen Inseln auszuweiten. Das Athenische Reich verlangte die Unterwerfung der Insel Melos, einer Kolonie der Lakedämonier (Spartaner). In ihrer Wechselrede mit den Anführern von Melos betonten die Athener, aufgrund der historischen Rechte ihres Reiches oder „aufgrund des uns durch euch zugefügten Unrechts“ (die Melier hatten im Krieg strengste Neutralität gewahrt) hätten sie kein Interesse daran, ihre Forderung nach Unterwerfung zu rechtfertigen. Vielmehr hielten sie es für vorteilhaft, ihre Vorherrschaft auf die Inseln, insbesondere die ehemaligen Kolonien von Sparta, auszudehnen. Sollte Melos sich nicht unterwerfen, würden die Athener ihre Bewohner vernichten.
Fragen von Identität spielten auch im Konflikt mit den Meliern eine zentrale Rolle. Die Unterwerfung der Insel war für die Anführer der Athener von entscheidender Bedeutung, um in den Augen ihres eigenen Volkes und in denen des Feindes stark und unbezwingbar zu erscheinen. Wie die Athener erklärten, würden ihre Bürger sie für schwach halten, wenn sie den Meliern ihre Unabhängigkeit ließen, und sie fügten hinzu: „Abgesehen von der Vergrößerung unserer Herrschaft würdet ihr uns daher auch Sicherheit durch eure Unterwerfung bieten, wenn ihr als Insel, noch dazu eine der schwächsten, euch uns Seebeherrschern gegenüber nicht behaupten könnt.“ Die Melier hofften vergeblich auf Hilfe von den Lakedämoniern oder auf ein Einlenken der Athener in einem Friedensvertrag und lehnten eine Unterwerfung ab. Es kam, wie es kommen musste, schreibt Thukydides: Die Athener „töteten alle erwachsenen Männer, die sie ergreifen konnten, die Kinder und Frauen verkauften sie in die Sklaverei. Sie selbst gründeten den Ort neu und schickten etwas später 500 Siedler dorthin.“19
Man darf davon ausgehen, dass die Maßnahmen der Athener den Aktionen ihrer Rivalen, der Spartaner, einer militaristischen Sklavenhaltergesellschaft aus Kriegern und Eroberern, in nichts nachstanden. Bei Thukydides lesen wir etwa, dass die Spartaner während des Peloponnesischen Krieges „ziemlich alle, die sie auf dem Meer ergriffen, als Feinde [umbrachten], sowohl die Kampfgenossen der Athener als auch die Parteilosen“. Sie massakrierten die Einwohner von Feindesstädten, die sie belagerten und eroberten. Bei der Eroberung der Stadt Hysiai „töteten sie alle freigelassenen Sklaven, die ihnen in die Hände fielen“. Die grausame Behandlung ihrer Sklaven (Heloten) kannte keine Grenzen. Innere Unruhen und Rebellionen wurden mit den entsetzlichsten Strafen geahndet.20 Sowohl die Athener als auch die Spartaner waren laut Thukydides deutlich befremdet vom eigenartigen Wesen der eroberten und ermordeten sowie in den schlimmsten Fällen völkermörderisch ausgelöschten Feinde.
Alle großen Reiche zehren anscheinend von ihrer Rivalität und schöpfen aus ihr Kraft. Dies galt für Rom und Karthago ebenso wie für Athen und Sparta. Die Römer waren die legendären Erben von Aeneas, dem letzten Trojaner, während die Karthager vom Seefahrervolk der Phönizier abstammten, die um rund 1000 v. Chr. die Stadt Karthago am Ort des heutigen Tunis gegründet hatten. In den ersten beiden Punischen Kriegen zwischen Rom und Karthago 264–241 v. Chr. und 218–202 v. Chr. wüteten die Kämpfe im gesamten westlichen Mittelmeer; die Karthager brachten ganz Nordafrika und Spanien unter ihre Kontrolle und besetzten mit Hannibals bemerkenswerter Überquerung der Alpen weite Teile des italienischen Stiefels, wenngleich sie nie Rom einnahmen. Gegen Ende des Zweiten Punischen Kriegs (201 v. Chr.) war Karthago gezwungen, sich aus Sizilien und Italien zurückzuziehen und sich auf eine relativ kleine Ecke in Nordafrika zu beschränken. Die Stadt war dennoch groß – Schätzungen zufolge hatte sie bis zu 750.000 Einwohner – und geschäftstüchtig; sie trieb Handel im gesamten Mittelmeer und verkehrte über den Atlantik sogar mit dem heutigen Großbritannien.
Karthago konnte mit Rom leben; Rom jedoch konnte Karthago nicht dulden. Das Mittelmeer war nach Sicht der Römer nicht groß genug für beide.21 Marcus Porcius Cato, der Zensor, soll jede seiner Reden im römischen Senat mit den Worten Delenda est Carthago („Karthago muss zerstört werden“) beendet haben. Er hegte einen glühenden Hass auf diesen so empfundenen giftigen Stachel im Fleische Roms. Der vordergründige casus belli für den Dritten Punischen Krieg, auf den der römische Senat – und nicht nur Cato – gedrängt hatte, waren die Feindseligkeiten zwischen den Karthagern und dem numidischen König Massinissa, der mit Unterstützung Roms Forderungen an Karthago stellte. Als Karthago auf gewaltsame Strafe gegen die Numidier drängte, erklärte Rom im Jahr 149 v. Chr. Karthago den Krieg. Die Karthager gingen zunächst auf die römischen Forderungen ein, bis die Römer verlangten, Karthago müsse vollständig zerstört werden und seine Bewohner müssten sich außerhalb einer Zone von zehn Meilen um das Meer neu ansiedeln. Zu diesem Zeitpunkt setzten sich die Karthager durch, die auf Ungehorsam drängten, und begannen eine zweijährige Verteidigung der Stadt unter römischer Belagerung.
Anfang 146 v. Chr. drangen die römischen Legionen unter Scipio Aemilianus schließlich in die Stadt ein und kämpften Straße für Straße mit den Verteidigern. Tausende Karthager wurden ermordet, bevor die Stadt vollständig besiegt wurde. Die Überlebenden wurden in die Sklaverei verkauft und die Stadt gemäß Catos Anordnung bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Bis heute findet man Verweise auf das nicht belegte „Salzen“ der Stadt durch die Römer, damit sie nie wieder auferstehe. Ob Wahrheit oder Legende, trifft die Geschichte den Geist der genozidalen Absichten der Römer in Karthago. Die Menschen sollten beseitigt, ihre Stadt sollte dem Erdboden gleichgemacht und ihre Kultur nicht länger geduldet werden. Nach der Niederlage bezeichnete der römische Senat die Gebiete Nordafrikas außerdem nicht mehr als Karthago, sondern nur noch als eine provincia namens „Afrika“.22 Ähnlich sollte die Erinnerung an Karthago getilgt werden. Wie die legendäre Zerstörung Trojas, die zur Erbauung Roms führte, sollte Karthago der totalen Herrschaft Roms im Mittelmeer geopfert werden.
Die hier skizzierten Narrative der Zerstörung scheinen weit entfernt von unserer heutigen Welt und den Genoziden, über die wir heute sprechen. Das Salzen der Erde, das Halten von Sklaven oder Konkubinen, die Allgegenwart von Rachemotiven, die Tieropfer für die Götter (und Gott) und die Unmenschlichkeit des Lebens selbst befremden in der Moderne mit ihrer Strafverfolgung von Krieg und Massenmord, ganz zu schweigen von der täglichen Routine von Arbeit und Freizeit. Das Wesen des Genozids zeichnet sich jedoch zeitübergreifend durch zahlreiche gemeinsame Merkmale aus. Armeen von Männern töten identifizierbare Menschengruppen, darunter Frauen, Kinder und Nichtkombattanten auf Geheiß ihrer politischen Führer, die sich in ihren Gründen für die Zerstörung häufig auf Ideologien, Götter und Gott berufen. Die Tötungen sind vorsätzlich, vollständig und zielen auf Vernichtung ab.
Genozide wurden in der Antike oft jenseits der nur vage definierten Grenzen des Staatsgebiets der Täter verübt, um wie im Fall der Athener und Römer neues Herrschaftsgebiet zu erobern oder aber wie im Fall der Israeliten potenzielle Feinde auf Gebieten zu eliminieren, auf die die Invasoren Anspruch erhoben. Auch Vergeltung für angebliche Rechtsverletzungen in der Vergangenheit dient wie im Fall der Römer in Karthago und der Israeliten mit den Amalekitern als Rechtfertigung für Völkermord. Völkermordkampagnen sind von imperialem Ruhm, Stolz und Überlegenheitsgefühlen durchdrungen. Die Athener, die in Thukydides’ Darstellung der Belagerung von Melos rein rationales Denken für sich beanspruchen, können kaum die Hybris eines Reichs verdecken, das sich durch jegliche Opposition gekränkt fühlte und bereit war, seine eigenen Hegemonievorstellungen durch Massentötungen durchzusetzen.
Kulturelle Genozide haben tiefe Spuren in den Mustern von Kriegen und Konflikten in der Antike hinterlassen. Die Städte und Kulturen von Jericho, Troja und Karthago wurden geplündert und niedergebrannt. Alles musste vernichtet werden: Tempel, Statuen, alle Spuren einstigen Ruhms. Sofern sie verschont blieben, wurden Frauen und Kinder mit Gewalt in die Kulturen der Täter assimiliert. In den wenigen Fällen, wo Knaben und Männer die Angriffe überlebten, mussten sie in den Armeen der Sieger dienen. Es lässt sich nur ahnen, wie viele Kulturen und Völker durch Genozid und kulturellen Genozid in der Antike ausgelöscht wurden, doch ihre Anzahl war zweifellos erheblich.