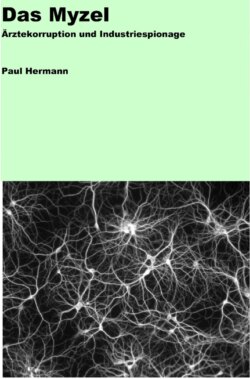Читать книгу Das Myzel - Paul Hartmann Hermann - Страница 12
12. Oberpfalz im Herbst/Winter 1977
ОглавлениеK. kannte das Mädchen nur flüchtig. Er hatte immer mal wieder ein paar Worte mit ihr gewechselt. Sie war Stationshilfe, was weniger war als Stationsschwester. Sie war nur angelernt und durfte die Putzarbeiten machen. Essenaustragen war auch dabei. Sie war sehr schüchtern und hatte wohl Angst vor dem neuen Stationsarzt K., der seinerseits Angst vor der neu übertragenen Aufgabe hatte. Er war erst vor drei Monaten mit seinem Medizinstudium fertig geworden und sollte jetzt bereits eigenverantwortlich eine Station in der Inneren Medizin leiten.
Zur damaligen Zeit - es war Mitte der 1970er Jahre - waren Ärzte absolute Mangelware. Eine kleine Anzeige im Deutschen Ärzteblatt reichte aus und man bekam dutzende von Angeboten. K. wollte möglichst viel in kurzer Zeit lernen. Dazu hätte er eigentlich nach Lambarene gehen müssen. Aber er musste gar nicht so weit reisen. Sein Buschkrankenhaus lag in der Oberpfalz in einem kleinen abgelegenen Ort. Dort befand sich ein kommunales Landkrankenhaus, wie es typisch war für die damalige Kliniklandschaft. Das Kreiskrankenhaus hatte gerade mal 120 Betten in drei Abteilungen, der Inneren Medizin, der Chirurgie und der Geburtshilfe. Die dortige Tätigkeit versprach neben den Lerneffekten reichlich Nacht- und Wochenenddienste, welche gut honoriert wurden. K. war endlich auf den fetten Weiden angekommen.
K. fing bei Dr. Ebel, dem Chefarzt der Inneren Medizin, an. Bereits nach wenigen Wochen hatte K. begriffen, dass es sich bei Ebel um einen Schmalspurinternisten handelte. Der tauchte immer dann ab, wenn es brenzlig, also interessant im medizinischen Sinne wurde.
Damals lernte der noch mit ideellen Vorstellungen beseelte K. allmählich, dass bei der Besetzung von wichtigen Positionen das Wissen und die Leistung das eine und die Beziehungsgeflechte das andere sind. Dr. Ebel war Oberarzt an einem anderen Krankenhaus gewesen, welches ebenfalls zum Landkreis gehörte. Da wurde eines Tages der Landrat mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert. Ebel konzentrierte alle seine Energie und Empathie auf diesen einen Erkrankungsfall. Beide, der Doktor und der Landrat hatten Glück. Es war gar kein Herzinfarkt, sondern nur eine Überlastungsreaktion mit Kollaps gewesen. Der Vorgang hatte sich positiv in der Erinnerung des Landrats niedergeschlagen. Als die neue Chefarztstelle ausgeschrieben worden war, da war natürlich Herr Dr. Ebel der unumstrittene Favorit des mächtigen Lokalpolitikers.
Die Spezialität von Chefarzt Ebel waren so genannte Magendarmpassagen, welche schon damals obsolet geworden waren. K. war es schleierhaft, wie man in den wolkigen Röntgenbildern des geschluckten Bariumbreis Magengeschwüre, Zwölffingerdarmgeschwüre oder gar Magenkarzinome entdecken wollte. Zumal es seit wenigen Jahren eine alternative Methode für die Diagnostik derartiger Erkrankungen gab: Die Endoskopie hatte ihren Siegeszug begonnen. Nur hatte es der Chefarzt nie geschafft, sich die erforderliche Untersuchungstechnik anzueignen, obwohl ihm der Landrat eine brandneue endoskopische Untersuchungseinheit spendiert hatte.
Ärzte, die an größeren Zentren die Technik des Gastroskopierens erlernt hatten, waren rar und meist nicht dazu zu bewegen, sich in die Diaspora der Oberpfalz zu begeben. Also blieb es der Eigeninitiative der Assistenten überlassen, den Schlauch zu schieben. Derjenige, der schon länger da war hatte die Endoskopietechnik vom Vorgänger gelernt und gab sein Wissen an die neuen weiter.
Das verlief nicht immer reibungslos. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Die eine oder andere Magenwandperforation durch ungeschicktes oder ungestümes Vorwärtsschieben des daumendicken Schlauches war da nicht zu vermeiden.
Es wurden anfänglich viel zu wenige Biopsien aus der Schleimhaut des Magens und des Zwölffingerdarms genommen, wenn man in letzteren mit dem Fiberendoskop überhaupt rein gekommen war. Die Flexibiltät der ersten Gerätegeneration ließ noch zu wünschen übrig. Dadurch lagen zu wenige histologische Ergebnisse vor, man verengte unnötigerweise das diagnostische Fenster und übersah gelegentlich pathologische Befunde.
Die Krankenhausdienste entpuppten sich am Wochenende als höllische 72-Stunden-Schichten. Man war alleine für drei medizinische Abteilungen verantwortlich, mit einem Oberarzt im Hintergrund, der mächtig maulte, wenn er außer der Reihe antreten musste. Durchschlafen für den Diensthabenden ging nicht. Bei reichlich 100 belegten Betten war rund um die Uhr immer was los.
Die wirkungsvollste Entlastungsstrategie war das Gutstellen mit der erfahrenen alt gedienten Stationsschwester. Sie entschied in der Regel, ob der Doktor raus musste. Und wenn er dann aufgestanden war, dann sagte sie ihm, was am besten zu tun sei. K. lernte in wenigen Monaten von den Schwestern mehr als er jemals im Medizinstudium mitbekommen hatte.
Damit der Doktor den Patienten gegenüber als kleiner Halbgott in weiß auftreten durfte, musste der Jungarzt einen Obolus entrichten. Das Mindeste waren Respekt und Nachsicht gegenüber dem Personal. Einer der Assistenzärzte tat zu viel des Guten. Er vögelte die fette Oberschwester auf seiner Station fast täglich im Nachtdienstzimmer. Dafür hielt sie ihm den Rücken frei, auch dann, wenn er wieder einmal alkoholisiert den Dienstantritt verpasst hatte. Die Methode kam für K. weniger infrage, denn ihm war völlig klar, dass so was nur vorübergehend die Spannung aufrecht erhält und bei Verweigerung, die irgendwann unvermeidbar wird, die Geilheit in tief sitzenden Hass umkippt. Dann wird es ganz besonders ungemütlich.
Und jetzt hatte Gott der Allmächtige es zugelassen, dass die harmlose, dienstbeflissene und erzkatholische Stationshilfe schwer erkrankt war und um ihr Leben kämpfen musste. Sie lag auf der Krankenstation, auf der sie schon zwei Jahre Dienst tat. Warum ausgerechnet dieses bescheidene zurückhaltende Wesen? Warum hatte es nicht die dicke nymphomane Oberschwester erwischt?
Unter der transparenten Plastikplane des Sauerstoffzeltes verschwammen die Konturen ihres Gesichts zu einem Madonnenantlitz, so als wenn ein halber Meter Wasser über ihr gewesen wäre. Diese optische Dämpfung milderte das Dunkelblau ihrer Lippen ab und verwischte ihre kraftlosen Bewegungen in ihrem Kampf, den sie noch vor Mitternacht verloren haben würde.
Durch eine heimtückische Virusinfektion war ihre Lunge angeschwollen. Der pulmonale Gasaustausch wurde immer mehr behindert. Seit Tagen versuchte ihr Organismus durch vertiefte Atmung genügend sauerstoffhaltige Luft in die Lungenbläschen zu bringen. Die damit verbundene körperliche Anstrengung laugte sie zusätzlich aus.
Die Engel hatten schon die Leiter an die Wolke gestellt, um dem Erdenkind den Weg nach oben zu weisen. Der Pastor war da, die nächsten und ferneren Anverwandten hatten sich um das Bett geschart. Die Firmungskerzen brannten, sie flackerten rechts und links neben dem Kopfende des Bettes. Der Pastor murmelte das Sakrament der letzten Ölung.
K. war unruhig. Er fürchtete, dass auch noch ein Vertreter der örtlichen Zeitung auftauchen würde. Ihre Familie und sie galten als recht schaffende Glieder der katholischen Gemeinde, welche durch Gottesehrfurcht, Bescheidenheit und CSU-Mitgliedschaft ihre hehre Gesinnung unter Beweis stellten und im Örtchen bestens vernetzt waren.
Ausgerechnet jetzt war eine der Infusionsflaschen leer gelaufen. K. drückte sich als verantwortlicher Arzt – der Chefarzt hatte sich wie immer in solchen Situationen unauffindbar gemacht – in der hintersten dunklen Ecke des Krankenzimmers herum. Ihm fehlte einerseits der Mut sich zu entfernen, andererseits musste er jetzt all seine Courage zusammen nehmen, um nach vorne ins Kerzenlicht zu treten, damit er die leere gegen eine volle Infusionsflasche auswechseln konnte. Es war klar, dass es völlig gleichgültig sein würde, ob da noch etwas Flüssigkeit in diese arme Kreatur hineinlaufen würde oder nicht. Trotzdem musste er dafür sorgen, dass die Infusion weiter lief, weil es sonst natürlich geheißen hätte, dass die Unterbrechung der venösen Flüssigkeitszufuhr ihr endgültig den Garaus gemacht habe.
Also begab sich der junge Assistenzarzt K. mit der Flasche in der Hand zum Infusionsständer. Nur widerwillig teilte sich die Menschenmenge. Du bist schuld, dass dieses brave Menschenkind jetzt sein Leben aushauchen muss. Du hast die Pneumonie nicht rechtzeitig diagnostiziert. Sie war doch bei dir! Du hast sie abgehört und dann zu ihr gesagt: Ist nicht so schlimm, du hast einen schweren grippalen Infekt, geh nach Hause, leg dich hin und trinke viel. Und jetzt kommt dieser Exekutor und legt letzte Hand an.
Egal was er gemacht hätte, alles wäre falsch gewesen. Mehr als 10 Augenpaare beobachteten, wie er ungeschickt die Flaschen umstöpselte. Er vermied Augenkontakt und stolperte wieder zurück in die schützende Dunkelheit des hinteren Raumes. In der gespenstischen Szenerie hörte er das Gemurmel der im Bittgebet Versunkenen, die Perlen der Rosenkränze glitten durch die Finger der Gläubigen, manch einer bekreuzigte sich und K. wollte nur noch weg.
Der Einzige, der ihm Unterstützung gewährte, war Grosser, ein anderer blutiger Anfänger. Er hatte einige Monate nach K. auf der Station angefangen zu arbeiten. Seine Schicht war schon längst zu Ende gegangen. Trotzdem harrte er im Sterbezimmer mit aus.
Chefarzt Ebel blieb wie vom Erdboden verschluckt. Man kannte das bereits zur Genüge. Je prekärer die Situation, desto flüchtiger war Ebel. Neulich beim Herzstillstand einer Dreiundachtzigjährigen war er im Krankenzimmer zugegen gewesen. Da konnte er nicht abhauen. K. sah, wie er notgedrungen eine Herzdruckmassage startete und den typischen Fehler aller ungeübten Reanimateure beging. Er ließ die alte Frau im weichen Bett liegen. Die Druckstöße, ausgeführt mit seinem auf das Brustbein aufgesetzten Handballen komprimierten die Matratzenfedern aber nicht den Brustkorb der alten Dame. Vor lauter Hektik vergaß er die Mund-zu-Mund-Beatmung.
K. konnte das nicht mehr mit ansehen. Er schob den Chef zur Seite und zerrte die Patientin auf den harten Boden. Bei seinem ersten Bruststoß knackten einige Rippen, das zeigte den richtigen Kraftaufwand an.
„Ich drücke hier weiter und sie machen die Beatmung“, befahl er dem Chefarzt. Dieser schaute ihn verständnislos an.
„Nun los, machen sie schon“, keuchte K. Er täuschte körperliche Überanstrengung bei der Herz-Druck-Massage vor, um dem Chef ja keine Möglichkeit zum Entwischen zu geben. Dr. Ebel schaute angewidert auf die dünnen schrundigen Lippen der alten Dame, eine Schleimspur lief ihr aus dem rechten Mundwinkel, und wieder traf er die falsche Wahl. Anstatt ihr den Mund zuzuhalten und sie über die Nase zu beatmen, presste er seine Lippen auf die welke Mundpartie. K. beobachtete das mit klammheimlicher Freude, er hatte den angenehmeren Part.
K. sah, wie die Oberkieferzahnprothese der Dame verrutscht war. Er herrschte den Chef an: „Entfernen sie doch vorher die Zähne!“
Ebel griff mit spitzen Fingern in den Mundraum und fischte die Prothese raus. Daran hingen noch Reste des Spinats, den es zum Mittagessen gegeben hatte. Das ist nur eine kleine Strafe für dein permanentes Verpissen, dachte sich K.
Erst vor ein paar Tagen hatte Ebel K. wieder mal sitzen lassen. Mit dem Krankenwagen war eine junge Frau mit einem frischen Schlaganfall und ausgeprägten neurologischen Ausfällen eingeliefert worden. Es sprach alles für eine Massenblutung im Gehirn, wahrscheinlich aus einem geplatzten Aneurysma. Der Frau ging es zunehmend schlechter, sie war kaum noch ansprechbar. Hier wäre eine dringende neurochirurgische Intervention mit Öffnung des Schädels und Unterbinden der Blutung erforderlich gewesen. Doch einen solchen Eingriff beherrschte keiner im kleinen Landkrankenhaus. Die nächste neurochirurgische Abteilung war jedoch 60 Kilometer entfernt.
„Was sollen wir bloß tun?“, fragte K. den Chefarzt verzweifelt, „sie wird uns unter den Händen sterben.“
„Das glaube ich nicht, sie ist jetzt mit allem was uns zur Verfügung steht, versorgt worden. Wir lassen sie mit Blaulicht zum neurochirurgischen Kollegen bringen.“
„Aber das wird sie nicht überleben. Bis sie da unter das Messer kommt, vergehen noch mindestens drei Stunden.“
„Herr Kollege, ich empfehle die Verlegung.“ Ebel klang sehr bestimmt. „Wir können bei uns nichts mehr weiter tun. Der Krankenwagen ist schon da. Wenn sie die Formalien noch übernehmen könnten. Ich habe einen dringenden Termin.“ Sprachs und wart nicht mehr gesehen.
Mit einem äußerst unguten Gefühl übergab K. die Patientin den Sanitätern und empfahl, ordentlich Gas zu geben. Dann informierte er telefonisch den neurochirurgischen Kollegen, was da auf ihn zukommen würde. Nach knapp zwei Stunden rief ihn dieser zurück.
„Sagen sie mal, machen sie das immer so?“, fragte der Kollege am Telefon.
„Was meinen sie damit?“ K. ahnte, worauf der hinaus wollte.
„Na, dass sie Patienten zum Sterben im Sanka über Land fahren lassen?“
„Eigentlich ist das nicht mein Stil“, stotterte K., „aber Herr Chefarzt Ebel war der Meinung, dass sie gut versorgt sei und den Transport auch gut überstehen würde.“
„So, so, Chefarzt Ebel, na dann sagen sie dem Mann mal schöne Grüße. Ich habe den Verdacht, dass er die Sterbestatistik auf seiner Abteilung zu unseren Lasten anhübschen will. Das war ja nicht das erste Mal, dass ihr uns Leichen geliefert habt.“
Ohne, dass K. noch etwas sagen konnte - ihm wäre sowieso nur Stammelei über die Lippen gekommen - hatte der Kollege aufgelegt.
Dieser Mistkerl hat mich vorgeschickt, damit er selber bei diesen Tricksereien nicht direkt verantwortlich gemacht werden kann. Auf den Formularen für den Krankentransport steht meine Unterschrift und nicht seine, resümierte K. zornig.
Ebel hatte neben der Sterbestatistik noch eine weitere Statistik im Hinterkopf, wie im Übrigen fast alle Chefärzte zu dieser Zeit, und das war die Belegung seiner Krankenstationen. Der Klinikbau war von der Kommune finanziert worden. Die laufenden Kosten hingegen wurden über die Tagespauschalen, vorher mit den Krankenkassen vereinbarte feststehende Honorarsätze pro Liegetag, abgedeckt. Bei der Chefarztvisite galt Ebels Augenmerk weniger der Genesung seiner Patienten, als vielmehr deren Liegedauer. Unter zwei Wochen kam kaum einer davon, egal was für eine Gesundheitsstörung er hatte. Insbesondere ältere Herrschaften mit chronischen Erkrankungen am Rande der Pflegebedürftigkeit schätzten die Umsorgung und das gute Essen im Krankenhaus. Spezielle Diäten waren verpönt. Es sollte ja schmecken. Die Patienten sollten wiederkommen.
Auch die Angehörigen waren froh, wenn die quengelnde Oma mal wieder in die Klinik eingewiesen wurde und dort mehrere Wochen bleiben konnte. So wurde die Solidargemeinschaft der Versicherten schamlos ausgebeutet, für die Erhaltung überflüssiger Bettenkapazitäten und zum Wohle der nächsten Angehörigen. Das wirkte wie ein regionales Beschäftigungsprogramm für Ärzte und Pflegepersonal. Auch deswegen war Chefarzt Ebel ein angesehener Mann im Örtchen.
K. jedoch verachtete diese Memme und traf sich in dieser Aversion mit seinem Kollegen Grosser. Beide beschlossen, diesem Herrn eine kleine Lektion zu erteilen. Grosser schluckte dazu wie ein Patient Bariumbrei und K. fertigte Röntgenaufnahmen von dessen Oberbauch an. Man konnte darauf die Verteilung des Kontrastmittels im Magen und im Zwölffingerdarm sehen. K. sorgte dafür, dass in der Signatur der Röntgenbilder der Name eines Phantasiepatienten, eines gewissen Emil Meier, erschien.
In der täglichen Röntgenvisite steckte Chefarzt Ebel wie immer mit Schwung die Bilder vor die Milchglasscheibe des Bildbetrachters und fing sogleich mit seinem Diktat an. Er brabbelte seinen Standardtext ins Mikrofon, der wie immer den Verdacht auf ein Ulcus am Magenausgang oder am Zwölffingerdarm beinhaltete.
„Herr Chefarzt, der Patient hat aber definitiv kein Geschwür“, unterbrach ihn K. devot.
„Woher wollen sie das denn wissen, Herr Kollege?“, fragte Ebel hochnäsig, während er die Folien vom Lichtkasten abpflückte.
„Weil der Patient, keinerlei Beschwerden hat“, sagte K. und grinste zu Grosser rüber.
„Wieso?“ Indigniert hielt Ebel das Bild nochmals vor den Lichtkasten.
„Weil die Aufnahmen nicht vom Patienten Meier stammen, den gibt es bei uns gar nicht, sondern vom Herrn Kollegen Grosser.“
„Sie wissen, dass das die Fälschung eines Dokuments darstellt?“, brachte der Chefarzt gepresst hervor. Ebel war aschfahl im Gesicht geworden. Er wusste nicht, was er machen sollte.
Normalerweise musste eine derartige Sabotage mit einem Rausschmiss geahndet werden. Doch dazu fehlte ihm die Courage und es hätte Monate dauern können, bis er die dann vakanten Stellen wieder hätte besetzen können. Er stand auf und verließ wortlos den Raum.
Er verpisst sich mal wieder, dachte sich K., wie immer, wenn es brenzlig wird. Wie einfach es doch sein kann, Menschen krank zu machen. Diesem fiktiven Herrn Meier hätte man dann mitgeteilt, dass dringender Verdacht auf ein chronisches Geschwür bestünde. Bei Therapieresistenz solle er unbedingt beim Chirurgen vorbeischauen und mit dem das weitere Prozedere abstimmen. Nicht selten landeten solche Kandidaten dann auf dem OP-Tisch und wachten nach der Narkose mit einem teilweise resezierten Magen auf. So etwas wie eine Vagotomie wurde damals noch nicht praktiziert.
Der Streich der beiden Jungärzte war aus einer gewissen Seelenverwandtschaft entstanden, welche zum einen darin bestand, das Tun und Handeln von Autoritäten kritisch zu hinterfragen. Zum anderen stand ein tief sitzenden Drang dahinter, den Dingen auf den Grund zu gehen. Letzteres sollte beide einige Jahre später noch einmal woanders zusammenführen.