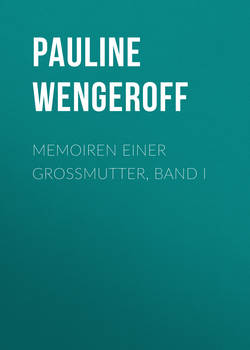Читать книгу Memoiren einer Grossmutter, Band I - Pauline Wengeroff - Страница 3
Ein Jahr im Elternhause
I. Teil
ОглавлениеMein Vater pflegte Sommer und Winter um 4 Uhr morgens aufzustehen. Er achtete streng darauf, daß er sich nicht vier Ellen von seinem Bette entfernte, ohne sich die Hände zu waschen. Ehe er den ersten Bissen zum Munde führte, verrichtete er in behaglicher Stimmung die Früh-Morgengebete, und begab sich dann in sein Arbeitszimmer. Es hatte an den Wänden viele Fächer, in denen zahlreiche Talmudfolianten aller Arten und Zeiten aneinander gereiht standen, in guter Gemeinschaft mit sonstigen talmudischen und hebräischen Werken der jüdischen Literatur. Darunter gab es alte, seltene Drucke, auf die mein Vater stolz war. Außer einem Schreibtisch stand in diesem Raum noch ein hoher, schmaler Tisch, »Ständer« genannt, davor ein bequemer Lehnstuhl und eine Fußbank.
Mein Vater begab sich also in sein Zimmer, ließ sich gemächlich im Stuhl nieder, schob die von dem Diener bereits angezündeten Kerzen näher und schlug den großen Folianten auf, der noch von gestern abend wie wartend dalag und begann in dem bekannten Singsang zu »lernen«. So gingen die Stunden bis sieben Uhr morgens hin. Dann trank er seinen Tee und ging in die Synagoge zum Morgengebet.
In meinem Elternhause wurde die Tageszeit nach den drei täglichen Gottesdiensten eingeteilt und benannt: so sagte man »vor« oder »nach dem Dawenen«, (Beten), für die vorgerücktere Zeit »vor« oder »nach Minche« (Vorabendgebet); die Zeit der Abenddämmerung wurde mit »zwischen Minche und Maariw« bezeichnet. In ähnlicher Weise wurden die Jahreszeiten nach den Feiertagen benannt; so hieß es »vor« oder »nach Chanuka«, »vor« oder »nach Purim« usw.
Mein Vater kam um zehn Uhr vom Bethause zurück. Erst dann begannen die geschäftlichen Arbeiten. Es kamen und gingen viele Menschen, Juden und Christen, die Geschäftsführer, die Kommis, Geschäftsfreunde usw., die er bis zur Mittagszeit – es wurde um ein Uhr gegessen – abfertigte. Nach Tisch ein kurzes Schläfchen, hierauf nahm er seinen Tee. Dann fanden sich auch schon Freunde ein, mit denen er über den Talmud, literarische Fragen und über Tagesereignisse sprach.
So schrieb mein Vater im Anfang der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts einen Beitrag zu den »Eyen Jankow«, den er »Kuntres« (Kunom Beissim) benannte, und im Anfang der fünfziger Jahre hat er eine umfangreiche Sammlung seiner Kommentare zu dem ganzen Talmud herausgegeben unter dem Namen »Minchas Jehuda«. Beide Werke hat er keinem Verleger zum Verkauf überlassen, und nur an seine Freunde, Bekannte, seine Kinder und hauptsächlich an viele »Bote midraschim«, (Lehrhäuser) in Rußland verteilt. Das jüdische Schrifttum und die meisten seiner Verfasser von damals und noch viele Jahrhunderte zuvor, auch der Talmud, haben den großen Fehler begangen, daß sie die Daten oft außer acht ließen und sie nicht genau angaben. So hat beispielsweise mein Vater in seinem letzten Werke seinen Stammbaum gegeben, der sehr viel Rabbiner und Gaonim, angefangen von seinem Großvater bis zehn Generationen weiter hinauf zählte, aber bei keinem das Jahr seines Lebens und Todes verzeichnet. Was galt das Leben des Einzelnen, wenn nur das Talmudstudium eine Pflanzstätte hatte!
So empfand mein Vater, der getreu wie seine Ahnen der Lehre und dem Gottesdienst sich weihte …
Das Minche gdole (Vorabendgebet) verrichtete er gewöhnlich zu Hause und sehr früh. Zu Maariw ging er wieder in die Synagoge, von der er gegen neun Uhr nach Hause kam zum Abendbrot. Er blieb gleich beim Tisch sitzen, unterhielt sich mit uns über dies und jenes. Er interessierte sich für alles, was im Hause vorging, was uns Kinder betraf, manchmal für den Fortgang unseres Unterrichts. (Den jüdischen Lehrer, Melamed und Schreiber, wie auch den Lehrer der polnischen und russischen Sprache pflegte meine Mutter zu besorgen.) Meinem Vater wurden da alle Haus- und Stadtereignisse mitgeteilt, während er seinerseits uns alles erzählte, was er in der Synagoge gehört hatte und was dort erörtert worden war. Dies war für uns die beste Unterhaltung und was er erzählte, die interessanteste Zeitung. Man nannte diese mündlichen Ueberlieferungen »pantoflowe gazeta«. Zeitungen, wie wir sie heute besitzen, gab es damals nur wenige, und sie waren nicht für jedermann erreichbar.
Meines Vaters impulsive Natur nahm alle Ereignisse mit starker Ergriffenheit auf, die sich auch seiner Umgebung mitteilte. Wir Kinder lauschten bei Tisch gespannt seinen klugen Reden. Er erzählte uns von berühmten Männern, von ihren Taten, von ihrer religiösen Lebensweise, den jüdischen Gesetzen, und wir liebten und schätzten ihn und stellten ihn höher als alle Menschen, die wir damals kannten. An zwei Namen, die er uns genannt, erinnere ich mich noch. Der eine hieß Reb Selmele, der andere Reb Heschele. Reb Selmele beschäftigte sich so eifrig mit dem Talmudstudium, daß er oft zu essen, zu trinken und zu schlafen vergaß. Er wurde schwach, mager und bleich, und seine besorgte Mutter flehte ihn an, seine Mahlzeiten einzunehmen. Aber es half nichts. Da gebrauchte die Mutter ihre Autorität: sie erschien eines Tages in seinem Studierzimmerchen mit einem Stück Kuchen in der Hand und befahl ihm, zu essen; zugleich sagte sie ihm, daß er jeden Tag um diese Stunde von ihr ein Stück Kuchen bekommen würde, das er essen müßte. Der junge Mann fügte sich in den Willen der Mutter; ehe er aber zu essen begann, rezitierte er den Talmudabschnitt: »Kabed ow weem«, die Gebote von der Verehrung von Vater und Mutter.
Der zweite, Reb Heschele, war schon als Kind sehr klug und witzig, Eigenschaften, die ihm auch bei all seiner großen Gelehrsamkeit bis in die späteren Lebensjahre verblieben. Ihm war das Cheder ein Greuel mitsamt dem Rebben und dem Behelfer, der ihn täglich gewaltsam fortführte, obwohl er sich mit Händen und Füßen sträubte; denn er war ein sehr lebhaftes Kind und liebte die Freiheit. Eines Tages fragte ihn sein Vater ohne jede Strenge, warum er denn so ungern ins Cheder ginge. »Ich fühle mich beleidigt«, erwiderte er, »daß der Behelfer mich so ohne jede Achtung mitschleppt. Warum schickt man dir, wenn man dich haben will, einen Boten, der dich höflich bittet, der Einladung zu folgen?« Und du antwortest manchmal: »Gut, ich komme!« oder manchmal auch: »Ich danke, gleich wie gewesen (d. h. wenn du willst, gehst du, sonst eben nicht).« Der Vater versprach ihm, ihn auch einladen zu lassen und teilte das dem Behelfer mit. Als dieser nun anderen Tages den Kleinen freundlich einlud, antwortete er: »Gleich wie gewesen!« – Ein andermal zog er beide Strümpfe auf denselben Fuß, um den Behelfer recht lange nach dem zweiten suchen zu lassen.
Meine Eltern waren biedere, gottesfürchtige, tief religiöse, menschenfreundliche Leute von vornehmem Charakter. So war überhaupt der vorherrschende Typus unter den damaligen Juden, deren Lebensaufgabe vor allem die Gottes- und die Nächstenliebe war. Der größere Teil des Tages verging mit dem Talmudstudium. Den Geschäften widmete man nur bestimmte Stunden, obgleich die Geschäfte meines Vaters oft hundert tausende Rubel betrafen. Er gehörte, wie auch mein Großvater, der Klasse der Podraziki (Unternehmer) an, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Rußland eine große Rolle spielten, da sie große Geschäfte mit der russischen Regierung machten, wie die Übernahme von Festungs-, Chaussee- und Kanalbauten und die Lieferungen für die Armee. Mein Vater und mein Großvater gehörten zu den angesehensten dieser Unternehmer, da sie sich durch absolute Ehrlichkeit auszeichneten.1
Wir bewohnten in der Stadt Brest ein großes Haus mit vielen, reich ausgestatteten Räumen; wir hatten Equipage und teure Pferde. Meine Mutter und die älteren Schwestern besaßen auch viel Schmuck und schöne, kostbare Kleider. Unser Haus lag abseits von der Stadt. Man mußte erst eine lange Brücke, die die Flüsse Bug und Muchawiez überspannte, passieren und kam dann an vielen kleinen Häusern vorbei. Dann mußte man sich nach rechts wenden, eine Strecke von etwa 100 Faden geradeaus gehen – und man stand vor unserem Haus. Das Haus war gelb angestrichen und hatte grüne Fensterladen. In der Fassade besaß es ein großes, venetianisches Fenster, neben dem zu jeder Seite noch zwei Fenster waren. Davor lag ein schmaler, von einem Holzstacket umgebener Blumengarten. Das Haus trug ein hohes Schindeldach.
Das ganze Anwesen samt Gemüsegarten war von einer Reihe hoher Silberpappeln eingeschlossen, was dem Hause das Aussehen eines litauischen Herrensitzes gab.
Das jüdische Familienleben in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war in meinem Elternhaus, wie bei anderen, sehr friedlich, angenehm, ernst und klug. Es prägte sich mir und meinen Zeitgenossen tief und unvergeßlich ein. Es war kein Chaos von Sitten, Gebräuchen und Systemen, wie jetzt in den jüdischen Häusern. Das jüdische Leben von damals hatte einen ausgeglichenen Stil, trug einen ernsten, den einzig würdigen jüdischen Stempel. Darum sind uns die Traditionen des elterlichen Hauses so heilig und teuer bis auf den heutigen Tag geblieben! Wir aber mußten viel Leid erdulden, bis wir notgedrungen uns in unserem eigenen Hause einer ganz anderen Lebensweise unterwarfen, die unseren Kindern wohl wenig erbauliche und noch weniger angenehme Erinnerungen aus ihrem elterlichen Hause hinterlassen wird!
Liebe, Milde und doch Bestimmtheit waren die Erziehungsmittel der Eltern. Und ein gut Wörtchen half über manche Schwierigkeit hinweg.
Eine Episode:
Eines Morgens fand mich mein Vater, der von der Stadt zurückkehrte, allein und weinend auf der Straße. Ich glaube, eine Gespielin hatte mir die Puppe fortgenommen. Er wurde böse, daß ich ohne Begleitung umherlief und fragte ärgerlich, warum ich weinte. Ich war aber von meinem großen Schmerz so erfüllt, daß ich keine Antwort zu geben vermochte und noch heftiger zu schluchzen begann. Da wurde mein Vater erst recht zornig und rief: »Warte nur, die Rute wird dich antworten lehren!« Er ergriff meine Hand und zog mich rasch ins Haus. Der Vater ließ sich eine Rute geben und machte Anstalten, mich zu prügeln. Ich war ganz still geworden und sah verblüfft zum Vater hinauf – ich wurde nie mit der Rute bestraft – und sagte überrascht: »Ich bin ja Pessele!« Ich war der festen Überzeugung, daß mein Vater mich nicht erkannt und sich geirrt hatte.
Und diesem selbstbewußten Verhalten hatte ich es zu verdanken, daß ich von der Rute verschont blieb. Alle Umstehenden lachten und baten für mich um Nachsicht.
Ich beschäftigte mich mit Vorliebe im Gemüsegarten beim Ausgraben der Kartoffeln und anderer Gemüse; ich bat mir von den halberfrorenen Weibern bald den Spaten, bald die Harke aus und hantierte damit flink, bis die scharfe, kalte Herbstluft mich mahnte, geschwind ins Haus zu laufen. Nachdem alles Gemüse aus unserem Garten eingekellert war, wurde noch viel auf dem Markt eingekauft. Dann ging's an die sehr wichtige Arbeit – an das Einlegen von Sauerkohl, womit in jedem Herbst viele arme Frauen volle acht Tage beschäftigt waren. Nach den jüdischen Vorschriften ist es streng geboten, die Würmchen, die im Gemüse und in den Früchten, besonders aber im Kohl nisten, sorgsam zu entfernen; und so wurde von jedem Kohlkopf Blatt um Blatt abgenommen, gegen das Licht gehalten und genau untersucht. Meine fromme Mutter war in der Erfüllung der Vorschriften sehr peinlich und pflegte, wenn der Kohl besonders geraten und von der besten Sorte war und wenig Würmer hatte, den Frauen eine besondere Belohnung für jeden gefundenen Wurm zu geben, denn sie war immer in Sorge, daß die Frauen bei der Arbeit nicht genügend aufmerksam waren. Ich sah auch hier gern zu wie bei der Arbeit im Gemüsegarten, weil die Frauen dabei allerlei Volkslieder sangen, die mich tief ergriffen und mich schmerzlich weinen, aber auch häufig herzlich lachen machten. Viele dieser Lieder sind mir bis jetzt im Gedächtnis geblieben und sind mir teuer!
Es war ein geruhiges Leben!
Wir leben jetzt in dem Zeitalter von Dampf und Elektrizität viel schneller, so will es mir scheinen. Das hastige Treiben der Maschinen hat auch auf den menschlichen Geist eingewirkt. Wir erfassen manches viel rascher und begreifen ohne Mühe so viele komplizierte Dinge, indes man früher die einfachste Tatsache nicht begreifen konnte. Ich entsinne mich eines Beispiels, das mir im Gedächtnis geblieben ist und das ich hier anführen will. In den vierziger Jahren baute mein Großvater für die Regierung die Chaussee von Brest nach Bobruisk. Auf der Strecke befanden sich Berge, Täler und Sümpfe, so daß eine Wagenreise volle zwei Tage dauerte, während man dieselbe Tour auf der Chaussee bequem in einem Tage sollte zurücklegen können. Alles sprach natürlich von dem für jene Zeit großen Unternehmen, aber es fanden sich selbst in den höheren Gesellschaftskreisen Skeptiker, die ihre Zweifel äußerten und sagten: »Solange sich die Menschen erinnern, waren zwei Tage nötig, um den Weg, von Brest in Lithauen nach Bobruisk zurückzulegen, und da kommt Reb Zimel Epstein und erzählt uns, er wird ihn auf eine Tagereise verkürzen. Wer ist er? Gott? Wird er die übrige Strecke Wegs in seine Tasche stecken?«
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren die Wege in Litauen und in manchen Teilen Rußlands überhaupt noch wüst. Endlose Steppen, Sümpfe, teilweise noch Urwald dehnten sich meilenweit, bis die große Kaiserin Catharina II. auf beiden Seiten mit Birkenbäumen bepflanzte Landstraßen anlegen ließ. Die Seitenwege waren aber sowohl für die Fußgänger, die man als Boten von Ort zu Ort sandte, sowie für die in Schlitten und Wagen Reisenden noch sehr gefährlich, besonders im Winter durch den tiefen Schnee. Zur Überwindung dieser Gefahren wurde die Pferdepost eingeführt. Dazu gehörte die Troika, das Dreigespann, der Postkutscher, Jamschezik genannt, ein halbwilder, schwerfälliger, immer betrunkener Bauer, der bei seinem Pferde lebte und starb. Viel gebraucht wurde auch die Kibitka, ein plumpes Wägelchen, dessen vier schwere Räder zwei breite Holzstangen verbanden, auf denen ein aus Brettern zusammengesetzter, halb überdeckter Korb ruhte, oder die Telega, ein ebenso plumpes Wägelchen ohne Verdeck. Das Geschirr der Pferde bestand aus grobem Leder, das mit Messingblech reich verziert war. Das mittlere Pferd hatte über dem Kopfe ein Krummholz, in dessen Mitte eine mächtige Glocke hing. Einen ebenso schwerfälligen, echt russischen Charakter wie das Gefährt hatten die etwa 20-25 Werst von, einander entfernt liegenden Poststationen. Eine große Stube mit weißgetünchten Wänden, ein großmächtiger, mit schwarzem Wachstuch bezogener Divan, der lange, hölzerne, auch mit Wachstuch benagelte Tisch, darauf der hohe, schmale, schmutzige, mit grünem Schimmel überzogene Samowar und ein schwarzes, verräuchertes Teebrett mit blinden, unsauberen Gläsern. Der hohe magere, immer, selbst am Mittag, schlaftrunkene, ungewaschene und ungekämmte Stationschef in seiner unsauberen Vizeuniform mit den blinden Messingknöpfen vervollkommnete das typische Bild, das mir heute nach 65 Jahren noch lebhaft vor Augen steht. – Von dieser Einrichtung konnten indes nur die reicheren Leute Gebrauch frischen, namentlich die höheren Militärs und Kouriere, die zu Pferde Botschaften von den Hauptstädten nach einer Gouvernementsstadt übermittelten, wozu man sich jetzt des Telephons und Telegraphen bedient.
Das gewöhnliche Publikum bediente sich eines einfachen, mit Leinwand bespannten Wagens, der von zwei oder drei Pferden gezogen wurde. Das bessere Publikum benutzte den. Tarantass, eine halbbedeckte Kutsche, die auf zwei dicken Holzstangen ruhte, oder den Fürgon, eine ganz mit Leder überdeckte Kutsche mit einer Tür in der Mitte. Nicht selten wurden diese Fuhrwerke samt den Passagieren auf freiem Felde vom Schneesturm verschüttet. – Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde durch den Bau der Chausseen diesen Übelständen abgeholfen. Nun hemmte kein Berg, kein Sumpf, kein Wald das schnelle Vorwärtskommen, und auf gradlinigem, ebenen Wege gingen die Fuhrwerke dahin. Die Sicherheit wurde dadurch erhöht, daß außer den Poststationen in regelmäßigen Abständen Wachhäuschen mit Wächtern eingerichtet wurden. Das nun schon bequemere Reisen machte das Volk beweglicher. Handel und Verkehr entwickelten sich erstaunlich rasch und schon am Anfang der vierziger Jahre zeigte sich das Bedürfnis nach einem schnelleren Verkehrsmittel. Da wurde dann die Einrichtung der sogenannten Diligence getroffen, ein bequemer Wagen mit zwei Abteilungen, der zwölf bis fünfzehn Personen zu einem mäßigen Preis täglich von Ort zu Ort führte. Er war mit drei Pferden bespannt und wurde von dem Postillon gelenkt, der eine eigenartige Uniform trug und auf seiner Trompete eine traditionelle Weise blies. In Russisch-Polen nannte man dieses Verkehrsmittel nach dem Unternehmer »Stenkelerke«, in Ostpreußen »Journalière«. Man war im allgemeinen sehr mit dieser Einrichtung zufrieden und glaubte, nie etwas Besseres finden zu können. Gleichwohl wusste man schon um die Mitte der fünfziger Jahre auch in Rußland von der Erfindung der Eisenbahn, und anfangs der 60er Jahre konnte man auch schon im Zarenreich weite Strecken per Dampf zurücklegen. In den vierziger Jahren brauchte man mit Postpferden sieben Tage, um eine Entfernung von 800 Werst zu überwinden, wofür in den sechziger Jahren mit der Eisenbahn dreißig Stunden ausreichten.
Nicht minder bedeutsam war die Entwicklung des Verkehrswesens innerhalb der Städte: im Anfang ein elendes Korbwägelchen auf hölzernen Rädern, von einem mit Stricken angeschirrten Pferde langsam gezogen, für das »Volk«, und zwar nur für zwei Personen; für das bessere Publikum die sogenannte Droschke oder »Lineika«, die heute noch existiert: ein Lederkorb auf hängenden Ressorts, zwei Deichselstangen, zwischen die ein Pferd mit einem Krummholz über dem Kopfe eingespannt war. In der Lineika war für acht Personen Platz, auf einem langen Sitze saßen auf jeder Seite vier Personen, Rücken an Rücken. Diese Gefährte schüttelten und rüttelten auf dem holprigen Pflaster die Passagiere lange Zeit, und wurden erst allmählich so weit verbessert, daß die Droschke auf liegenden, niederen Ressorts angebracht und der Sitz mit Federkissen versehen wurde, bis schließlich die Gummireifen um die Räder dem Schütteln ein Ende machten und anstelle der Kissen bequeme, breite Sofasitze traten.
Ende der siebziger Jahre wurde die Straßen-Pferdebahn eingeführt und die ersten Velocipede tauchten auf, bis in den neunziger Jahren die elektrische Tramway eine weitere Vervollkommnung brachte, die dann nur wieder durch das Automobil übertrumpft wurde.
Der Wegebau – der ja erst die Vervollkommnung der Verkehrsmittel ermöglichte, wurde in Form von Submissionen vergeben. Jeden Spätherbst, veranstaltete die russische Regierung in Brest die Torgy, d. h. die Vergebung der Bauarbeiten und Lieferungen. Aus diesem Anlaß kam gewöhnlich mein Großvater aus Warschau zu uns. Auch aus anderen: Städten trafen viele »Padradziki« ein. Zu des Großvaters Empfang wurden große Anstalten getroffen; mein Vater wurde, durch Estafette, reitende Eilboten, die auf jeder Poststation das Pferd wechselten, von dem Tag seines Eintreffens vorher genau benachrichtigt. Schon am Morgen des betreffenden Tages waren alle im Hause und besonders wir Kinder voller Ungeduld und Erwartung. Zur bestimmten Stunde begaben wir uns auf den Paradebalkon oder auch auf den Korridor, um da zwischen den Säulen eine geeignete Stelle zu finden, damit uns der Großvater zu allererst bemerke. Aller Augen waren auf die nahe Brücke gerichtet. Die Erwartung hatte den höchsten Grad der Spannung erreicht. Endlich rasselte es auf der Brücke, und wir sahen die große, viersitzige Equipage des Großvaters, von vier Postpferden gezogen. (Aber auch von unseren Blicken mächtig angezogen.) Jeder von uns streckte sich kerzengrade und strich sich das Haar von der Stirn und die Herzen pochten …
Der Wagen hielt nun endlich vor dem Balkon. Ein hoher, hagerer, blonder Diener, in einem Lakaienmantel, mit einigen aufeinander folgenden Kragen, sprang vom Bock, öffnete den Wagenschlag und half dem Großvater heraus. Er war ein ehrwürdiger, stattlicher Greis, dem Aussehen nach noch ziemlich rüstig, mit langem, grauen Bart, hoher breiter Stirn, großen ausdrucksvollen Augen von strengem Blick. Doch sein väterliches Auge ruhte mit Stolz und Zärtlichkeit auf seinem Sohne. Es erfreute das Herz des alten Mannes vollends, daß unser Vater trotz seiner vielfachen Geschäfte noch immer Zeit genug fand, fleißig den Talmud zu studieren. Wie oft pflegte der Greis zu sagen, er beneide meinen Vater um sein großes, talmudisches Wissen und um die Muße, die er für das Studium finde.
Meine Mutter wurde vom Großvater zuerst begrüßt, aber ohne Händedruck. Meinen Vater, meinen älteren Bruder und meine Schwäger umarmte er; zu meinen älteren Schwestern und zu uns Kindern wandte er sich mit den Worten: »Was macht Ihr, Kinderchen?« Aber diese wenigen Worte waren hinreichend, uns vor Freude hüpfen zu machen. Von dem ganzen Schwarm, der sich auf dem Balkon befand, begleitet, begab sich dann der Großvater ins Haus.
Wir kleinen Kinder durften nicht gleich in die festlich geschmückten Räume eintreten. Wir nahmen daher unseren Rückweg durch die Tür links und gelangten durch den Hauptkorridor in unser Zimmer. Meine älteren Schwestern hatten schon das Recht, die ersten Stunden mit dem Großvater und den Eltern zusammen zu bleiben und sich an der Besprechung der Geschäftsangelegenheiten zu beteiligen. Wir Kleinen wurden erst am darauffolgenden Morgen von der Mutter zum Großvater geführt, der uns zärtlich Haar und Wange streichelte. Doch kam es selten zu einem Kuß. Er ließ uns durch seinen Diener die guten Warschauer Bonbons und Apfelsinen, die er uns mitgebracht hatte, geben. Unsere »Audienz« währte jedoch nur wenige Minuten. Wir küßten die weiße, kräftige Hand, die er uns reichte, wünschten dem von uns so geliebten und hochgeschätzten Manne einen »guten Morgen«, verbeugten uns und entfernten uns, ohne ein überflüssiges Wort an ihn zu richten.
So lange der Großvater bei uns weilte, war im Hause ein Hin- und Herlaufen, ein Lärmen, ein Kommen und Gehen von Gästen und Geschäftsfreunden, im Hofe ein Ein- und Ausfahren von Equipagen und Droschken. Das Mittagbrot wurde später als sonst genommen. Man deckte im gelben Salon den großen Tisch aus dem Eßzimmer; das ganze Silber-, Kristall- und Porzellangeschirr wurde verwendet, und die Gänge und die Länge der Tafel hatten eine ungewöhnliche Ausdehnung, da viele Gäste geladen waren. Von meiner älteren Schwester bis zur jüngsten fand niemand an dem langen Tische Platz. Es wurde für uns zu unserer größten Freude im Eßzimmer ein besonderer Tisch hergerichtet, wo unsere Njanja (Kinderwärterin) Marjascha bediente – ein dralles, rotwangiges Mädchen mit schwarzen, dicken Zöpfen und einem roten Tuch, das sie turbanartig um den Kopf gewickelt hatte. Meine ältere Schwester Chasche Feige brachte uns selbst schmackhafte Gerichte, Kuchen usw. von der großen Tafel herüber. Wir waren von der strengen Disziplin, die drüben herrschte, befreit und genossen, auf uns selbst angewiesen, die vollkommenste Freiheit.
Am Abend fanden sich noch andere Gäste ein, darunter viele Christen, hochgestellte Männer vom Militär, Ingenieure, Baukommissäre, mit denen der Großvater Preference spielte. Ein reiches Dessert wurde aufgetragen, wovon wir Kinder wieder unseren gerechten Anteil erhielten; und wenn wir von der Mutter noch die Erlaubnis bekamen, damit auf den Ofen im Eßzimmer zu klettern und dort Licht anzuzünden, verlangten wir vom Schicksal nichts mehr. Denn auf dem Ofen war es so traulich, so gemütlich, dort, wo selbst am Tage ein Halbdunkel herrschte, wo sich in einem Winkel unsere Puppen mit ihren Bettchen, Kleidern und allerlei Blechtöpfe, Schüsseln und dergleichen befanden. Marjascha leistete uns immer Gesellschaft, und sie wußte so interessante Märchen zu erzählen. Ach, das war der Ort, wo wir Kinder die Welt umher vergaßen, mochte es unten in den prächtigen Räumen noch so munter zugehen: wir waren hier wunschlos-glücklich. Meine Mutter gestattete aber nur ungern den Auszug auf den Ofen; denn der Weg hinauf war unsicher: man mußte den einen Fuß in eine eigens dazu gemachte Vertiefung setzen und sich mit dem zweiten in der Luft rasch hinaufschwingen, wobei man oft das Gleichgewicht verlor und kopfabwärts auf die Diele stürzte. Auch oben fehlte es nicht an Gefahren; neugierig auf das Treiben im Eßzimmer, streckten wir die Köpfe über den Ofenrand hinaus, der andere Teil des Körpers schwebte fast in der Luft. Erst wenn eine auf die Diele stürzte, wurden wir uns bewußt, in welcher Gefahr wir »schwebten«. Dennoch erwirkten wir oft die Erlaubnis, uns für einen ganzen Abend auf dem ersehnten Plätzchen niederzulassen. Der Ofen bildete dort oben ein geräumiges Viereck, in dem man nicht stehend, sondern bloß sitzend oder liegend Platz hatte. Denn die Decke war sehr niedrig.
In den Zimmern unten ging es ziemlich lebhaft zu. Nachdem man den Tee und das Dessert eingenommen hatte, wurde noch viel von Geschäften gesprochen.
Es war ein reges Treiben, und die Ruhe kehrte erst wieder bei uns ein, wenn der Großvater alle Geschäfte geordnet hatte. Der Großvater hatte die Ausführung der Festungsbauten in Brest übernommen, für die mein Vater viele, viele Millionen mit seinen Initialen J. E. gestempelter Ziegel liefern mußte. Wir bekamen zum Abschied schöne Gold- und Silbermünzen. Der Großvater reiste ab. Im Hause wurde es wieder still wie nach einer Hochzeit in den vierziger Jahren (nicht etwa wie nach einer in den achtziger Jahren!).
Kurze Zeit darauf nahte ein neuer, lieber Gast – das Makkabäerfest (Chanuka) mit all seinen munteren und aufregenden Ereignissen. Schon am Sonnabend vorher mußte die Chanukalampe geputzt bereit stehen. Beim Putzen waren wir Kinder zugegen, beschauten jedes einzelne Teilchen und ergötzten uns daran. Die Lampe war aus Silberdraht geflochten und hatte die Form eines Sofas. Die Lehne trug einen Adler, über welchem ein Vögelchen in natürlicher Größe mit einer Miniaturkrone auf dem Köpfchen saß. An beiden Seiten des Sofas befanden sich kleine Röhren, in denen Wachskerzchen staken, während auf dem Sitze acht Miniaturkrügchen standen, die Öl enthielten – zur Erinnerung an den kleinen Ölkrug, den man einst, wie die Sage erzählt, im Tempel zu Jerusalem nach der Vertreibung der Feinde durch die Makkabäer gefunden und der für volle acht Tage zur Beleuchtung des Tempels hingereicht hatte. Zur Erinnerung an dieses Wunder feiern die Juden alljährlich auch durch Anzünden von Lichtern und Öllampen das Makkabäerfest, das in erster Reihe ein Siegesfest ist. – Der erste Chanuka-Abend wurde von uns Kindern mit Herzklopfen erwartet. Der Vater verrichtete sein Abendgebet, während unsere Mutter in das erste Krügchen Öl eingoß, den Docht in die Röhrchen einzog, zwei Wachskerzen in die zu beiden Seiten befindlichen kleinen Leuchter und einen in die Krone des Vögelchens steckte. Wir Kinder standen um sie herum und verfolgten jede ihrer Bewegungen mit Andacht! Der Vater vollzog die rituelle Handlung: das Anzünden des ersten Lichtes an der Chanukalampe. Er sprach das vorgeschriebene Gebet, steckte dabei ein dünnes Wachskerzchen an, womit er im ersten Ölkrügchen den Docht anzündete. Jetzt begann der Feierabend, denn arbeiten durfte man nicht, so lange das Öl im Krügchen brannte.
War das ein Jubel bei uns Kindern! Denn auch wir durften an diesem Abend Karten spielen. Wir holten unsere paar Kupfermünzen hervor und hielten uns für Millionäre. Wir setzten uns um den Tisch, und unsere kleinen Cousinen gesellten sich auch zu uns. Indes bildeten unsere Eltern, die erwachsenen Geschwister und einige Bekannte, die zu Besuch gekommen waren, einen größeren Kreis. Am fünften Abend dieser Woche sandte meine Mutter Einladungen an alle unsere Verwandten und Bekannten. An diesem Abend erhielten wir Kinder auch von der Mutter das so sehnlich erwartete Chanukageld, das gewöhnlich in neun glänzenden Kupfermünzen bestand. Man blieb an diesem Abend später auf als gewöhnlich, spielte auch länger Karten, und es wurde ein reiches Abendbrot geboten, bei dem die sogenannten Latkes2 das Hauptgericht bildete. Latkes sind eine Art Flinsen aus Buchweizenmehl mit Gänsefett und Honig; sie werden aber auch aus Weizenmehl mit Hefe, eingemachten Früchten und Zucker zubereitet und sind sehr schmackhaft. Als Getränk gab es eine Art Kaltschale, aus Bier, Öl und ein wenig Zucker bestehend. Dazu kam Schwarzbrot, klein geschnitten, mit Zucker und Ingwer bestreuter Zwieback. Gänsebraten wurde gereicht mit allen möglichen Beilagen, gesalzenen und sauren, unter denen der Sauerkohl und die Gurken nicht fehlen durften. Endlich ein reiches Dessert von Konfitüren und Früchten, wobei Keller und Vorratskammer viel einbüßten. Die Gäste musterten, beurteilten und lobten die Speisen.
Das Ergebnis des Kartenspielens konnte man auf unseren Gesichtern lesen; mancher verlor sein ganzes Chanukageld und bemühte sich, die Tränen zu verbergen. Es blieb nur ein Trost: die Hoffnung, daß solche Spielabende sich wiederholen werden. Dann wandte sich das Glück und füllte wieder die leere Börse.
An solchen Abenden stellte mein Vater sogar das »Lernen« im Talmud ein und gesellte sich zu den Spielenden, obgleich er, wie meine Mutter, keine Idee vom Kartenspiel hatte. Sehr beliebt war auch das »Dreidlspiel«, auch goor genannt. Das Dreidl wurde eigens aus Blei gegossen. Es hat eine würfelähnliche Form. Unten war eine Spitze, so daß der »Apparat« wie ein Kreisel gedreht werden konnte. Auf jeder der Seitenflächen war ein Buchstabe markiert. Fiel das Dreidl auf נ, so hatte der Spieler verloren. Bei ש blieb der Einsatz stehen. Fiel es auf ה, so konnte er die Hälfte des Einsatzes nehmen. Wenn das Dreidl aber auf ג fiel, so war »goor«; der Würfler konnte den ganzen Einsatz einstreichen.
Nach der Chanuka-Woche kam das Leben in unserem Hause wieder ins alte Geleise. Es sei denn, daß Einquartierung die Ruhe wieder störte: Besuch eines hochgestellten Militär- oder Zivilbeamten. Die Festung in Brest besaß damals noch keinen Palast, und das Haus meiner Eltern war reich und bequem eingerichtet. Der damalige Kommandant Piatkin, der mit meinem Vater befreundet war, pflegte hohe Gäste in unserem Hause einzulogieren. Mancher kann ich mich noch sehr gut erinnern, z. B. des Fürsten Bebutow aus Grusinien im Kaukasus, der später in Warschau einen hohen Posten bekleidete. Er wohnte sehr lange bei uns, war zu uns Kindern freundlich und gegen alle sehr zuvorkommend. Oft brachte er uns, während wir im Blumengarten vor den Fenstern spielten, Bonbons und Honigkuchen, und unterhielt sich mit uns gemütlich in russischer Sprache. Er hatte einen Diener, der Johann hieß. Er war lang und hager, hatte eine Habichtsnase und mandelförmig geschnittene, schwarze, glühende Augen, kletterte wie eine Katze bis zur äußersten Spitze der höchsten Pappel, machte kunstvoll die Dschigetowka burduk, indem er sich von seinem im raschesten Lauf hinstürmenden, feurigen Pferde bis zur Erde herabneigte, um eine kleine Münze aufzuheben. Er war recht jähzornig; man durfte ihn nicht reizen oder ihm in den Weg kommen, wenn er aufgeregt war, denn er führte immer einen Dolch bei sich. So hat er einen Hund, der ihm einmal vor den Füßen lief, mit dem Dolch entzwei gehauen. Ein anderes Mal hat er einen Hahn im Fluge aufgefangen und ihm mit den Händen den Kopf vom Rumpfe heruntergerissen. Wir Kinder fürchteten ihn sehr.
Der zweite Gast, dessen ich mich noch entsinnen kann, war der damalige Gouverneur von Grodno, Doppelmeyer, der oft nach Brest kam und stets bei uns wohnte. Er war ein sehr leutseliger, starker, blonder Herr, der bei uns als guter Freund aufgenommen wurde. Er hielt es für seine Pflicht, meinen Eltern, so oft er kam, eine Visite zu machen. Geschah dies an einem Freitag Abend, so wurde er mit einem Stück Pfefferfisch regaliert, den er mit großem Appetit verzehrte. Auch dem schönen geflochtenen Schabbes-(Sabbat) Strietzel ließ er volle Gerechtigkeit widerfahren. Es muß ein wohlgefälliges Bild gewesen sein, wenn alle meine Geschwister mit ihren jungen, blühenden Gesichtern und meine Eltern um den Tisch saßen. Denn der Gouverneur sagte viel Schmeichelhaftes darüber und beglückwünschte meine Eltern. Er unterhielt sich mit meinem Vater über mancherlei ernste Angelegenheiten und blieb plaudernd bis zum Ende der Mahlzeit: Der Verkehr zwischen Juden und Christen war damals noch nicht durch den Antisemitismus vergiftet …
Unter den Gästen meines Vaterhauses war auch ein kleines, jüdisches Männchen, das alljährlich im Hochsommer zu uns kam und einige Wochen bei uns weilte. Er gehörte der Sekte »Dower min hachai« an, d, h. die nichts vom Lebendigen Genießenden; die man jetzt Vegetarier nennt. Er hielt diese Vorschriften aber so strenge inne, daß er nicht einmal von dem Geschirr aß, das auch nur einmal zu Fleischspeisen benutzt worden war. Meine fromme Mutter pflegte selbst für ihn die Speisen zuzubereiten, eine Suppe aus sauren, roten Rüben oder Sauerampfer, Grützbrei ohne jeden Fettzusatz, nur mit etwas Baumöl zubereitet; ferner Nüsse in Honig, oder Rettig in Honig mit Ingwer gekocht, Tee und schwarzen Kaffee. – Er war ein stiller, höchst bescheidener Mann und wurde von uns allen sehr verehrt, insbesondere auch von meinem Vater, der mit ihm in seinem Kabinett über die Folianten gebeugt zu sitzen und zu disputieren pflegte.
Das Leben im Winter hatte für mich einen besonderen Reiz. Gerade wenn es tüchtig schneite, liebte ich es, draußen herum zu spazieren. In der Dämmerstunde, wenn ich zu frieren anfing, schlich ich mich in den »Flügel«, so hieß das Seitengebäude im Hofe, wo meine verheirateten Schwestern mit ihren Männern und Kindern lebten. Mein Besuch dort galt der Njanja (Kinderwärterin) des kleinen Sohnes meiner Schwester. Die Njanja erzählte mir oft sehr interessante Märchen und sang sehr schöne Liedchen. Ich fand sie gewöhnlich an der Wiege sitzend, die sie mit einem Fuß in Bewegung hielt, während ihre gerunzelten, blau-gelben Hände an einem dunkelgrauen, groben Wollstrumpf strickten. Ich kroch mit Händen und Füßen auf das Bett, auf dem sie saß, und bat mit allerlei Schmeichelworten, sie solle mir den Strumpf zum Stricken geben.
»Nein«, grinste sie, »du wirst wie gestern nur wieder die Maschen fallen lassen. Geh weg von mir!«
»Chainke, Jubinke«, begann ich aufs Neue, »wenn Ihr mir nicht den Strumpf gebt, so singt mir von den Liedelach, die Ihr singt, wenn Ihr Berele einschläfert.«
Grämlich antwortete sie: »Mir ist nicht zum Singen.«
»Seid Ihr krank, Chainke?« fragte ich sie besorgt.
»Laß mich in Ruh«, schrie sie aufspringend. Aber ich ließ mich von dieser ihr eigenen Laune nicht abschrecken und wiederholte meine Bitte, die ich durch Küsse ihrer faltigen Wangen und Streicheln ihres runzeligen Halses unterstützte.
»Mischelaches!« (Gottesplage) schrie sie auf, »um von dir poter zi weren (um dich los zu werden), werd' ich dir schon singen.«
Ich setzte mich zurecht, als ob sie ohne meine Vorbereitung nicht singen könnte und lauschte.
Und sie sang:
»Patschen, patschen Küchalach,
Kaufen, kaufen Schichalach,
Schichalach kaufen,
In Cheider (Schule) wet das Kind laufen,
Laufen wet es in den Cheider,
Lernen wet es gur Kiseider (der Reihe nach)
Wet es oblernen etliche Schures (einige Zeilen)
Wet man heren gute Bsures (gute Nachrichten hören)
Bsures toiwes (gute) zu zuheren
Abi dem Oilom (Publikum) a Eize zu geben (Rat zu geben),
Eine Eize zu geben mit viel Mailes (gute Eigenschaften)
Wet das Kind paskenen Scheiles (Fragen über koscher und treife und andere talmudische Fragen entscheiden)
Scheiles wet es paskenen.
Drosches wet es darschenen (talmudische Reden halten)
Wet men ihm schicken die gildene Pischkele, (wird man ihm schicken eine goldene Dose)
Un a Streimele (Festtagspelzmütze)«
»Ach, wie schön, wie schön«, rief ich, Beifall klatschend, »Aber Ihr werdet mir noch, Chainke, ein zweites Liedele singen.«
»Was is dus heint far a Mischelaches (Gottesplage) auf mir gekummen!« Sie sprang schreiend auf vom Sitz, so daß eine Stricknadel in die Wiege fiel und die Maschen von ihr herabglitten. Nun zweifelte ich nicht, daß ich heute nichts mehr zu hören bekommen würde. Ich blieb still sitzen, bis sie brummend und grimmig den Strumpf in Ordnung gebracht hatte; sie sah mich mit wütenden Blicken von der Seite her an, als verstände es sich von selbst, daß ich Schuld an dem Unfall hatte. Ich regte mich nicht. Und da sie in meinen Mienen das Bekenntnis meiner Schuld fand, wurde sie wieder versöhnt. – Freilich trug auch mein Versprechen, ihr etwas von meinem Vesperbrot zu bringen, zur Besserung ihrer Laune bei. Um mich los zu werden, sang sie mir noch ein zweites Lied:
»Schlaf mein Kind in Ruh,
Mach deine koschere (reine) Äugelach zu.
Unter dem Kinds Wiegele
Steht a weiße Ziegele,
Die Ziegele is gefohren handeln,
Rosinkes (Rosinen) mit Mandeln.
Das is die beste S'choire (Ware)
Berele wird lernen Toire
Toire, Toire im Kepele (Köpfchen)
Kasche (Brei) Kasche im Tepele (Töpfchen)
Broit (Brot) mit Butter schmieren
Der Tate (Vater) mit der Mame (Mutter) Berele zu der Chupe (Trauung) führen.«
Es ist bezeichnend, daß der Jude damals selbst in den Wiegenliedern nur vom Thoralernen, Cheidergehen phantasierte – und nicht von Jagd, Hunden, Pferden, Dolchen, Krieg.
Chainke begeisterte sich an ihrem Gesange selbst recht sehr und sang mir noch mehrere Liedchen. Eins möchte ich hier noch anführen:
Zigele, migele
Wachsen im Krigele
Roite Brenselie
As der Tate schlugt die Mamme
Reissen die Kinderlach Krie —
Zigele, migele
Wachsen im Krigele
Roite Pomeranzen
As der Tate kuscht die Mamme,
Gehen die Kinderlach tanzen.
Sicher animierte sie zu dieser Zugabe die Aussicht auf mein Vesperbrot. Inzwischen war es recht dunkel geworden. Ich lief eilig über den Hof ins Hauptgebäude zurück, wo meine Geschwister schon tüchtig dem Vesperbrot zusprachen. Unser Kindermädchen Marjascha konnte mit dem Brotschneiden und dem Aufstreichen von eingemachten Stachelbeeren – unserem Lieblingsgericht – gar nicht fertig werden. Ich bekam meinen Teil und husch! war ich schon wieder auf dem Wege zum Flügelgebäude, wo ich von der mir jetzt geneigten Sängerin viel freundlicher als zuvor behandelt wurde. Und wir verzehrten gemeinschaftlich mit Behagen den Leckerbissen..... —
.... Die größere Hälfte des Winters war vorüber, und das Purimfest mit seinen aufregenden Freuden, mit den vielen Beschenkungen stand vor der Tür. Damals war es unerläßlich, für unsere Cousinen und Nichten Handarbeiten zum Scholachmones (gesandte Geschenke) anzufertigen. Wir arbeiteten Tage und Nächte mit großem Eifer, und als nun alles fertig war, ergötzten wir uns bei dem Gedanken, wie die Beschenkten vor Bewunderung beinahe neidisch auf unsere Geschicklichkeit sein würden. Der ersehnte Purimtag rückte immer näher. Am Vortag war Esthertanes (der Königin Esther Fasttag), an dem alle älteren Familienmitglieder fasteten. Schmackhafte Purimbäckereien wurden von meinen Schwestern im Hause bereitet. Die Hauptrolle spielten die Hamantaschen (dreieckige Mohnkuchen) und die Monelach (in Honig gekochter Mohn). Gerieten sie gut, so versprach man sich ein gutes Jahr. Wir Kinder durften auch bei dieser Arbeit helfen, konnten wir doch bei dieser Gelegenheit nach Herzenslust naschen. Der ganze Tag verging ohne die üblichen Mahlzeiten. Aber wie groß war die Lust, sich am Abend unter die großen mischen zu dürfen und die gebackenen, gebratenen und gekochten Herrlichkeiten verzehren zu können! Und erst die freudige Aussicht auf den nächsten Tag! Am Abend wurde zu Hause gebetet. Nachher fand sich eine zahlreiche Gesellschaft aus der Nachbarschaft ein. Hierauf wurde die M'gilla Esther (das Buch Esther) vorgelesen. Und so oft der verhaßte Name Haman vorkam, stampften die Männer mit den Füßen, und die Jugend lärmte mit den schrillen Gragers (Schnarren). Mein Vater ärgerte sich darüber und verbot es. Aber es half nichts: jedes Jahr tat man es wieder.
Erst nach dem Ablesen der M'gilla, das oft bis acht oder neun Uhr abends dauerte, begab man sich ins Eßzimmer, und ließ sich die appetitlichen Speisen, die in reicher Fülle auf dem Tisch standen, gut schmecken. Jeder bediente sich, so rasch er konnte, um den laut protestierenden Magen, der doch mehr als 20 Stunden keine Nahrung erhalten hatte, zu befriedigen.
Am frühen Morgen des darauffolgenden Tages konnten wir Kinder vor Aufregung nicht mehr schlafen und riefen einander noch in den Betten zu: »Was ist heute?« – »Purim!« lautete die frohlockende Antwort. Und nun kleidete man sich so rasch wie möglich an. Die freudige Erwartung verwandelte sich in Ungeduld. Wir wünschten, der Morgen möge doch endlich schon zum Nachmittag werden, da wurden ja die Scholachmones abgeschickt und empfangen.
Mein Vater und die jungen Leute kamen aus dem Bethause, wo ein Halbfeiertagsgottesdienst abgehalten und wieder die M'gilla vorgelesen worden war. Das Mittagmahl wurde zu früher Stunde genommen (es bestand aus den vier traditionellen Gängen: Fische, Suppe mit den unvermeidlichen Haman-Ohren, d. h. dreieckige Kreppchen, Truthahn und Gemüse), um die zweite Mahlzeit, die Sude (Festmahl), die eigentlich am Purimfest die Hauptrolle spielte, noch vor Abend beginnen zu können. Dabei gibt sich der Jude, – so will es der Gebrauch – der wahren oder der vermeintlichen Freude hin und darf sich einen kleinen Rausch antrinken. So viel ich mich zu erinnern weiß, ist jeder Jude an diesem Tage munter und fröhlich, er gönnt sich gutes Essen und Trinken und bemüht sich schon Tage vorher, für den Schmaus viel Geld aufzutreiben.
Uns Kinder beschäftigte nur der Gedanke an das Abschicken und Empfangen des Scholachmones. Endlich kam die wichtige Stunde, da alle fertigen Geschenke auf ein Teebrett gelegt wurden. Dem Dienstmädchen wurde eingeschärft, welches Geschenk für den und jenen bestimmt sei. Mit besorgter, vor Aufregung bebender Stimme wurde ihr verboten, sich unterwegs aufzuhalten oder mit jemand zu sprechen, nicht einmal im Vorübergehen. Sie sollte direkt zu unseren Tanten gehen. Selbst die Art, wie sie das Teebrett mit den Geschenken auf den Tisch setzen müsse, und wie sie jedem sein Geschenk auszuhändigen habe, wurde ihr genau angegeben. Dabei stellten wir uns lebhaft die Ausrufe des Entzückens vor, die unsere Arbeiten hervorlocken würden. Und wir zeigten wiederholt dem Mädchen jedes Stück. Endlich ging das Mädchen fort und gelangte glücklich an Ort und Stelle.
»Bist du von den Kindern der Muhme geschickt?« eilten dem Mädchen dort die Kinder, hastig fragend, entgegen – denn ebenso wie bei uns, war man auch dort aufgeregt und ungeduldig gewesen.
»Ja!« stammelte das bestürmte Mädchen, das kaum die Wohnstube erreichen konnte, da ihr alle lärmend und fragend folgten. Sie bemächtigten sich endlich des Tablettes, stürzten sich auf die Geschenke, um alles zu besichtigen, zu beurteilen und zu bewundern. Das unbeholfene Mädchen tat nicht so, wie wir befohlen hatten, da sich die Beschenkten die Sachen, ohne zu fragen, selber nahmen. Dann machten sich die Kinder daran, die für uns bestimmten Geschenke abzusenden. Das geschah in der nächsten Viertelstunde. Die arme Botin aber, welche mit solchem Jubel empfangen worden war, ging fast unbemerkt, ganz still fort und wurde von uns dann mit der gleichen Ungeduld und Spannung ausgefragt, ob man drüben sehr erstaunt gewesen, und welche Meinung über unsere Geschenke geäußert worden sei. Nun empfingen wir von unseren Cousinen die Gegengeschenke, welche unsere Erwartungen weit übertrafen oder – auch nicht. Bei ihrer Entgegennahme mußten wir an uns halten, ruhig zu bleiben. Wir durften uns vor der Botin nicht so ungeduldig und so neugierig zeigen, wie wir es tatsächlich waren; denn die Mutter hatte uns streng befohlen, ein ruhiges, würdiges Benehmen an den Tag zu legen.
Inzwischen wurden allerhand Purimspiele (Szenen aus der biblischen Geschichte, hauptsächlich aber mit einem Motiv aus dem Buch Esther) vorgeführt. Die erste Szene brachte das Achaschweros (König Artaxerxes)-Spiel nach der Migilla, diejenige, in der der König, Haman, Mardechai und die Königin Esther die Hauptrollen hatten. Gewöhnlich gab ein junger Bursche in Damenkleidern die Königin Esther, die von uns mit neugierig erregten Augen verfolgt und angestaunt wurde. Die Kleidung der anderen Darsteller zeichnete sich nicht durch besondere Reinlichkeit und Eleganz aus. Der dreieckige Hut mit dem Federbusch, die Epauletten und das Portepee waren aus dunkelblauem und weißgelbem Pappendeckel verfertigt. Die Aufführung dauerte länger als eine Stunde, und wir folgten ihr mit dem größten Interesse. Dann kam das Josefsspiel, dessen interessanteste Szenen der Bibel entlehnt sind. Bei allen Stücken wurde viel gesungen. Ich erinnere mich genau der Melodieen – und des komischen Tanzes, den Zirele Waans, eine Frau aus dem Volke, und ein armer Mann, Lemele Futt, aufführten. Sie tanzten und sangen dazu im Jargon. Wir kicherten heimlich über die grotesken Gestalten und ihre eckigen Bewegungen.
Am amüsantesten für uns Kinder war das sogenannte Lied von der Kose (Ziege). Ein Fell mit einem Ziegenkopf wurde von einem Mann, der darin stak, auf zwei Stöcken gehalten. Der Ziegenhals war mit allerlei bunten Glasperlen und Korallen, Silber- und Messingmünzen, Schellen und noch vielem anderen schimmernden, blinkenden Zeug behangen. Auf den beiden Hörnern waren zwei größere Glöckchen befestigt, die bei jeder Kopfwendung schrill erklangen und sich mit dem anderen bimmelnden Tand zu einer seltsamen »Musik« vereinigten. Der gute Mann im Ziegenfell machte allerhand Bewegungen, er tanzte, sprang hoch und nieder. Das Singen besorgte mit lustiger, heiserer Stimme der Führer der Kose (Ziege).
Das Liedchen lautet:
Afen hoichen Barg, afen grünem grus, (gras)
Stehn a por Deutschen mit die lange Beitschen.
Hoiche manen seinen mir
Kürze kleider gehen mir.
Owinu Meilach (Unser Vater, König)
Dus Harz is üns freilach. (fröhlich)
Freilach wellen mir sein
Trinken wellen mir Wein.
Wein wellen mir trinken
Kreplach wellen mir essen
Un Gott wellen mir nit vergessen.
Der Sänger war ein hagerer, langer, blonder Bursche, der das ganze Jahr in unserer Ziegelfabrik Lehm transportierte und den Spitznamen die »Kose« trug. Für uns kleine Kinder war das Schauspiel voller Ergötzlichkeiten. Aber wir konnten uns dennoch eines gewissen Angstgefühles nicht ganz erwehren und flüchteten uns auch bald, nachdem sie erschienen, auf den Ofen im Eßzimmer, von dem aus wir die Vorgänge mit mehr Sicherheit überschauen konnten. Und da sahen wir mit Interesse, wie »die Kose« ein Glas Branntwein hinuntergoß, das unsere Mutter ihr an den Mund gebracht hatte, dann steckte die Mutter ihr einen großen Purim-Mohnkuchen in den Mund, welchen die Kose, wie uns schien, im Nu verschluckte. Zu einer festen Ansicht, ob es denn wirklich eine Ziege war, oder ob ein Mensch darin stak, kamen wir nicht. Die Sache erschien uns durchaus rätselhaft....
Der Scherz wurde laut belacht, und der Lehmführer wurde mit einem guten Trinkgelde verabschiedet, wofür er mit komischen Gebärden dankte und alle segnete. Die vorgeführten Szenen fanden im Speisezimmer statt und wurden durch die vielen Boten, die Scholachmones brachten, oft unterbrochen. Die Boten harrten der Aufträge meiner Mutter, welche für die Abschickung der Gegengeschenke Anordnungen traf. Auf dem langen Tisch befanden sich verschiedene Sorten teuren Weines, englisches Porter, die besten Liköre, Rum, Kognak, Bonbons, Apfelsinen, Zitronen, marinierter Lachs. Diese edlen Dinge verteilte meine Mutter und meine älteren Schwestern unaufhörlich auf Teller, Schüsseln und Tablette. Es gab kein bestimmtes Maß, keine bestimmte Zahl. Eine Sendung bestand gewöhnlich aus einer Flasche Wein oder englischem Porter und einem Stück Lachs, aus Fischen und einigen Apfelsinen oder Zitronen. Ein so zusammengestelltes Geschenk war zumeist einem Herrn zugedacht. Die Geschenke für Frauen bildeten Kuchen, Früchte und Bonbons. Die Leute niederen Standes erhielten Honigkuchen, Nüsse, Äpfel auf einem Teller, der mit einem roten Taschentuch überdeckt war, dessen Enden nach unten zusammengeknotet wurden. Ich erinnere mich lebhaft eines aufregenden Vorfalles am Purim. Meine Mutter hatte vergessen, einem Hausfreunde Scholachmones zurückzuschicken.3 Das fiel ihr erst spät nachts ein, und sie konnte vor Ärger darüber nicht einschlafen. Am frühen Morgen kleidete sie sich rasch an und begab sich zu dem Freunde, um ihn um Verzeihung zu bitten und zu beteuern, daß der Irrtum nicht aus Geringschätzung, sondern aus Vergeßlichkeit geschehen wäre. Die Versicherung war nötig, denn der Freund hatte sich tatsächlich zurückgesetzt und verletzt gefühlt. Von solcher Wichtigkeit und Bedeutung war damals jeder jüdische Gebrauch!
Die Boten kamen und gingen, und so verflossen die Nachmittagsstunden von eins bis sechs Uhr, die uns Kindern lauter Naschwerk und Leckerbissen brachten. Diese Zeit pflegte der Vater für sein Nachmittagsschläfchen zu verwenden. Als er aufstand, erwartete ihn bereits der dampfende Samowar mit dem duftenden Tee auf dem Tisch. Sodann verrichtete er das Vorabendgebet. Denn die Sude (Festmahl) stand nahe bevor. (Nach der Vorschrift muß diese noch vor Abend beginnen.)
Der große Kronleuchter im gelben Salon wurde angesteckt. Alle Wachskerzen in den Wandleuchtern brannten. Auch die übrigen Zimmer waren hell erleuchtet. Die Tafel wurde aufs neue mit allen erdenklichen kalten, schmackhaften Speisen besetzt. Besondere Sorgfalt wurde an diesem Abend auf die Getränke verwendet, was in unserem Hause sonst nicht üblich war. Fast schien es, als sähe es unser Vater als gutes und gottgefälliges Werk an, wenn sich jemand am Purim ein Räuschchen antrank.
Wir Kinder führten an diesem Abend eine Posse auf, in der meine ältere Schwester und ich die Kleider der Njanja und der Köchin benützten. Sie waren natürlich zu lang und zu breit und schleppten nach. Meine Schwester stellte eine Mutter dar, ich ihre Tochter, deren Gatte sie mit einem Kinde in Armut verlassen hatte. Gute Menschen sollten uns nun helfen, den Mann aufzusuchen, denn sonst mußte ich eine »Agune« bleiben (d. h. ich durfte nicht mehr heiraten) und mußte seine Rückkehr abwarten. Auf die Frage, woher wir kämen, hatten wir mit verstellter Stimme geantwortet: »Aus Krupziki.« Unser Benehmen und unsere Haltung waren so ruhig und ernst, daß selbst unsere Mutter uns im ersten Augenblick nicht erkannte, geschweige die Gäste. Der Vater rief aus: »Wie hat sich der Diener unterstanden, diese Leute ins Speisezimmer hereinzulassen, worin Gäste sind? Was ist das für eine Belästigung?« Wir baten um Almosen in Geld oder in Speisen, wir wären hungrig und hätten heute noch nichts gegessen – das alles sprachen wir im echtesten Jargon. Unsere Bitte um Speise und Trank wurde bald erfüllt, man lud uns ein, am Tisch Platz zu nehmen. Wir taten es mit gespielter Befangenheit, und wir begafften und bewunderten alles, was man uns vorsetzte und sparten nicht mit Seufzern, was die Tischgenossen zum Kichern brachte. Wir waren so gut vermummt, der abenteuerliche Kopfputz war so tief in die Stirn gerückt, daß wir den Scherz unerkannt bis zu Ende führen konnten.
Wie ich mich seit meiner zartesten Jugend bis in die späteste Zeit erinnern kann, wurde am Purimfest bei uns zu Hause immer bis zum Tagesanbruch viel gegessen, getrunken und gelacht. Es herrschte Heiterkeit bis zur Ausgelassenheit. Alle sonst verbotenen Streiche und Possen waren gestattet. Jede Disziplin bei Tische war aufgehoben. Das Fest ließ die beste Erinnerung zurück und auch greifbare Andenken: eine hübsche Halsbinde, ein kleines Parfum-Flacon, das man immer wieder in den Händen hin- und herwandte, um das Etikett, das man schon auswendig kannte, wieder mit erneutem Vergnügen zu lesen. Lange wurde das Fläschchen in der Kommode verwahrt, bis es bei einer wichtigen und passenden Gelegenheit zur Benutzung kam.
Schon am darauffolgenden Tage, am Schuschan-Purim, hielt meine Mutter mit der Köchin langen Rat über die großen Vorbereitungen zum Pesach (Osterfest). Die wichtigste Speise, rote Rüben zum Einlegen für den »Borscht« in einem »gekascherten« Faß, wurde schon an diesem Tag angesetzt. Nach einigen Tagen erschien auch schon Wichne, die Mehlverkäuferin, in ihrem unvermeidlichen Pelz und brachte allerlei Mehlproben für die Mazzes. Meine Mutter beriet sich mit meiner älteren Schwester beim Prüfen des Mehles, man knetete aus den Proben einen Teig und buk kleine dünne Plätzchen, bis die Wahl auf eine erprobte Mehlgattung fiel. Einen Tag vor Rosch-Chodesch (Neumond) Nissan mußte meine ältere Schwester einen Sack nähen (denn die Mutter traute der Köchin nicht, daß sie das auch genügend sauber machen würde) und das mußte vorsichtig in einer gewissen Entfernung von Brot oder Grütze geschehen: Meine Mutter war in allen diesen Vorbereitungen zum Osterfest so peinlich, daß die Köchin darob oft außer sich geriet und grob wurde.
Meine älteren Schwestern bereiteten für die Feiertage moderne, hübsche Putzsachen vor. Schneider, Schuster und Putzmacherinnen fingen an, häufige Besucher in unserem Hause zu werden, mit denen die Saisonangelegenheiten gar oft überlaut erörtert wurden. Rosch-Chodesch Nissan rückte heran, und nun begann man mit dem Backen der Mazzes. Diese Arbeit bildete eine Aufgabe in der häuslichen Wirtschaft, mit der sich alle Hausgenossen, selbst Vater und Mutter, beschäftigten. Schon am Vortage, ganz früh am Morgen, erschien Wichne, die Mehlfrau, mit dem Säckel Mehl unter dem Pelz, der diesmal vorn mit einer langen, bis an den Hals reichenden Schürze bedeckt war. Den weißen, aus dünner Leinwand verfertigten Sack brachte meine Schwester ins Speisezimmer, wohin auch Wichne mit dem Mehl folgte. Wir Kinder durften natürlich auch da nicht fehlen, um andächtig die abgemessenen Töpfe Mehl mitzählen zu helfen. So und so viel Töpfe wurden gezählt; der Sack wurde verbunden, in einen Winkel des Eßzimmers gestellt, und sehr sorgfältig mit einem weißen Leintuch bedeckt. Uns Kindern wurde streng verboten, mit Brot oder sonstigen Speisen in die Nähe zu kommen, was wir ganz begreiflich fanden. Am nächsten Morgen erschien das unentbehrliche Faktotum, die Aufwartefrau, die den Spitznamen Meschia Cheziche führte, dieselbe, die schon zu Beginn des Herbstes als Aufseherin bei allen häuslichen Arbeiten fungierte. Ihr ganzes praktisches Wissen bewährte sich hauptsächlich beim Einlegen von Kohl und beim Einkellern von Gemüse. Sie lebte mit ihrem Mann in einer Lehmhütte bei unserer Ziegelfabrik, für die er Lehm transportierte, hielt sich aber die meiste Zeit bei uns auf. Sie war wirklich eine treue Seele, die sich für jedes von uns Kindern aufgeopfert hätte. Ich sah sie nie anders als in einem zerlumpten, blaugestreiften Kattunkleid und in einem Paar sehr großer Schuhe, die ihr bei jedem Schritt von den auch im Sommer beinahe erfrorenen Füßen herabfielen. Das braun-blau erfrorene Gesicht, war mit einem ehemals weißen Kattuntuch umwickelt, ein schmaler roter Wollstreifen um die Stirn gebunden und zwei Enden eines Schleiers hingen wie Flügel im Nacken. Die kleinen, tief in den Kopf gesunkenen matten Augen drückten immer Wohlwollen und Dankbarkeit aus. Der ungeheuer breite Mund mit den schmalen Lippen schien nur die Worte sprechen zu können: »Gute Leut', erwärmt mich und gebt mir etwas zu essen.«
Meine Schwestern ließen jeden Herbst einen wattierten Rock und andere warme Kleidungsstücke für sie anfertigen. Es scheiterte aber jeder Versuch, dieses gänzlich durchfrorene Wesen zu erwärmen. Also Meschia Cheziche kam; zuerst erhielt sie in der Küche einen Teller voll heißer Grützsuppe, und nachdem sie gesättigt war und sich etwas erwärmt hatte, schlich sie zur Tür des Speisezimmers, streckte den Kopf zur halbgeöffneten Tür herein und meldete sich. Meine Mutter befahl ihr, sich ordentlich zu waschen; dann zog man der hageren Gestalt ein langes, weißes Hemd über ihre Kleider und der Kopfputz wurde mit einem weißen Leinentuch, das auch den breiten Mund bedeckte, umwunden. In diesem Aufzug, der ihr ein gespensterhaftes Aussehen verlieh, mußte sie nun das Mehl für die Mazzes durchsieben. Nachdem sie meine Mutter mit den Worten gesegnet hatte: »Derlebts über a Juhr (künftiges Jahr) mit Eurem Mann und Kinderlach in großen Freuden!« begann sie ein Sieb nach dem anderen auf den vorbereiteten Tisch zu schütten. Welch ein ergötzlicher Anblick, diese Erscheinung bei der Arbeit zu sehen! Wir Kinder standen in gemessener Entfernung und sahen aufmerksam zu. Meschia Cheziche war das Sprechen streng untersagt, damit kein Tröpfchen aus ihrem Munde in das Mehl falle. Nach beendigter Arbeit blieb sie die Nacht in der Küche, und am frühen Morgen scheuerte sie die großen roten Kisten, in denen das ganze Jahr reine Wäsche aufbewahrt wurde, und, obgleich sie nie mit Speisen in Berührung kamen, faßte sie mit kräftigen Händen an und wusch sie gründlich, damit sie in tadelloser Reinheit die Mazzes aufnähmen. Dann kamen die Holztische und die Bänke an die Reihe, die ebenfalls die Kraft des von Meschia Cheziche geführten Scheuerbesens zu fühlen bekamen. Auch die vielen Dutzende Rollhölzer, Blechplatten, die ebenso gründlich gereinigt wurden, wurden nicht verschont. Erbarmungslos rieb und scheuerte man auch zwei große Messingbecken, legte rotglühende Eisenstäbe darein und schüttete erst kochendes, dann kaltes Wasser so lange darauf, – ein solches Reinigen nennen die Juden. »Kaschern« – bis das Wasser überlief; später wurden sie noch einmal gescheuert und dann blank geputzt, daß sie funkelten.
Das Wichtigste beim Mazzesbacken ist das Wasserholen vom Brunnen oder Fluß, was als große Mizwe (gottgefällige Handlung) gilt. Das Geschirr zum Mazzeswasser besteht aus zwei großen Holzschaffeln, die mit grauer Leinwand überspannt waren, einem Eimer mit einem großen Schöpfer und zwei großen Stangen. Das fehlende Geschirr wurde natürlich neu ergänzt. Nachdem noch die große Küche im Hof gereinigt, die Ziegel des Backofens durchglüht und »gekaschert« waren, wurde viel trockenes, harziges Holz, das unser bewährter alter Wächter Feiwele den ganzen Winter über zu diesem Zweck gesammelt hatte, in die Küche gebracht. Am Vorabend vor Rosch-Chodesch Nissan gab es im Hof vor dem Brunnen oder am nahen Fluß ein seltsames Schauspiel: Mein Vater, meine Schwäger begaben sich in eigener Person, die Wasserschaffeln auf den langen Stangen tragend, zum Brunnen oder Fluß, um Wasser zu holen und es nach der großen Küche zu bringen, wo die Schaffeln auf eine mit Heu bedeckte Bank gestellt wurden. Die Mutter und wir Kinder liefen dem seltsamen Zuge bald voran; bald hinterdrein. Die jungen Männer waren dabei vergnügt und munter. Mein Vater hingegen war ernst, denn diese Bräuche waren ihm als eine gottgefällige Handlung heilig. Meine Schwäger brachten auch den wohlverwahrten, verhüllten Sack Mehl in die große Küche. Meschia Cheziche blieb die Nacht da, um rechtzeitig am nächsten Morgen den Ofen zu heizen. Alle gingen zeitig zu Bette, um beim Beginn des Mazzebackens früh zugegen sein zu können.
Ich drängte mich am nächsten Morgen gleich an den Ofen und sah mit großem Interesse zu, wie gewandt eine alte Frau die runden, dünnen Mazzen in den Ofen schob, die halbgebackenen zur Seite rückte, die ganz fertigen mit beiden Händen sammelte und in einen Korb auf der nahe bei stehenden Bank warf, ohne daß auch nur eine einzige zerbrach, trotzdem sie so dünn und zerbrechlich waren. Mir wurde bald eine Beschäftigung zugewiesen: ich sollte die geschnittenen Stücke Teig den mit Rollhölzern bewaffneten Weibern reichen, die um den langen, mit Blechplatten bedeckten Tisch standen. Meine ältere Schwester hatte mich immer im Frühaufstehen übertroffen; auch jetzt erzählte sie mir mit Stolz, daß sie schon viele Mazzen aufgerollt habe, die sogar schon gebacken seien. Ich war mit mir sehr unzufrieden, schalt mich selber eine Langschläferin und suchte mich nun um so nützlicher zu machen. Ich beruhigte mich erst dann über das späte Aufstehen, als mich das viele Umherlaufen und Herumstehen tüchtig ermüdet hatte. Ich wusch mir die Hände und ging in die zweite Kammer, wo der Teig geknetet wurde. Da stand eine Frau über ein funkelndes Messingbecken gebeugt und knetete, ohne einen Laut von sich zu geben, ein Stück Teig nach dem andern aus abgemessenem Mehl und Wasser. Ich machte mich auch da nützlich, indem ich mir von dem kleinen Jungen, der das Wasser in das Mehl zu gießen hatte, den großen Schöpfer ausbat und seine Arbeit bedächtig und still ausführte, hie und da die knetende Frau ansehend, die über den Kleidern gleich Meschia Cheziche ein langes, weißes Hemd trug und eine Schürze, die in der Taille nicht eingeschnürt war. Kopf und Mund waren mit weißen Tüchern verbunden, ebenso wie bei Meschia Cheziche. Ich half mit, bis mich die Müdigkeit übermannte.
Das Backen der Mazzen dauerte fast zwei Tage. Meine Mutter ging unermüdlich umher und besah von Zeit zu Zeit die Rollhölzer, mit denen die Frauen die Mazzes rollten, um den angeklebten Teig abzukratzen; bei dieser Arbeit halfen meine Schwäger und mein Bruder, die mit kleinen Stückchen Glasscherben bewaffnet waren. Die Teilchen mußten entfernt werden, weil der angeklebte Teig bereits Chomez (d. h. gesäuerter Teig ist), und somit in den Mazzenteig (der ungesäuert ist), nicht eingeknetet werden darf. Auch beim »Rädeln« der Mazzen halfen die jungen Männer mit; und es fiel keinem ein, eine solche Arbeit für unpassend zu halten, da alles, was Pesach und besonders die Mazzen betraf, als eine religiöse Handlung betrachtet wurde. Am darauffolgenden Tage untersuchte meine Mutter alle Mazzen, deren es oft mehrere Tausend gab, ob sich nicht etwa darunter eine verbogene oder nicht ganz ausgebackene befand. Denn eine solche war schon Chomez und mußte beseitigt werden.
In strenger Ordnung legte man nun die tadellosen Mazzen reihenweise in die großen roten Kisten, die mit einem weißen Tuch bedeckt wurden. Meine Mutter hatte unter dem Tuche eine Mazze vorgenommen und ohne sie anzusehen, sogar mit geschlossenen Augen, die Hälfte abgebrochen, indem sie ein frommes, eigens für diese Handlung festgesetztes Gebet leise hersagte. Dann warf sie dieses Stück Mazze wieder, ohne es anzusehen, in die Flammen. Diesen Gebrauch nannte man »Challe nehmen«; er soll wahrscheinlich an das Brandopfer der biblischen Zeiten erinnern.
Die nächste Zeit bis Pesach verging in endlosen Vorbereitungen für die Wirtschaft, für Kleider und Putzsachen. Endlich nahte der wichtige Tag des Erew-Pesach heran. Da erreichte die Arbeit ihren Höhepunkt! Am Abend vorher wird auch eine rituelle Handlung vollzogen: das Bedike-Chomez, d. h. das Fortschaffen des gesäuerten Brotteiges aus dem Hause. Da begab sich meine Mutter in die Küche, ließ sich von der Köchin einen hölzernen Löffel und einige Gänsefedern geben, wickelte um beides einen weißen Lappen, nahm ein Wachskerzchen dazu, band das ganze mit einem Bindfaden fest und brachte es in das Zimmer des Vaters, wo sie es auf das Fensterbrett legte. Diese scheinbar bedeutungslosen Gegenstände sollten Abends bei einer religiösen Handlung verwendet werden. Mein Vater nahm, nachdem er zu Abend gebetet hatte, das Bündel, steckte das Wachskerzchen an und übergab es meinem Bruder, dessen Hand ihm als Leuchter dienen sollte, und nun ging der Feldzug gegen den Chomez durch das ganze Haus. Jedes Fensterbrett, jeder Winkel, in dem man Speisen vermutete, wurde von meinem Vater untersucht und von meinem Bruder mit dem Wachskerzchen erleuchtet. Die aufgefundenen Krümel wurden mit den Federn in den Löffel gescharrt, nachdem mein Vater das dazu bestimmte Gebet gesprochen hatte. Wir Kinder machten uns manchmal den Spaß, vorher überall Krümelchen anzuhäufen, worüber sich der Vater wunderte, da doch an diesem Tage die Fensterbrettchen gewöhnlich mit besonderer Aufmerksamkeit gereinigt wurden. So untersuchte er nun gründlich die Fenster, und die Mutter mußte sich beeilen, das noch vorhandene Brot aus dem Hause zu schaffen, denn das Gesetz gebot, daß alles Brot, das auf der Suche durchs Haus vorgefunden wurde, gesammelt und verbrannt werde. Nachdem diese Handlung vollbracht war, speiste man etwas früher zu Abend als sonst. Das inzwischen verborgene Brot durfte nun zwar auf den Tisch kommen, die gesammelten Brotkrümel im Löffel aber wurden mit dem Wachskerzchen und den Federn in einen Lappen gebunden und auf dem Hängeleuchter im Speisezimmer recht hoch befestigt, damit es keine Maus erreiche, welche die Krümel sonst wieder zerstreuen könnte. Man ging zeitig schlafen, um am nächsten Morgen recht früh aufzustehen, denn um 9 Uhr morgens darf sich kein Bissen Brot oder sonstiger Chomez im Hause eines religiösen Juden vorfinden. Wir Kinder wurden sehr früh geweckt und sollten Frühstück und Mittagessen auf einmal verzehren. Das Nationalgericht für diesen Morgen ist heiß gesottene Milch mit Weißbrot. Doch war selbst zu dieser frühen Stunde schon ein Braten fertig, an dem sich mancher Hausgenosse gütlich tat. »Und nun rasch, rasch!«, trieb meine Mutter alle im Hause an, auch die Dienerschaft aß doppelt so viel als sonst, denn es durfte ja nichts vom Chomez zurückbleiben. Wir Kinder machten allerhand Späße und verabschiedeten uns dann für volle acht Tage vom Brote. Das Geschirr wurde rasch gewaschen, und die Mutter befahl dem Diener, alles ins Speisezimmer zu bringen. Von dem teuren Porzellanservice an bis zur letzten Kupferkasserole wurden alle Stücke bunt durcheinander auf die Diele, den Tisch, die Fenster gestellt und dann mußte alles in große Kisten gepackt und auf den Boden gebracht werden, woher sodann die gefüllten Kisten mit dem Pesachgeschirr herunter getragen wurden. Das Speisezimmer wurde wieder gründlich gereinigt, die Fensterbrettchen mit weißem Papier bedeckt. Der große Speisetisch wurde auseinandergezogen, mit einem weißen Tuch oder mit Papier bedeckt und dann der zu seiner ganzen Länge ausgezogene Tisch mit dickem Filz, einer Schicht Heu und vieler grauen Leinwand bedeckt, die mit kleinen Nägeln befestigt wurde. Nach dieser Prozedur durfte erst das Pesachgeschirr ausgepackt werden, das wir Kinder mit so großer Neugierde erwarteten, weil jedes von uns darunter seine bestimmte Kaus (kleiner Becher von hübscher Form) hatte. Aber damit nicht genug! Es gab um diese Zeit auch an allen Orten und in allen Zimmern viel Interessantes für uns zu sehen, besonders im Hof, wo alle Holztische und -bänke zum Kaschern aufgestellt waren. Man begoß den Tisch oder die Bank mit siedendem Wasser, strich mit einem zum Glühen gebrachten Eisen darüber hin und her und schüttete dann gleich kaltes Wasser auf die Gegenstände. Außer diesem Schauspiel gab es aber noch etwas Großartigeres: der Vater erschien nämlich in der Küchentür mit dem Chomez von gestern in der Rechten und ließ Feiwele, den alten Wächter, Ziegelsteine und trockene Holzstücke bringen. Der Alte besorgte das blitzschnell, errichtete aus den Ziegeln einen kleinen Herd und legte die Holzstücke darauf. Mein Vater legte den Löffel mit den darin befindlichen Krümeln auf den Scheiterhaufen und ließ das Holz in Brand setzen. Wir Kinder liefen hin und her, um uns, wenn irgend möglich, dabei nützlich zu machen. Das trockene Holz fing sofort Feuer, und ein Flämmchen nach dem anderen züngelte aus dem Scheiterhaufen hervor. Und wir Kinder schrieen: »Seht, seht, die Federn sind schon versengt! Der Lappen brennt schon …« Endlich verschlangen die vereinten Flammen auch den Löffel, und es dauerte nicht länger als 10 Minuten, so war das Autodafé des Chomez vollzogen. Mein Vater verließ nicht eher den Schauplatz, als bis alle Überbleibsel des Scheiterhaufens weggeräumt waren, denn nach der Vorschrift darf man selbst auf die Asche nicht treten, auch wenn es »Nutzen oder Vergnügen« brächte.
Wir Kinder sprangen von da in das Eßzimmer, wo »Schimen, der Meschores« (der Diener) mit dem Auspacken des Pesachgeschirrs beschäftigt war. Wir wollten auch hier helfen und von unseren Kausses (Weinbecherchen) Besitz ergreifen, da schmunzelte der Bocher (Junge) schalkhaft und meinte, daß wir dazu noch nicht gehörig vorbereitet seien. Wir waren verblüfft und sahen ihn fragend und bestürzt an. Mit gleichgiltiger Miene erklärte er, daß wir noch nicht gescheuert und gekaschert seien. »Wieso gekaschert?« fragten wir. »Ja, ja«, versetzte unser Peiniger, »Ihr müßt heiße, glühende Steindelach (Steinchen) in den Mund nehmen, sie dort herumkollern, hernach mit kaltem Wasser ausspülen, ausspucken, dann erst dürft Ihr dieses Geschirr anrühren.« Wir fanden keine Antwort und stürzten weinend in die Küche, wo meine Mutter in voller Arbeit war. Sie beriet eben mit der Köchin die Bereitung des Indian-Vogels, eines riesigen Truthahns, der bereits geschlachtet, gerupft, gesengt, gesalzen und dreimal mit Wasser abgespült war. Jetzt lag er auf dem Brett, und die Köchin hielt ihn mit beiden Händen fest, als wenn er davonfliegen wollte, während die Mutter, mit einem großen Küchenmesser bewaffnet, den Hauptschnitt ausführte. Unweit von diesem Schauplatz, rechts von der Bank, lag auf einem neu abgehobelten Brett in seiner ganzen Länge ein silberschuppiger Hecht aus dem Flusse Bug, noch der kunstgerechten Behandlung harrend. Auf der linken Seite stand der sauber gescheuerte Küchentisch, auf dem sich verschiedene Schüsseln, Teller, Gabeln, Löffel befanden, ferner ein großer Korb Eier, ein Topf Mazzesmehl, das meine Schwester eben siebte und aus dem später die schmackhaften Torten, Mandelkuchen usw. bereitet wurden. Wir wollten nun die Mutter fragen, ob Simon Recht hätte. Aber wir blieben, von der Mutter reger Arbeit gefesselt, stehen. Die schreckliche Vorstellung von den glühenden Steindlach im Mund erpreßte uns ein leises Schluchzen und meine jüngere Schwester überredete mich, die Mutter doch zu interpellieren. Allein die Mutter kam uns zuvor. Ihr war unser Flüstern längst aufgefallen und, halb verwundert, halb ärgerlich, fragte sie uns, weshalb wir so ungestüm in die Küche gestürzt wären. Da erzählten wir mit kläglicher Stimme, in halben Sätzen, was der böse Schimen uns gesagt hatte. Sie verstand nicht recht und ward ungeduldig. Dann schrie sie plötzlich auf: »Was für glühende Steindelach? Wer hat sie in den Mund genommen? Wer hat sich mit heißem Wasser begossen?« Nach einer langen Auseinandersetzung erfuhr sie endlich die eigentliche Ursache unserer Besorgnis: Sie ließ Schimen sofort kommen und verbot ihm energisch, uns so dummes Zeug vorzuschwätzen. Uns sagte sie, wir sollten uns waschen und reine Kattunkleidchen anlegen, dann wären wir würdig, unsere Kausses in Empfang zu nehmen. Im Nu waren wir angekleidet. Mit triumphierenden Mienen sprangen wir ins Eßzimmer und halfen nun das Geschirr abwischen.
Unter diesen und ähnlichen Arbeiten verging der halbe Tag, bis unsere gesunden Magen daran erinnerten, daß wir seit 9 Uhr morgens nichts gegessen hatten. Wir wußten im voraus, was man uns geben würde. Man brachte den großen Gonscher (eine sehr breite Flasche) mit süßem Meth, den meine Mutter so meisterhaft zu kochen verstand, und ein volles Sieb mit Mazzes: bis zu diesem Tage waren sie in strenger Verwahrung gewesen, da vor den Feiertagen Mazzes zu essen bei frommen Juden nicht erlaubt ist. Man füllte also unsere Kausses mit Meth und wir machten uns an die Mazzes. Ein Stück nach dem andern wurde in Meth getaucht und verschwand rasch, von unseren gesunden Zähnen wie zwischen Mühlsteinen zermalmt.
Die Mutter kam endlich aus der Küche herein. Auch mein älterer Bruder erschien und brachte Äpfel, Wallnüsse und Zimt. Aus diesen Materialien bereitete er, indem er alles in einem Mörser zerstieß, Charauses, d. i. eine Masse, welche wie Tonlehm aussieht und abends auf den Sedertisch kommt. Der »Lehm« soll daran erinnern, daß unsere Vorfahren in Egypten für den Pharao Ziegelsteine kneteten.
Nachdem mein Bruder mit dieser Arbeit fertig war, ließ die Mutter den Eßtisch in den gelben Salon tragen und in seiner ganzen Länge vor dem Sopha aufstellen. Sie bedeckte ihn dann mit einem weißen Damasttischtuch, das nach beiden Seiten bis zur Diele reichte. Dann ließ sie den Diener das Porzellan- und Kristallgeschirr bringen, ordnete es und ging selbst an den Schrank, der das ganze Silbergeschirr enthielt. Der Diener stellte auf das große silberne Tablet die Becher und Kannen, die sehr schön gearbeitet waren. Namentlich eine Kanne war besonders kunstvoll durch Intarsien aus Elfenbein, die mythologische Figuren darstellten. Der Deckel und das Gefäß waren aus massivem Golde. Mein Vater hatte einige hundert Rubel für das Kunstwerk bezahlt. Eine andere ziemlich große Kanne war aus getriebenem Silber. Daneben standen große und kleine Becher, deren Boden französische Münzen bildeten.
1
Dokumentarisch ist es, daß mein Großvater, dem auch der Ehrenbürger-Titel verliehen wurde, von General Deen, dem Chef der Arbeiten bei dem Bau der Festung in Medlin bei Warschau, Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, aus der Provinzstadt Bobrujisk nach Warschau berufen wurde, um Arbeiten an den grossen Festungsbauten zu übernehmen. Die Uebernahme solcher Arbeiten hat meinen Vater auch zur Uebersiedlung nach Brest veranlasst.
2
Die Einladung lautete »Zu Latkes geladen«.
3
Die damaligen Sittenregeln forderten, dass der jüngere Mann oder die jüngere Frau den älteren zuerst Scholachmones schicken musste.