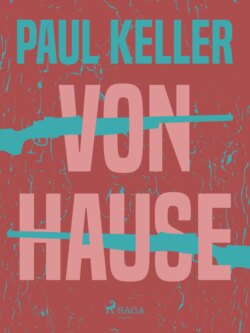Читать книгу Von Hause - Paul Keller - Страница 5
In den Grenzhäusern
ОглавлениеErzählung aus den schlesischen Bergen
Es war in meinen jungen Jahren. Alle Ferientage war ich oben in den Bergen, die ihren gewaltigen Grenzkamm zwischen Preussen und Österreich hinstrecken an die vierzig Meilen lang. Das ging immer hinüber und herüber in den dunklen Wäldern und langgestreckten Tälern, immer auf einsamen, zeigerlosen Wegen, dass man wirklich oft nicht wusste: Bist du nun noch im Vaterland oder bist du schon im „Ausland“? Denn das Volk ist hüben wie drüben — derb, treuherzig, von derselben Tracht und Sprache und nimmt das Zweimarkstück an Stelle des Guldens diesseits wie jenseits.
An einem trüben Sommerabend kam ich in die „Grenzhäuser“. Die Grenzhäuser lagen noch auf preussischer Seite an einem waldigen Abhang, über dem die Kammlinie aufstieg, an der diesseits das preussische, jenseits das österreichische Zollhaus stand. Drüben über dem Berge das erste böhmische Dorf hiess auch Grenzhäuser. Es war natürlich eine Gemeinde für sich und führte den gleichen Namen nur aus dem einzigen Grunde, weil es eben schwer ist und verdriessliches Kopfzerbrechen macht, immer neue Ortsnamen zu erfinden. In den preussischen Grenzhäusern bestand seit alter Zeit ein Gasthaus, das auf den Namen „Der rote Hahn“ getauft war; als viel später in den österreichischen Grenzhäusern auch ein Wirtshaus entstand, nannte es sein Besitzer „Der blaue Hahn“, weil er ein wenig neuerungssüchtig veranlagt war.
Im „Roten Hahn“ kehrte ich an jenem Sommerabend ein. Ich war sehr durstig und verlangte ein Glas Bier. Der biedere Wirt betrachtete mich und meine grüne Jugend, schüttelte den Kopf und sagte: „Trink’ du lieber a Glas Puttermilch, mei Jüngla; Bier ies fer dich zu stork.“ Ich ärgerte mich sehr über diese Ansprache, denn ich hielt mich bereits für einen jungen Herrn, aber ich bekam nichts anderes als Buttermilch. Eine Weile darauf kam der Wirt wieder an mich heran und forderte mich auf, eine rotscheckige Kuh suchen zu helfen, die sich in den Wäldern verirrt habe. Innerlich war ich empört und sagte mir, es sei eine Frechheit, einen zahlenden Touristen also zu behandeln, denn was ginge mich die rote Kuh des Wirts an; äusserlich machte ich aber nur eine abgespannte Miene und sagte: ach, ich sei so weit gegangen an diesem Tag und sehr müde. Da fasste mich der herkulische Mann an der Schulter: „Na marsch, marsch, tu ni erscht su stupide und zimperlich!“ und schob mich zur Tür hinaus. Es nutzte nichts, ich musste dem barfüssigen Hüterjungen und einer Magd die verlorene rote Kuh suchen helfen. Ich tat es mit tiefem Ingrimm und beklagte es, in eine so barbarische Gegend geraten zu sein. Aber wir hatten Glück. Als wir gerade auf die Suche gingen, und zwar nach einem wohlerwogenen Kriegsplan, der Hüterjunge nach Norden, die Magd nach Süden und ich nach Westen, kam die Kuh von der Ostseite her angetrabt und meldete sich mit einem donnernden Gebrüll zur Stelle.
„Na siehste,“ sagte der Wirt belehrend zu mir, „wenn man nur die Arbeit nich scheut, bringt se immer ihren Segen.“
Zum Abendbrot bekam ich ein neues Glas Buttermilch, einen Berg von Bratkartoffeln, Butter, Brot, Wurst und Käse vorgesetzt.
Das fand ich nun recht anständig, aber ich dachte an die Kostenrechnung und sagte, so viel könne ich nicht essen. Da nahm mich der Wirt unter die Arme, hob mich ein paarmal in die Höhe und sagte verächtlich:
„Neunzig Pfund hechstens wiegt die Borste. Wie alt bist du denn nu schon?“
„Achtzehn Jahre,“ sagte ich. „Ich besuche das Breslauer Seminar und bin schon im zweiten Kursus.“ Ich dachte, das würde dem Mann imponieren, aber es war leider nicht der Fall.
„Miserabel siehste aus,“ sagte er; „wahrscheinlich haste de Schwindsucht.“
Ich sagte dem Gemütsmenschen beklommen, dass ich zwar ein wenig mager, aber ganz gesund sei. Das glaubte er aber nicht, sondern meinte:
„Das is ja eben das Gutte bei sulchen Leuten, dass se selber nich wissen, wie’s um se steht. Meine Schwägern, die hat’s nich geglobt, dass se de Schwindsucht hätte, bis se tot war. Die sah grade su aus.“
Mir wurde plötzlich ganz übel, und ich liess mutlos den Löffel sinken.
„Ich hab’ keinen Appetit mehr,“ sagte ich leise.
„Das is bluss wegen deinem verknuchten Gelabere,“ fuhr nun die rundliche Wirtin ihren Mann an; „su einem jungen Blutte su an elendiglichen Quatsch vorreden, das is ja a reenes Verbrechen! Junger Herr, hör’n Se bloss nich uff den alen Esel, der weess nich, was a labert.“
„Nanu,“ sagte der Wirt betroffen, steckte die Hände in die Hosentaschen und sah immer verwundert zwischen mir und seinem Weibe hin und her. „Was — was hab’ ich denn etwa verbrochen?“
Die Wirtin stand kirschrot vor ihm.
„Wenn eener wirklich — nee, nee, du bist ja zu a tummes Luder!“
Sie fasste ihn am Arme und zog ihn hinaus. Ich blieb trübselig hinter dem reichbeladenen Abendbrottisch sitzen. Nach etwa zehn Minuten kam der Wirt wieder herein. Er kratzte sich hinter den Ohren, machte eine sehr verlegene Miene und sagte kopfschüttelnd:
„Meine Ale is zu komisch. Do denkt se nu, Sie könnten denken, ich hätt’s ernste gemeent. Nu do müsst ich ju — do müsst ich ju wirlich a aler Labersack erster Klasse sein, wenn ich ei’m Menschen wie Sie sulches Zeug vorredte. ’s war doch bluss Sposs. Denn Sie sein ju wie Milch und Blutt — und Gewichte haben Se — schwer leck — ich hab Se kaum erheben können — und Muskeln ha’n Sie und zu a Suldaten werden Se komm’, a starker Kerl sein Se!“
„Du laberst ja schun wieder,“ kam die Wirtin zur Tür hereingefahren; „denn das globt a doch jitzt nich. Do merkt a doch, wie der Hase leeft.“
„Ich sag’ überhaupt nischt meh,“ sagte der Wirt und setzte sich beleidigt in einen Winkel.
„Das is ooch viel besser,“ entgegnete ihm die Gattin. „Und Sie, junger Herr, machen Se sich nischt draus. Essen Se immer recht tüchtig und sein Se viel ei freier Luft, do kriegen Se im Läben keene Schwindsucht.“
„Ganz dasselbe, was ich von Anfang an gesat ha,“ brummte der Mann im Winkel.
Dann wurde es still.
Nach einer Weile fragte mich die Wirtin, ob ich noch ein Glas Buttermilch wünschte. Ich dankte. Der Wirt fuhr höhnisch lachend empor.
„Puttermilch! Nischt wie Puttermilch! Davo kriegt eener freilich keene Schwindsucht. Aber die Cholera kriegt a! — Das is doch kee Junge meh, das is doch a Herr. Eener, der schon im zweeten Seminar is. Fer den passt keene Puttermilch, fer den passt a Seidel Bier!“
Er brachte zwei Gläser Bier und lud mich ein, mit ihm auf der Bank vor der Haustür Platz zu nehmen.
Das war der Anfang meiner Freundschaft mit dem Roten Hahnenwirt Heinrich Hollmann, einer Freundschaft, die noch heut besteht.
Der Abend war still und trüb. Es war, als hätten alle Bäume in schlaffer Trägheit die Köpfe geneigt. Der Nebel stieg langsam und müd’ vom Tale auf, über dem Kammweg lag ein fahler Schein, gelb wie Laternenlicht. Am Waldrand huschte eine Eule, sonst regte sich nichts.
„Das wird eine gute dunkle Nacht,“ sagte der Hahnenwirt. Dann fing er an, mir Schmugglergeschichten zu erzählen, eigentlich die einzige Art von Geschichten, die er in den Grenzhäusern erleben konnte.
„Die die Schmuggler für schlechte Leute halten,“ sagte mein neuer Freund, „sein alles tumme Kerle. Die wissen eben nich, wie’s hier zugeht. Das bissel kleener Grenzverkehr rüber und rüber macht keen Staat arm oder reich. Da lohnt sich der ganze Sums mit den Grenzjägern nich. ’s is olles Quatsch.“
„Aber es wird doch manchmal einer erschossen,“ wandte ich ein.
„Erschussen? Ja, Schmuggler — Grenzjäger nich! Da könn’ Se lange suchen, eh Se een erschuss’nen Grenzjäger finden. Nu ja, ’s is mal a schlechter Kerl drunter, wie ’s halt ieberoll schlechte Kerle gibt; aber sunst sein de Schmuggler ehrenwerte Leute. Orme Teifel sein’s, die sich amal a paar Pfennige schwer genug verdien’. Wovon soll’n se denn leben hier in diesen Bergen?“
„Sie sind wohl auch ein Schmuggler?“ fragte ich harmlos.
Aber da fuhr er auf.
„Jüngla,“ sagte er, „nimm dich in acht, sunst hau ich dir eene runter. Beleidigen loss’ ich mich nich!“
Ich erschrak über diesen Entrüstungsausbruch und stammelte eine Entschuldigung, setzte auch beschwichtigend hinzu, dass ich selbst schon Kleinigkeiten für den eigenen Bedarf geschmuggelt hätte. Da knurrte er:
„Wer hier in der Gegend nich schmuggelt, is blödsinnig!“
Später, viel später war einmal der Deutsche Kaiser im schlesisch-böhmischen Grenzgebirge, Es wurde ihm ein Glas böhmischen Weines vorgesetzt. Er trank ihn und sagte: „Na prosit, — geschmuggelt ist er ja sicher!“ Und lachte.
An jenem Abend aber griff ich in die Tasche, zog einen Papierbeutel heraus und bot meinem Gastfreund eine Zigarre an. Der sah mich betroffen an.
„Der Junge roocht,“ sagte er, „und hat doch de —“
„Ich hab’ nicht die Schwindsucht,“ unterbrach ich ihn. „Nehmen Sie nur.“
„Österreicher,“ sagte er anerkennend, als er die Marke prüfte, „seht amal die Borste an! Na, wenn sich das bluss mit dem Biere und der vielen Puttermilch verträgt.“
Dann rauchten wir und schwiegen. Ein Mann stieg vom Kammweg herunter, den ich nach einiger Zeit als einen Grenzjäger erkannte.
„Da kommt ein Grenzer.“
„Ja,“ meinte Hollmann, „eener, der noch Durst hat. Es is Wenzel Hollmann von der anderen Seite.“
„Ist er verwandt mit Ihnen?“
„Weil er Hollmann heesst? Ach, keene Spur. Hier heessen drei Viertel von allen Leuten Hollmann oder Liebich. Wu sull’n ooch immer die neuen Namen herkummen!“
Wenzel Hollmann, ein geschmeidiger Mann in knapper österreichischer Uniform, setzte sich zu uns und trank drei oder vier Gläschen Wünschelburger Kornbranntwein. Seine Dienstkappe legte er neben sich auf die Bank. Es stak ein winziges Sträusschen daran.
„Immer hat a a Pukettela) an der Mütze,“ sagte der Hahnenwirt; „’s is halt a schneidiger Kerl.“
„Na, du weisst doch, dass mir das immer die Kinder vom „Blauen Hahnen“ dranmachen. Und du putzest mich ja selber oft aus,“ entgegnete der Grenzer.
Der Rote Hahnenwirt lachte aus vollem Halse.
„Ja, denkst du, der Rote steht gegen den Blauen zurücke? Putzt der Blaue seine Kunden, putzt der Rote erst recht seine Kunden.“
Er entfernte das Sträusschen, das aus drei Stengelchen Rosmarin und einem gelben Hahnenfuss bestand, brach vom Gartenzaun zwei Heckenröslein, pflückte vom Beet eine rote Nelke und befestigte sie an der Kappe des Grenzers.
„Der Rote Hahn lässt sich von der Konkurrenz nischt vormachen,“ sagte er.
Der Grenzer lächelte ein wenig geschmeichelt und ging bald darauf davon.
Der Hahnenwirt lachte leise hinter ihm her. Dann sagte er:
„Na, Jüngla — junger Herr — ich sollt’s ja eegentlich nich verraten, aber Se werden ja nischt ausmähren — Se haben selbst schon geschmuggelt — na, und da soll’n Se gleich amal a rechtes Schmugglerstückel zu seh’n kriegen. Wissen Sie, was das bedeutet?“
Er nahm die Rosmarinstengel und den Hahnenfuss auf, die der Grenzer dagelassen hatte.
„Also, passen Se auf. Das, was ich hier in der Hand hab, is ’ne Geschäftsbestellung. Und zwar eene vom Blauen Hahnenwirt drüben. Der Hahnenfuss bedeutet a Fass Butter, und die Rosmarinstengel bedeuten drei Pfund Schokolade. Die soll ich nu nach drüben liefern.“
„Und das bringt der Grenzer?“ rief ich überrascht.
„Jawull, der Grenzer! Der is der zuverlässigste Bote. Der tumme Kerl hat natürlich keene Ahnung, dass a unsern Briefträger macht. Ich hab’, wie Se gesehen haben, gleich meine Gegenbestellung beim Blauen Hahn gemacht: eine rote Nelke, das is a Fässel Roter, und zwee Heckenröslein, die bedeuten zwee Flaschen gezehrten Oberungar. Das trägt a nu wieder rüber, denn a pendelt immer zwischen uns beeden hin und her.“
„Das ist grossartig ausgedacht!“ rief ich begeistert.
„Ja, Kupp muss ma haben,“ sagte der Hahnenwirt stolz. „Wir haben ’ne ganze Liste ausgearbeit’. Klee z. B. bedeutet Slibowitz, Jelängerjelieber bedeutet Virginiazigarren, fette Henne versinnbildlicht ’ne Tonne ungarisches Schweineschmalz, Flachs is natürlich Leinwand, Männertreu sind Hosenträger, Rosen Stoff für seid’ne Blusen und ’ne kleine Distel is ’n Sack Salz. Eine volle Getreideähre heisst: Ich bitte um die Rechnung; eine leere Ähre aber bedeutet: Wart’ noch a bissel, hab’ jetzt gerade keen Geld.“
„Es ist genial,“ flüsterte ich voll Bewunderung.
„Ja, junger Herr,“ sagte der Hahnenwirt, „wenn Se immer hier wären, könnten Se noch a ganz gescheiter Kerle werden.“ —
„Der Wenzel Hollmann scheint mir grade kein sehr tüchtiger Grenzjäger zu sein,“ wandte ich nach einer Weile ein.
„Der — nich tüchtig? Oho! Ein Satan is a. Unsere Preussen sind viel langsamer, se haben zu dicke Bierbäuche, aber der dürre Windhund von Österreicher, der geht Tag und Nacht rum und hat beinah schon die ganze Gegend erwischt.“
„Hat er Sie auch schon einmal erwischt?“ fragte ich.
„Mich? Ich bin keen Schmuggler,“ brauste er wieder auf; doch dann setzte er hinzu: „Unsere Leute, ich meine die, die so die Waren zwischen mir und meinem Blauen Kollegen drüben hin- und herschaffen, die hat er freilich schon ziemlich ofte erwischt — der Lump der!“
Er schnob vor Ingrimm.
„Dreimal mehr Strafe haben wir schon blechen müssen, als der ganze Handel einbringt. Aber Geschäft is Geschäft. Blödsinnig müsst’ ma sein, wenn ma nich schwärzte. Und geleimt wird a doch! Das haben Sie ja gesehen, wie a geleimt wird! So a Spass schwemmt ollen Ärger weg. Der grösste Hauptkerl aber, den a noch nie erwischt hat, das is der Wassermüller Liebich unten in a Talhäusern. Das is so a Mordsteufelskerl, der würd’ nicht erwischt, und wenn der deutsche und der österreichische Kaiser selber uff die Grenzwache zögen.“
Nach diesem starken rednerischen Trumpf rieb sich Heinrich Hollmann vergnügt die Hände.
„Das Dollste is,“ fuhr er fort und er lachte mit so tiefem Vergnügen, dass man merkte, wie die Freude aus dem untersten Herzen kam; „das Dollste is, dass der Liebich dem Wenzel Hollmann die eegne Liebste weggeschmuggelt hat. Das verwindet der Windhund sein Lebtag nich.“
„Möchten Sie mir das erzählen?“
Er schielte mich von der Seite her an.
„Für Liebesgeschichten biste noch a bissel zu grün,“ sagte er. Aber er erzählte, und erzählte zum Teil hochdeutsch.
„Also — da war a Mädel drüben — Franziska — ’s hübscheste Mädel im ganzen Gebirge. Alle war’n in se verschossen — alle — alle ohne Ausnahme, hüben wie drüben. Am dollsten aber waren der Grenzjäger Wenzel und der Wassermüller Liebich in die Franziska verliebt. Also, die beiden waren schon total verrückt um die Köppe. Je mehr se nu aber auf das Mädel spannten, desto mehr hatten se natürlich uff einander ’ne grenzenlose Wut. Wenn se sich bloss sahen, wurden sie grün im Gesichte. Am schlimmsten war’s natürlich uff’m Tanzboden. Da wundert man sich noch heute, dass da nich amal a Unglück geschehen is. Se überboten sich, wo se konnten. Hatte der Wenzel ’ne neue Extrauniform, kaufte sich der Liebich ’n neuen schwarzen Anzug, ’n Patent-Gummikragen und bunte Manschetten; wie sich der Wenzel in eener Auktion ’n Zwicker gekauft hatte, durch den a zwar nich sehen konnte, in dem a aber sehr studiert aussah, schaffte sich der Liebich ’ne Meerschaumspitze an, obwohl ihm jedesmal schlecht wurde, wenn a roochte. Der Wenzel machte Schulden über Schulden und koofte der Franziska in eenem Jahre alleine sieben Granatbroschen; der Liebich schenkte ihr ’n goldnen Fingerring mit ei’m Garantieschein, dass a binnen drei Jahren nich schwarz würde. Und so gings weiter, es waren eben, wie gesagt, ganz verrückte Kavaliere. Da versuchte es der Wenzel mit was anderem. A schmiss sich so heftig uff seine Berufsarbeit, dass a binnen kurzem neun Schmuggler erwischte und ’ne schriftliche Belobigung kriegte. Damit hob a sich nu bei der Franziska ein, denn das is wahr: nischt gefällt ei’m Mädel an ei’m Kerl besser, als wenn a Schneid hat. Das is, weil die Weiber selber su feiges Gelichter sind. Also, der Liebich fängt schon an, mitsamt seiner Meerschaumspitze sachte hinten runterzurutschen — da wird a plötzlich a Schmuggler. A bringt der Franziska allerhand feine Geschenke, mal ’ne kleine Tonne grüne Heringe, mal ’n Biertelzentner Viehsalz, und a sagt immer dazu, dass a am liebsten in Wenzels Amtsstunden schmuggelte, weil das der dämlichste Grenzjäger von ganz Österreich wäre Der Wenzel wurde halb verrückt vor Wut. A schlief nich mehr, a lag Tag und Nacht uff der Lauer, a sass amal von Mitternacht bis Morgens uff eenem Baume in strömendem Regen, und wie’s endlich Tag wurde, hatte ihm der Liebich, ohne dass er was gemerkt hätte, ’n Flasche Pain-Expeller unter den Baum gestellt, weil Pain-Expeller gutt is gegen Rheumatismus. Das ganze Gebirge lachte, und wie der Wenzel mit seinem Belobigungsbriefe und eener seid’nen Schürze das nächste Mal zur Franziska kam, merkte er, dass es Essig war. Sie hatte sich für a preissischen Liebich entschieden. Aber ihre Mutter war für a österreich’schen Wenzel. Und da setzte es der Wenzel durch, dass a, wie ich amal ’ne Entenkirmis mit Ball machte, mit der Franziska über die Grenze rüberkommen konnte. A hatte sich für schweres Geld ’nen geschlossenen Glaswagen gemietet. Weil sich’s nu aber nich schickte, dass a bei dem Mädel im Wagen sass, setzt’ a sich manierlich neben a Kutscher, und im Wagen sass die böhmische Jungfer. Wie se ans deutsche Zollhaus kamen, war’s schon dunkel, denn es war im späten November. Der Wenzel stieg ab und sagte der Jungfer im Wagen, er hätte vier österreichische Zigarren zu verzollen. Damit wollt’ a zeigen, was für a gewissenhafter Mensch er wär’, und sich bei der Franziska einheben. Wie er aus’m Zollhaus wieder rauskommt, setzt’ a sich gleich wieder auf’n Bock, und die Fahrt ging weiter. Herr, du meine Güte, wie se hier im „Roten Hahn“ ankamen, sass in dem Wagen ’ne Strohpuppe, und die Franziska war verschwunden. Die tanzte drüben mit ’m Liebich bei der österreichischen Konkurrenz. Der Kutscher, der mit ’m Liebich im Komplott gewesen war, kriegte zwar vom Wenzel a paar gesalzene Ohrfeigen, aber — mit der Franziska war’s aus. Sechs Wochen drauf heirat’ se a Liebich. Kurz vorher hatte se von den sieben Granatbroschen zweie an a Wenzel zurückgeschickt. Su sein die Weiber.“
Der Rote Hahnenwirt machte eine Pause in seiner Erzählung, zündete sich die Zigarre neu an und lachte leise und philosophisch vor sich hin.
„Su sein die Weiber!“ wiederholte er. „Mir is es ooch erst mit der Fünften geglückt. Und fünf is für mich ’ne Unglückszahl.“
Er liess wehmütig den Kopf hängen; aber bald lachte er wieder und erzählte weiter.
„Der Liebich trieb’s nu ganz toll. Kurz vor seiner Hochzeit erzählte er in Wenzels Gegenwart im Gasthause, seine Schwiegermutter müsse doch jetzt Kuchen backen, und da wolle er ihr ein Fass Butter aus dem Preussischen hinüberschaffen. Das war nu der Gipfel der Frechheit. Wenzel, der Grenzjäger, der sowieso mit verglasten Augen und hohlen Backen rumlief, lauerte von nun an Tag und Nacht. Zwar mit der Franziska war er fertig; aber den Kerl — den Lump — den Teufel — reinzulegen, das wär’ für ihn das allerhöchste gewesen. Und richtig — a erwischt ihn. In der Silvesternacht — ’s war ’n Hundewetter — erwischt der Wenzel a Liebich uff eenem entlegenen Seitenwege mit ei’m Fass Butter. Aus einem Graben, direkt aus der Schneejauche heraus springt er ihn an.
„Wo is der Zollschein?“ schreit er.
Liebich, der sonst ein starker Kerl ist, is so erschrocken, dass a lallt und stammelt wie a Kind. — „Ich hab’ — ich hab’ — die Putter — die Putter — verzollt —“
Er sucht in allen Taschen.
„Wo ist der Zollschein?“
Liebich dreht alle Taschen um, immer wieder, immer wieder — er sucht wie verrückt nach ’m Scheine.
„Ich — ich hab’n verloren —“
Wenzel lachte hämisch.
„Wenzel, mach’ mich nich unglücklich!“
Liebich sinkt geknickt auf seine Karre. „Hab’ Erbarmen, Wenzel, lass mich laufen —“
„Marsch, nach dem Zollamt!“
„Hab’ Erbarmen, Wenzel —“
„Nichts da! Vorwärts marsch, oder —“
Wenzel, denk’ an de Franziska — mach se nich unglücklich wegen den paar Pfund Putter —“
„Vorwärts! Die Karre aufnehmen und — marsch vor mir her. Bei Fluchtversuch kriegst ’ne blaue Bohne zwischen die Rippen!“
„Erbarm dich, Wenzel — erbarm dich über mich und de Franziska —“
Der Grenzer hebt das Gewehr. Da nimmt der Liebich die Karre auf. Aber er lässt sie wieder fallen. Es wird ihm schlecht — er muss sich hinsetzen — alle Glieder zittern ihm — es würgt ihn —
„Ich glaub’ — mich hat — hat der Schlag gerührt — mir is so schlecht!“
Liebich is kaum imstande, sich wieder aufzurichten. Den schweren Schubkarren zu stossen, is ihm ganz unmöglich. Er fasst immer nach ’m Herzen. So muss der Grenzer schliesslich selber zugreifen. Er schiebt den Karren, und Liebich muss drei Schritt vor ihm her gehen. Wollte er ausreissen, wär’s sein Tod. So geht’s den steilen Berg hinauf. Der Weg is glitschig; das Wetter is schauderhaft — Wind und Regen schlagen den beiden ins Gesicht. Der Grenzer schwitzt und kann’s kaum noch ermachen. Aber er muss den Karren schieben, denn der Liebich is ganz hin. Taumelig geht er vor ihm her. Immer wieder mal sagt er:
„Wenzel, ich bitt’ dir alles ab, was ich dir angetan hab’ — aber lass mich laufen — tu’s uns nich an!“
Der andere hört nicht darauf.
Und nu kommt’s.
Wie sie den Berg rauf sind, bis zur Chaussee und nich mehr weit zum Zollhause haben, greift der Liebich uff eenmal in de Westentasche und sagt ganz gemütlich: „Na, da hab’ ich ihn ja!“
Und a bringt einen richtigen Zollschein raus. A hatte die Putter richtig verzollt. Der Grenzer, der kaum noch schnaufen kann, steht wie versteinert vor ihm, und Liebich lacht und sagt:
„Ich dank’ Dir ooch, Wenzel, dass du mir die schwere Karre auf ’n Berg geschoben hast. Bist halt doch ein gutter Kerl, Wenzel! Von der Putter back’ wir nu Hochzeitskuchen. Sollst ’n Stickel davon kriegen.“
Der andere is nu nahe am Ersticken gewest, aber der Liebich hat gemeint:
„Ich hab’ dir’s doch von vornherein gesagt, dass ich die Putter verzollt hatte. Und wenn ich dir was sag’, kannste es doch glauben.“
Hat die Achseln gezuckt, is plötzlich wieder ganz bei Kräften gewest und hat seinen Karren auf der Chaussee gemütlich weitergefahren. Und der Wenzel hat sich an einen Baum anhalten müssen und hat laut geheult vor Wut und Scham, wie ihn der andere geäfft hat. A hat mir amal erzählt, a hätt’ ihn totschiessen wollen, aber der liebe Gott hätte ihn vor der Sünde bewahrt. Aber er hat ’n tödlichen Hass uff a Liebich, und das nehm’ ich ihm ooch nich übel.“
Soweit ging die Erzählung des Roten Hahnenwirtes.
Es war unterdes dunkel geworden, und wir gingen schlafen. Von meiner Giebelstube aus sah ich noch ein wenig hinaus auf die dunklen Waldberge. Wer weiss, wo der Wenzel jetzt lag mit der Flinte im Arm und auf das menschliche Wild lauerte, das sich scheu und verstohlen durch die schwarzen Waldgänge schlich und auf jeden Laut lauschte, auf jedes Zeichen Obacht gab, das ein nahes Verderben anzeigen konnte. Und wie ich noch so hinaussah, passierte ein Schmugglerstück dicht vor meinen Augen.
Ein Mann mit einem Schubkarren tauchte aus dem Dunkel auf. Er klopfte leise an einen Fensterladen. Der Hahnenwirt kam aus dem Hause, spähte erst nach allen Seiten, verhandelte mit dem Mann im Flüsterton und belud dann seinen Karren mit einem Fass und einem kleinen Paket.
Der Hahnenfuss und die drei Stengel Rosmarin!
Das ging nun hinüber über die Grenze nach dem „Blauen Hahn“. Ich war so aufgeregt, dass ich noch nicht schlief, als die Wirtsstubenuhr unten die elfte Stunde klirrte. Nicht lange darauf klopfte es unten an die Tür. Ich fuhr rasch in die Kleider, denn wo hätte ich junger Bursch ein Geschehnis in dem alten Schmugglerhaus verpassen wollen. Ich schlich die Treppe hinab und duckte mich in einen Winkel. Hollmann kam mit einer Laterne angeschlürft und fragte, wer draussen sei.
„Liebich — der Wassermüller Liebich!“ antwortete eine tiefe Stimme.
Mir pochte das Herz. Der Müller Liebich, der war ja der berühmte Schmuggler, der Gegner Wenzels, des Grenzers.
Da öffnete der Wirt die Tür. Ein kräftiger Mann stand draussen.
„Nanu, Liebich, willst du was über die Grenze schaffen?“
„Ja,“ sagte der andere, und seine Stimme war ganz heiser.
„Meine —meine Frau will ich rüberschaffen.“
„Deine — Frau?“
Liebich lehnte sich an den Türpfosten.
„Sie is gestorben,“ sagte er tonlos. „Die Leiche will ich rüberschaffen. Da liegt sie.“
Er wies auf ein Wägelchen, das draussen im Dunkeln stand.
„Liebich,“ rief der Hahnenwirt, „du redst wohl irre? Du wirst doch mit sowas keen Allotria treiben!“
„Komm raus,“ sagte der andere. Der Hahnenwirt ging hinaus, und ich folgte, ohne dass mich jemand bemerkte. Liebich hob eine Decke von dem Wägelchen auf. Darunter stand ein Sarg. Tiefinnerlicher Schmerz schüttelte den Mann so, und er weinte so stossweise, so bitterlich, dass der ganze furchtbare Ernst klar war.
„Wann — wann is se denn —“
„Vorgestern. Wir haben das erste Kind gekriegt. Nach sechs Jahren. Das Kind lebt — die Franziska is tot.“
„Und nu willst du sie rüberschaffen? Nach Hause?“
„Ja, sie wollte drüben begraben werden.“
„Und warum bringst du sie denn in der Nacht?“
„’s macht sonst zu viel Schererei, wenn man eine Leiche über die Grenze haben will. Is se aber erst amal drüben, wird se auch drüben begraben.“
Liebich wollte die Leiche seiner Frau über die Grenze schmuggeln. Er konnte wohl gar nicht anders; sein ganzes Denken war so eingerichtet, dass ihm ein Verhandeln mit Grenzbehörden ganz ausgeschlossen schien. Müde setzte er sich auf die Bank, auf der ich vorhin mit Hollmann gesessen hatte.
„Ich wollt’s alleine schaffen,“ sagte er, „aber ich kann nich. Die Kräfte verlassen mich.“
Was er dem Feinde gegenüber früher einmal geheuchelt hatte, war jetzt bitterster Ernst geworden.
„Du musst mir helfen, Hollmann; ich ermach’s nich alleine.“
Der Gastwirt erholte sich von seiner Bestürzung; dann versprach er, dem Freunde zu helfen. Jetzt erblickte er auch mich und schnob mich wohl erst zornig an; aber nach einigem Hin und Her erlaubte er mir sogar, mich dem kleinen traurigen Zug anzuschliessen.
Die Leiche einer jungen Frau und Mutter auf einem kleinen wackeligen Wägelchen, vorn an der Deichsel der leise schluchzende Mann, hinten, den Karren schiebend, Hollmann und ich, so ging es langsam den Bergweg hinauf. Ein müder Nachtwind surrte durch die Bäume, ein feiner Regen rieselte vom Himmel. Was war das für eine traurige Fahrt! Und doch pochte mir das Herz in ungewohnten Schauern, und die Wangen brannten mir viel mehr von der Aufregung als von der Anstrengung.
Bei einer Wegbiegung blieben die Männer halten und lugten nach der Höhe. Ein Licht brannte dort oben, wohl in dem Häuslein irgend eines Webers oder kleinen Bauern.
„Die Strasse ist sicher!“ sagte Hollmann; denn das Licht war ein Signal für die Schmuggler, dass kein Grenzer auf dem Wege war, es war wie ein Leuchtturm für die Gefährdeten unten im dunklen Waldmeer.
Liebich legte sich mit dem ganzen Oberkörper auf den Sarg und fing wieder an zu weinen. Er presste den Kopf an das harte Holz, das sein Liebstes umschloss, er küsste den Sarg, er umklammerte ihn mit den Armen.
Es dauerte eine geraume Weile, ehe wir wieder weiterfuhren. Den Zollhäusern wichen wir auf einem Nebenwege aus. Als wir aber jenseits der böhmischen Station waren, erlosch plötzlich das Licht am Berge.
Die Männer blieben stehen und lauschten.
Wir waren in Gefahr.
„Vorsicht!“
Wir hielten an. Liebich schnaufte tief und grimmig auf.
„Nich amal die Toten lassen se ihres Weges ziehen!“
Dann legte er den Finger an die Lippen. Das Wägelchen mit dem Sarge stand ganz am Rande der Strasse. Liebich drückte sich an einen Baum, und Hollmann zog mich leise hinter den Sarg. Dort kauerten wir uns nieder.
Minuten vergingen. Sacht und fein rieselte der Regen. Die Berglehne stieg schwarz gegen den Nachthimmel empor. Mich fror. Da huschte Liebich unhörbar die Strasse entlang auf eine Brücke zu. Ich sah, wie er darunter verschwand.
„Was macht er?“ fragte ich kaum hörbar.
„Ruhig!“ brummte der Gastwirt ziemlich laut. „A sucht die Brücke und a Graben ab. Da stecken se meist — und nu nich immerfort reden, sonst —“
„Halt!“
Wie aus der Erde herausgeschossen, stand ein Mann vor uns.
Wenzel Hollmann — der Grenzjäger war es. Er hatte die Flinte unter dem Arm.
„Halt! — Wer seid Ihr?“
Er trat näher.
„Der Hahnenwirt,“ sagte er betroffen. „Was machen Sie hier? Was ist das für ein Sarg?“
Der Wirt war fürchterlich erschrocken, aber er wollte sich’s nicht merken lassen und sagte in schwerem Missmut:
„Wenzel. Sie kennen mich! Sie wissen, dass ich der ehrlichste Mann im ganzen Gebirge bin, der noch nie daran gedacht hat, das Allergeringste zu schmuggeln. Also, lassen Se mich in Ruhe und gehen Se Ihres Weges.“
„Was ist das für ein Sarg?“ wiederholte der Grenzjäger statt aller Antwort seine Frage. Er trat heran und wollte die Decke, die nur das Kopfende des Sarges freiliess, entfernen.
Da kam ein gurgelnder Laut von der Brücke her.
„Lass den Sarg stehen! Geh weg vom Sarg, du verfluchter Spürhund!“
Liebich raste heran.
„Ich schlag’ dich tot, wenn du den Sarg anrührst!“
„Was ist mit dem Sarge?“ fragte der Grenzer mit eiskalter Stimme.
„Das geht dich nichts an!“
„Was ist in dem Sarge?“
Der Grenzer hob die Flinte. Da mengte sich der Gastwirt ein.
„Schiess nicht, Wenzel — Liebichs Frau liegt in dem Sarg — die Franziska —“
Der Grenzer liess die Flinte sinken.
„Die Franziska?“ fragte er betroffen. „Ist sie gestorben?“
„Es geht dich nichts an,“ brummte Liebich.
Da fing der Grenzjäger jäh an zu lachen.
„Oho, Brüderlein, es geht mich wohl was an. Es geht mich sehr viel an. Ein neuer Sarg ist auch steuerpflichtige, und ausserdem — deine Frau liegt nicht in dem Sarg!“
„Nicht in dem Sarg?“ wiederholte der Hahnenwirt verwundert. Auch ich machte grosse Augen.
„Es ist einer von den ekelhaftesten Schmugglertricks,“ fuhr der Grenzer fort, „einen Sarg zu benutzen, um Waren zu schwärzen. Da hat man keinen Respekt vor Leben und Tod, keinen Respekt vor dem Kreuze, das auf dem Sarg ist. Gotteslästerlich ist das — pfui, Hollmann, Ihnen hätte ich das nicht zugetraut. Alle drei sind meine Arrestanten!“
Mir wurde übel. Als Zögling einer Königlich Preussischen Lehranstalt hier unter so abenteuerlichen Verhältnissen verhaftet zu werden, musste von den traurigsten Folgen für mich sein. Auch der Hahnenwirt neben mir zitterte.
„Ich hab’s nicht gewusst,“ sagte er. „Ich hab’ ihm geglaubt —“
Der Grenzer lachte spöttisch.
„Reden Sie nicht — Sie kennen doch den Liebich — Sie werden schon gewusst haben, dass in dem Sarg wahrscheinlich was ganz anderes steckt, als eine Leiche.“
Er trat wieder an den Sarg heran und hob die Decke.
„Rühr’ den Sarg nicht an,“ brüllte Liebich, „oder ich vergreif’ mich an dir!“
Die Augen standen ihm heraus.
„Also marsch zum Amt! Da wird sich ja herausstellen, was in dem Sarg ist. Angefasst und vorwärts marsch!“
„Bei unserer alten Freundschaft —“ fiel Hollmann in bittendem Tone ein.
„Damit ist’s aus,“ entgegnete der Grenzer in barschem Tone. „’s ist eine gotteslästerliche Schuftigkeit so was!“
Ich gab ihm im stillen recht und bereute aufs bitterste, mich in den bösen Handel eingelassen zu haben. Dicke Tränen rollten mir über die Backen, während ich das Wägelchen mit dem Sarge schieben half und der Grenzjäger mit der scharfgeladenen Flinte hinter uns herschritt. Mühsam ging es einen Berg hinauf. Es hatte aufgehört zu regnen, und der späte Mond war klar aus den Wolken getreten. Niemand sprach ein Wort; nur das schwere Ächzen Liebichs war vernehmbar. Das Wägelchen stiess auf dem harten Wege, und der Sarg schwankte hin und her.
So erreichten wir die Anhöhe. Die Strasse ging nun ziemlich steil bergab. Und plötzlich riss uns Liebich den Wagen aus der Hand und sauste mit dem Gefährt wie ein Rasender den Berg hinab.
Ein scharfer Schuss. Wir schrieen auf. Liebich brach zusammen. Das Wäglein fuhr mit den Vorderrädern schwankend über ihn hinweg und blieb stehen. Selbst mehr tot als lebendig, rannte ich mit den anderen der Unheilstätte zu. Wenzel und der Wirt zogen Liebich unter dem Wagen hervor. Er war bewusstlos. Die Kugel war ihm rücklings in die linke Schulter gedrungen.
Sie legten ihn an den Wegrand.
„Er hat’s nich anders haben gewollt,“ sagte der Grenzer. „Es ist gotteslästerlich so was!“
Still war’s — ganz still. Aber die Herzen hämmerten.
Da trat der Hahnenwirt an das Wäglein und riss die Decke herunter. Ein brauner Sarg mit weissen Beschlägen und einem geschnitzten Kreuz wurde sichtbar. Vier Schrauben verschlossen ihn. Mit zitternden Fingern machte sich der Hahnenwirt daran, die Schrauben zu lösen. Der Grenzer sah ihm erst finster zu, dann half er, und die beiden Männer hoben den Deckel.
Sie liessen ihn mit einem Schrei zur Erde sinken. In dem Sarge lag eine tote Frau. Sie war in einem weissen Kleid, und ein blonder Kopf von rührender Schönheit lag auf einem seidenen Kissen.
„Es ist wahr gewest,“ stammelte der Hahnenwirt — „es ist wahr gewest!“
Der Grenzer starrte auf die Leiche, die vom Mondlicht beschienen vor ihm lag, ein wehes Lächeln um den blühenden Mund.
„Franziska!“
Der Grenzer stammelte unverständliche Worte und sank plötzlich mit einem markerschütternden Weinen neben dem Sarg nieder. Nie wieder habe ich einen Mann so laut und weh weinen gehört.
Da rührte es sich am Wegrande. Liebich kam zu sich, sah wirr und wild um sich, wusste plötzlich alles, was sich zugetragen, sah den geöffneten Sarg und hörte den anderen schluchzen.
„Geh weg — weg — du Hund — ich — ich schlage dich tot!“
Er sank in die Ohnmacht zurück. Der Grenzer kniete immer noch auf der Strasse. Er presste den Kopf an das Holz des Sarges und sprach wirre Worte durcheinander, Worte, die um Verzeihung flehten, Gebetsworte, zärtliche Worte innigster Liebe. Der Hahnenwirt stand mit gefalteten Händen da, unfähig, etwas zu tun, und mir jungen Burschen war das Herz voll Furcht und Grauen. Endlich rafften wir uns zusammen, schlossen den Sarg wieder und deckten ihn wieder zu. Was wir zuerst hätten tun müssen, darauf kamen wir zuletzt — wir sahen endlich nach dem Verwundeten. Er erwachte und schrie furchtbar auf, als wir den Arm an der zerschossenen Schulter berührten.
Zum Dorf war es glücklicherweise nicht weit. Wir wollten anfangs Liebich mit auf das Wägelchen laden, aber es war zu schmal, er hatte neben dem Sarge nicht Platz.
Wenzel, der Grenzjäger, kam wieder heran. In tiefster Niedergeschlagenheit sagte er:
„Liebich, verzeih mir’s, dass ich dich diesmal in falschem Verdacht hatte.“
Da kam etwas von dem alten herben Humor in Liebichs Seele zurück, und er sagte:
„Du denkst immer falsch; du weisst nie, was los is!“
Nach dem Dorfe hinunter mussten wir. Es zeigte sich, dass sich Liebich wohl aufrichten, aber nicht allein gehen konnte. Er musste gestützt werden.
„Stützt ihn,“ sagte der Grenzer; „ich werde den Wagen ziehen.“
„Geh von der Leiche weg,“ befahl da Liebich; „rühr’ sie nicht an!“
Noch über den Tod hinaus reichte die glühende Eifersucht. Also kam es so, dass der Hahnenwirt und ich das Wäglein zogen und Liebich, auf den Todfeind gestützt, hinterher schwanken musste.
Es war tief in der Nacht, schon gegen Morgen hin, als wir mit unserer traurigen Last an Franziskas Heimathaus anlangten und eine alte Frau der tot heimkehrenden Tochter unter tausend Tränen die Tür öffnete.
Am übernächsten Tage wurde die Franziska auf dem heimatlichen Kirchhof begraben. In aller Herrgottsfrühe war die Beerdigung. Liebich konnte ihr nicht beiwohnen; er lag krank zu Bette. Der Schmerz hatte ihn aber doch so weich gemacht, dass er sich mit seinem alten Gegner Wenzel versöhnt hatte. Trotz dieser Aussöhnung erlaubte er aber nicht, dass Wenzel mit der Franziska zu Grabe ging.
Und der war doch dabei. Er stand auf einem Berge, von da man den Friedhof übersehen konnte, hörte die Glocken läuten, hörte die Lieder klingen und sah, wie auf weissen Grabtüchern etwas Liebes, Liebes in die Tiefe sank.
Damit wäre nun eigentlich diese Erzählung aus. Aber da es sich darin nicht bloss um die Liebesgeschichte der schönen Franziska aus dem Böhmerland, sondern um das Leben in den Grenzhäusern überhaupt handelt, will ich noch erzählen, wie ich in späteren Jahren zu meinem Freunde Heinrich Hollmann, Wirt zum „Roten Hahnen“, zurückgekommen bin.
Er blieb immer der Alte, immer der redselige, etwas grosssprecherische Mann mit der gleichen Respektlosigkeit vor allen Dingen und Personen seiner Umgebung und dem gleichen absoluten Respekt vor seiner Frau. Weber und kleine Bauern gingen in seinem Hahnenwirtshaus ein und aus, und wenn ich diese wortkargen Leute mit den blauen, leeren Augen hinter ihren Branntweingläschen sitzen sah, wusste ich wohl, warum sie schmuggelten. Beileibe nicht nur um des bisschen Erwerbes willen, wie ja auch der Wildschütz nicht nur um eines lumpigen Talerhasens allein Ehre und Freiheit, ja vielleicht Gesundheit und Leben in die Schanze schlägt.
Ihr Herren, die ihr zu Gericht sitzet, denkt nur an die kleinen niederen Stuben dieser Armen, an ihre eintönige, langweilige Arbeit, die Stunde um Stunde Jahr um Jahr, ein ganzes Menschenleben dieselbe trostlose Last ist. Und denkt daran, dass auch diese Menschen eine Seele haben, die nach Tat und Abwechselung, Freude und Gefahr lechzt, dass auch diese Sehnsucht nach grünen Wegen der Romantik sucht. Was tun sie? Sie schmuggeln, sie wildern wohl auch. Und in all der langen Zeit, da sie hinter dem Webstuhl im engen Käfig sitzen, geht ihre Phantasie auf einsamen Schleichwegen zwischen Gefahr und lohnendem Sieg. Kommt nun einer der Ihrigen, erzählt er von irgend einergelungenen Tat, dann tritt Leben in die leeren Augen, dann geht das träge Herz mal eine Stunde lang schneller, dann steigt’s in müden Leibern auf wie Trotz und Kraft. Was bietet ihnen auch der Staat? Wieviel vom allgemeinen Erbe lässt er ihnen zukommen, und wie gross ist die Schädigung, die sie hinwiederum ihm zufügen? Mögt Ihr es entscheiden; ich tue es nicht.
Vom Liebich-Müller erzählte mir der Hahnenwirt, dass er nicht mehr schmuggele. Die Fahrt mit dem Sarge war sein letztes unerlaubtes Überschreiten der österreichischen Grenze. Es machte dem Müller keinen Spass mehr, zu schmuggeln. Denn die Franziska war tot, vor der er den Nebenbuhler lächerlich machen konnte. Mit dem Wenzel vertrug er sich, wenn er ihn traf. Er gab jetzt sogar zu, dass der Wenzel gewissermassen auch ein wenig im Rechte sei; denn wenn er, der Liebich, Grenzer wäre, gäbe es überhaupt keine Schmuggler mehr, sondern alle sässen auf Nummer Sicher. Da stimmte ihm dann der Hahnenwirt biedermännisch bei.
Eines aber brachte dem Müller grosse Genugtuung. Etwa zwei Jahre nach Franziskas Tode heiratete Wenzel ein braves Mädchen aus dem gleichen böhmischen Dorf. Da hat Liebich, als Wenzel mit seiner Braut zur Kirche ging, bei Franziskas Grab gestanden und hineingesagt:
„Weisste, Franzel, was der Wenzel macht? Hochzeit macht a. Mit der Nitsche Hedwig, dem albernen Ding. Da haste den Kerl! Was hab’ ich dir immer gesagt? A Windhund is a. Ohne eene Spur von Treue. Da wirst du ja jetzt froh sein, dass du mich genommen hast, denn ich hätte nie eene andre als dich genommen, nie!“
Liebich nahm wirklich keine zweite Frau. Er widmete sich nur mit grosser Liebe der Erziehung seines kleinen Sohnes. — — —
Über seine eigenen Schmugglererfolge wusste der Hahnenwirt nicht viel Erfreuliches zu berichten. Eines Abends, als Wenzel wieder einmal bei ihm eingekehrt war, steckte er ihm ein Lindenblatt an den Hut.
„Ah, gilt die alte Korrespondenz immer noch?““ fragte ich.
„Nu natürlich! Sie roochen doch so gerne Regalia media, und ich hab’ keene im Hause. Nu — Lindenbaum bedeutet eben Regalia media.“
Am nächsten Tage wurde wirklich vom Blauen Hahnenwirt drüben eine Kiste Regalia media über die Grenze geschafft.
Aber Hollmann war trotzdem unzufrieden.
„Wenzel hat meine Leute greulich oft erwischt,“ sagte er niedergeschlagen. „Ich kann sagen, es kost’ mich schon a Vermögen an Strafe. A paar von meinen Leuten haben sogar sitzen müssen. Na, das kost’ dann erst recht viel. Der Kaiser hat nich so teure Hosen an wie su a Gebirgsweber, wenn a für unsereinen amal a Paar durchsitzen muss. Aber geschmuggelt muss sein; denn wer hier in der Gegend nich schmuggelt, is blödsinnig. Und geleimt wird a doch, das haben Se ja geseh’n, wie a geleimt wird.“
Es vergingen wieder viele, viele Jahre. An mich kam die Vierzig heran, und mein Freund Hollmann hatte den Kopf voll weisser Haare, als ich ihn wieder traf. Verändert hatte sich aber sonst in den Grenzhäusern so gut wie nichts. Es ist mit dem Leben umgekehrt wie mit einer Drehscheibe: im Zentrum rast es am schnellsten, an der Peripherie scheint es still zu stehen.
Ja, und doch hatte sich Neues und Grosses in den Grenzhäusern ereignet. Des Wassermüllers Sohn Wilhelm war so herangewachsen, dass er schon seine Zeit bei den Hirschberger Jägern abgedient hatte, und der österreichische Zollbeamte Wenzel Hollmann hatte ein Töchterlein, das eine recht frische Bergwaldsblume war. Es war die alte Geschichte: die beiden Kinder liebten sich, und die beiden Väter wollten von dieser Liebe nichts wissen, da sie ihnen ganz gegen das Herz war, wenn sie sich auch äusserlich vertrugen. Den Müller schmerzte oft die halblahme Schulter, die er dem Grenzer zu verdanken hatte, und dieser hatte auch keinen Grund, mit dem Müller recht intim zu werden. So taten die beiden Alten das Dümmste, was sie junger, starker Liebe gegenüber tun konnten: sie sperrten sich dagegen. Dass das gar keinen Zweck hatte, ist unnötig zu erwähnen. Die Grenze hinüber und herüber wurde schönes, goldenes Liebesgut geschmuggelt: Briefe und Küsse, Blumen und Tränen. Und ging es gar nicht anders, so schlich der Mond, der älteste Schmuggler der Welt, hinter Wassermüllers Wald herum, nahm tausend Liebesgedanken als unerlaubtes Gut, stieg über die Berge, leuchtete dem dummen Grenzer, der unten auf dem Wege stand, dreist ins Flintenrohr und lieferte sein süsses Schmugglergut an des Töchterleins Kammerfensterab.
Schon gut; es ging, wie es halt fast immer geht: die beiden Alten musstennachgeben. Und da kam ein Tag, wo in der Wassermühle ein grosses, echtes Versöhnungsfest gefeiert und alles für die bevorstehende Hochzeit besprochen werden sollte. Gerade da war ich wieder einmal auf eine Woche im „Roten Hahnen“ einquartiert.
Eines Nachmittags war es, da fuhr ein Glaswagen beim Hahnen vor. Diesmal sass keine Strohpuppe darin und auch der Wenzel nicht beim Kutscher auf dem Bock, sondern stolz und feierlich neben seinem taufrischen Töchterlein. Gott, war das böhmische Mädel ein liebes Ding! Und der Wenzel — der war in Zivil. Hatte einen Zylinderhut aufs Haupt gestülpt, trug einen tadellosen Smoking und Lackschuhe mit Gamaschen. So fesch kann nur ein Österreicher aussehen. Langsam und feierlich kam er auf mich zu und reichte mir gerührt die Hand.
„Schauns — so kommt’s!“ sagte er. „Aber das freut mich, dass Sie gerade hier sind. Sie gehören ja gewissermassen dazu.“
Er legte seinen glänzenden Zylinder auf den Tisch und fuhr plötzlich zornig zurück.
„Verflucht — wer hat mir denn an meinen Zylinderhut eine Kornblume gesteckt? Ist das eine Frechheit!“
Der Rote Hahnenwirt kam heran, beguckte kopfschüttelnd die Blume und ging hinaus, wo er leise ein Fässchen Wünschelburger Kornbranntwein nach dem Blauen Hahnen in Auftrag gab.
Wenzel warf die Blume grimmig auf die Erde. Dann wurde er aber wieder feierrlch und erzählte mir, als ob er sich entschuldigen müsste, warum er nun doch seine Einwilligung zu dieser Hochzeit gäbe. Wäre der Liebich noch ein Schmuggler — niemals, nie! Aber der sei kein Schmuggler mehr, der sei nur noch ein alter Esel. Und so fahre er jetzt mit der Ursula hin, und es solle ein schönes Familienfest werden. Der Hahnenwirt und ich, wir müssten mitmachen, denn wir gehörten dazu. Der Blaue Hahnenwirt drüben habe gerade die Gicht; sonst hätte er ihn auch mitgebracht. Im Wagen sei Platz für uns.
Hollmann der Wirt musste nun Toilette machen und erschien endlich in einem viel zu engen Gehrock, der den Globus seines Bauches nur bis zu den Wendekreisen bedeckte. Wir nahmen mit im Wagen Platz, und die Fahrt ging hinab nach der Wassermühle.
Es ist für mich als Preussen schmerzlich zu sagen: aber mein Landsmann Liebich empfing seinen feierlich ausstaffierten Mit-Schwiegervater in Hemdsärmeln! Wenzel bemerkte es schon beizeiten und sagte leise zu mir:
„Nu sagen’s, wie konnte die Franziska an solchen Kerl nehmen, der nicht im geringsten an Schneid hat?“
Das Fest selbst aber wurde sehr, sehr schön. Junge Liebe und junges Glück zu sehen, ist freilich für den, der übers Leben schaut, eine wehmütige Freude, aber doch eine Freude voll schweren Erinnerungsduftes aus fernen Frühlingstagen.
Liebich war sehr schweigsam. Die Verlobung wurde vollzogen, und der Wein, den wir tranken, war alles österreichische Marke und wahrscheinlich geschmuggelt; aber Wenzel liess ihn sich schmecken, denn was ging es ihn an, wenn sich preussische Grenzer über den Löffel balbieren liessen? Ja, er trank viel und wir andern auch, und die Stimmung wurde sehr lustig. Da erhob sich der Müller zu einer Rede.
„Hier sitzen wir nu, und das is sehr schön. Dass die Franziska nich dabei is, is freilich sehr schade. Aber ich weiss, wo die is; das weiss ich schon durch meine lahme Achsel. Na, das is nu aber ja längst alles vollkommen vergessen, und die Kinder, die sich heiraten werden, haben das alles nich mit erlebt. Wozu reden wir also erst darüber? Und damit du siehst, Wenzel, wie gut ich’s mit dir meine, schenk’ ich dir hier eine echt silberne Tabaksdose, damit du immer an mich denkst, wenn du draus schnupfst. Das Brautpaar lebe, hurra — hoch!“
Aus blauem Florpapier wurde eine ganz prächtige silberne Dose enthüllt, die Liebich erst kurz zuvor in Breslau erstanden hatte. Wenzel war tiefgerührt. Es ärgerte ihn aber jetzt sehr, dass er kein Gegengeschenk hatte und nun in seinem Smoking gegen den Hemdärmelmann unvorteilhaft abstach. Als das reiche Abendbrot vorüber war und die Böhmen an die Heimkehr dachten, befahl der Müller seinem Sohne, nun auch ihr eigenes Wäglein zurechtzumachen; sie würden die lieben Gäste heimbegleiten, denn so ein Tag wie heut sei nicht oft.
Fröhlich ging es die Berge hinauf, der Grenze zu. Wir kamen ans österreichische Zollhaus. Ein Beamter trat heraus und fragte der Reihe nach jeden nach Steuerbarem. Wir verneinten alle, auch Wenzel, der Grenzer in Zivil, natürlich. Da sagte der Beamte, der (wie ich später erfuhr) auf seinen Kollegen nicht gut zu sprechen war:
„Es tut mir leid, Herr Wenzel Hollmann, aber es ist eine Anzeige eingelaufen, Sie brächten eine neue silberne Dose über die Grenze.“
Ein Schrei aus Wenzels Mund. Und schon flog ein Bündel blaues Florpapier auf die Strasse, und aus dem Papier heraus flog eine neue silberne Dose.
Wir glaubten alle, nun müsse die Welt untergehen. Wenzel, der gefürchtete Grenzer, das Muster von Gewissenhaftigkeit und unnachsichtlicher Strenge, war beim Schmuggeln ertappt worden.
Er stieg aus dem Wagen und klappte ganz zusammen. Gebrochen lehnte er sich mit seinem schönen Anzug an das sandige Rad, der Zylinder fiel ihm vom Kopfe.
„Ich — ich — hab’ — nicht dran gedacht,“ brachte er heiser heraus.
Der Beamte zuckte die Achsel.
„Es war meine Pflicht. Die Anzeige ist schriftlich gekommen.“
Er hob die Dose auf.
„Die muss ich natürlich konfiszieren. Bitt’ schön!“
Er wies mit der Hand auf die Tür des Zollhauses. Wie einen armen Schächer, der zum Schaffot getragen werden muss, schleppten der Hahnenwirt und ich den unglücklichen Wenzel ins Amtslokal.
Da mischte sich Liebich ein.
„Herr Kontrolleur,“ sagte er, „Sie wissen doch ganz genau, dass Herr Wenzel Hollmann nicht im Traume daran gedacht hat, absichtlich zu schmuggeln. Ein Beamter wie er — ich bitt’ Sie! Ich habe ihn mit dieser Dose überrascht, hab’ sie ihm geschenkt, und nu hat er eben nicht dran gedacht. Denken Sie etwa den ganzen Tag an Ihre Schnupftabakdose?“
„Es tut mir leid — die Anzeige ist schriftlich gekommen; vor dem Gesetz sind alle gleich.“
Die für Wenzel Hollmann masslos qualvollen Formalitäten wurden vollzogen. Er brachte kaum ein Ja oder Nein heraus. Totenblass sass er da. Der Müller erbot sich, alles zu zahlen, sowohl den Rückkaufspreis für die konfiszierte Dose, wie auch die ziemlich hohe Strafsumme.
Endlich konnten wir weiterfahren. Der Müllersohn setzte sich zu seinem gänzlich gebrochenen zukünftigen Schwiegervater, und ich bestieg das Wäglein Liebichs, der die Zügel führte. Als wir ein Stück gefahren waren, sagte der Müller kleinlaut:
„So is es! Erst macht’s einem einen Heidenspass, einen dummen Streich zu machen, und nachher kommen die Gewissensbisse.“
„Was haben Sie denn?“
„Was ich hab’? Ich hab’ — ich hab’ nämlich die Anzeige selber ins Zollamt geschickt.“
„Sie sind wohl nicht gescheit?“
„Nee, wahrscheinlich nich! Es kommt mir jetzt so vor, als ob ich ’ne richtige Tracht Prügel verdiente.“
„Aber um des Himmels willen, warum haben Sie denn das getan?“
„’s hat mir eben keine Ruh gelassen, ich musst’ ihm noch ’n Streich spielen, ich musst’ ihm noch was versetzen. Ich dachte, wenn wir erst verwandt sind, dann is es nu doch amal auf immer vorbei mit so was, und da hatt’ ich mir das eben so schön ausgetüftelt und dachte, ’s würde a Heidenspass sein. Ich dachte, ich schenk’ ihm die Dose, und wenn a nach Hause fährt, denkt a nich an die Dose und fällt rein, weil a doch eben am Zollamt schon geklemmt is. Ein famoser Witz, dacht’ ich. Aber jetzt — ob a etwa noch Unannehmlichkeiten bei seinen Vorgesetzten haben wird?“
„Wahrscheinlich. Sicher sogar. Eine Strafversetzung wird wohl das mindeste sein.“
„Verdammt noch mal, ich bin ein Lausekerl!“
Liebich kam in arge Gewissensnot.
„Vor allen Dingen sagen Sie sonst niemand, dass Sie die Anzeige geschickt haben, sonst wird noch das junge Glück zuschanden, und was können die Kinder dafür?“
„Nee, die können nischt dafür, dass sie solch mordsdämliche Väter haben. Sie halten mich wohl jetzt für einen grossen Esel?“
Ich schwieg, und er nickte trübe vor sich hin. Schliesslich versprach ich ihm, eine ganz ausführliche Eingabe an die österreichische zuständige Behörde aufzusetzen und darin nachzuweisen, dass es sich bei der ganzen Angelegenheit um einen derben Schabernack gehandelt hätte, an dessen Ausgang der seit Jahrzehnten als goldtreu erprobte Beamte ganz unschuldig gewesen sei. Auch wolle ich versuchen, selbst bei den massgebenden Persönlichkeiten vorstellig zu werden und den Sachverhalt aufzuklären. Liebich meinte, wenn ich das täte, würde er es mir sein Leben lang nicht vergessen, denn die Reue über die elende Geschichte nehme ihm reinweg den Atem.
Und so ist es gekommen. Die Eingabe und der Besuch taten ihre Wirkung. Wenzel erhielt eine Vorladung und kam mit einer sanften Nase davon. Als Liebich den guten Ausgang erfuhr, kicherte er in tiefstem Vergnügen und sagte zu mir:
„Ich freu’ mich jetzt doch riesig, dass ich mir den schönen Spass gemacht habe.“
Einer aber aus der edlen Grenzhäuser-Kumpanei erfuhr noch einen grossen Schmerz, und das war mein Freund, der Hahnenwirt.
Wieder einmal war der Wenzel bei ihm eingekehrt und hatte seine Dienstkappe auf den Tisch gelegt. Da beschloss der Hahnenwirt seine übliche Bestellung beim „Blauen“ drüben zu machen und steckte wie spielend ein Lindenblatt an die Mütze. Wenzel sah das, nahm das Blatt und zerpflückte es langsam.
„Warum zerpflückst du denn das hübsche Blättel?“ fragte der Wirt verwundert.
Da sah ihn der Wenzel an und sagte langsam:
„’s hat kan Zweck — der „Blaue“ drüben hat jetzt selber kane Regalia media.“
Wie entgeistert sass der Hahnenwirt vor ihm.
„Was — was meinst du denn damit?“ stotterte er.
„Ich meine,“ sagte der Grenzer gemütlich, „dass du mich seit mehr als zwanzig Jahren für einen dummen Kerl hältst, der Euch die Bestellungen hinüber und herüber schafft. Und ich meine, dass ich das seit zwanzig Jahren gewusst hab’. Hatt’ ich aber ein Sträussel an der Mütze, da wusste ich: halt, heute is was los. Na, und da hab’ ich ja auch genug von Euren Leuten erwischt.“
Das Gesicht meines Freundes Hollmann spiegelte ins Gelbgrüne. Mit schwerem Vorwurf gegen mich sagte er:
„Und einem solchen Kerl haben Sie aus der Patsche geholfen!“