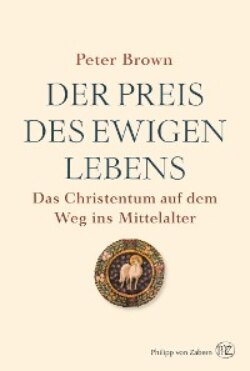Читать книгу Der Preis des ewigen Lebens - Peter Brown - Страница 12
Martyrium in Karthago, 250 n. Chr.
ОглавлениеZunächst haben wir es mit einer Einstellung gegenüber dem Tod und dem Jenseits zu tun, die sich von jener Julians fundamental unterscheidet. Der früheste Autor, den er zitiert, ist Cyprian, der von 248 bis 258 n. Chr. Bischof von Karthago war. Cyprian war eine führende Persönlichkeit bei der Formulierung des christlichen Jenseitsbildes gewesen. Zusätzliche Autorität sollten seine Ansichten dadurch gewinnen, dass er sein Leben als Märtyrer beschloss. Gleich seitenweise schrieb Julian aus Cyprians Abhandlung De mortalitate (»Über die Sterblichkeit«) ab, auch aus seiner an einen gewissen Fortunatus gerichteten »Ermahnung zum Martyrium«.4 In diesen Schriften blickt Cyprian dem Tod ganz unverwandt ins Auge – ja, er starrt durch ihn hindurch: Der Tod scheint ihm nicht mehr als ein Moment, der »überstanden« sein will – expuncta.5 Der Tod als Märtyrer sei der glücklichste, weil dem Märtyrer noch im Augenblick seines Todes der Eintritt in den Himmel gewährt werde: »Welch große Ehre ist es, welch ein Gefühl der Sicherheit, diese Welt mit Freuden zu verlassen und dahinzugehen in Herrlichkeit [...] in dem einen Moment die Augen zu schließen, mit denen man die Menschen und die Welt erblickt hat – und sie im nächsten Moment wieder zu öffnen, um Gott und Christus selbst zu erblicken.« Für einen Märtyrer gab es also gar kein »Nachleben« im Jenseits, sondern nur die augenblickliche Gegenwart Gottes. Julian mögen diese Ansichten Cyprians ein wenig seltsam vorgekommen sein; jedenfalls beeilte er sich, als nächsten Textauszug ein Augustinus-Zitat anzufügen, demzufolge nicht nur Märtyrer, sondern alle Heiligen auf dieselbe unverzügliche Weise in den Himmel gelangen würden.6
Doch Cyprian war nicht wie Julian, ja er war noch nicht einmal wie Augustinus. Den Märtyrern seiner eigenen Zeit galt seine ganze Aufmerksamkeit. Nur die Märtyrer konnten sicher sein, geradewegs in die göttliche Gegenwart zu gelangen. Der Schwerpunkt seines ganzen Jenseitsbildes lag ganz klar auf den Märtyrern.7 Tatsächlich gehörten die leidenschaftlichen Seiten, die Julian zum Trost seines Freundes aus den Werken Cyprians kopiert hatte, einer schon sehr fernen Form des Christentums an, in der die Idee des Martyriums über allem gestanden hatte. Diese fremde Welt sollten wir nun für einen Moment in den Blick nehmen.
Anders als Julian war Cyprian nicht ein Erzbischof im Spanien des 7. Jahrhunderts gewesen – ganz im Gegenteil. Er war der Kopf einer winzigen Gemeinde im nordafrikanischen Karthago, deren wahrscheinlich nicht mehr als 2500 Mitglieder im besten Fall etwa ein Dreißigstel der Einwohnerschaft ausmachten. Und tatsächlich drohte vielen seiner Gemeindemitglieder die Hinrichtung als Märtyrer – vom griechischen mártyres, »Zeugen« – des christlichen Glaubens. Außerdem wütete in Karthago zu jener Zeit die Pest. Das war die Situation, in der Cyprian seine ermutigenden Worte niederschrieb.
Und Ermutigung konnten seine Brüder und Schwestern gut gebrauchen. Wir sollten uns die Christengemeinde von Karthago nicht als Bollwerk kampfbereiter Heiliger vorstellen, die angesichts einer gnadenlos feindlichen Umwelt jederzeit für ihren Glauben zu sterben bereit waren. Wie Éric Rebillard vor Kurzem in einem brillanten Buch dargelegt hat, verbrachten die frühen Christen in Karthago und anderswo nur einen Bruchteil ihrer Zeit damit, frühe Christen zu sein. Sie besaßen viele verschiedene Identitäten und unterhielten eine Vielzahl von Beziehungen zu einer heidnischen Gesellschaft, die sie zumeist überhaupt nicht als Christen wahrnahm. Viele von ihnen waren auch gar nicht der Ansicht, dass ihr Christsein eine unwiderrufliche Vollzeitidentität bedeutete. Der Kircheneintritt fiel ihnen nicht schwer. Aber sobald ihnen klar wurde, dass ihre Bindung an das Christentum sie in Widerstreit zu älteren, stärkeren Loyalitäten geraten ließ, traten sie auch genauso schnell wieder aus. Und deshalb ist Cyprians Beschwörung der toten Märtyrer eben nicht Ausdruck einer gleichsam monolithischen Christengemeinde. Vielmehr wurden das Ideal des Märtyrertodes und die Vorstellung eines augenblicklichen Eingangs der Märtyrer in den Himmel von Cyprian herangezogen, um eine potenziell gleichgültige Gemeinde herauszufordern. Cyprians Behauptungen waren umso dramatischer, als er überhaupt nicht sicher sein konnte, dass sie überhaupt gehört werden würden.8
Die Notwendigkeit, die durchschnittlichen Christen zur Befolgung ihres Glaubens anzuhalten, sorgte im Karthago Cyprians wie auch anderswo in der spätantiken Welt dafür, dass die Märtyrertodthematik die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen – Heiden wie Christen – in Beschlag hielt. Und das geschah mit einer solchen Eindringlichkeit, dass alle anderen christlichen Grübeleien über das Jenseits davon in den Schatten gestellt wurden. Ein normaler Tod interessierte kaum, aber das Martyrium – das war etwas Besonderes. Der Märtyrertod war »ein Tod für Gott, neu und außergewöhnlich«.9 Er stand für ein Christentum, wie man es sich extremer – aber auch authentischer – nicht vorstellen konnte.
Aus der Sicht der Nichtchristen hingegen stand er für ein Christentum, wie man es sich überspannter und aufdringlicher nicht vorstellen konnte. Wir dürfen eines nicht vergessen: Den Märtyrertod zu sterben, bedeutete ja nicht, dass man mit christlicher Geduld und Standhaftigkeit einem Justizverfahren zum Opfer fiel, das im (einigermaßen) Verborgenen verlaufen wäre. Diese moderne Vorstellung ist viel zu zahm; sie entspringt der Vorstellung von unserem heutigen Rechtssystem. Vielmehr waren öffentliche Gerichtsverhandlungen und öffentliche Hinrichtungen ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des Lebens in einer römischen Stadt. Entsprechend erinnerten sich die Christen an die Martyrien ihrer Glaubensbrüder und -schwestern als extreme und schreckliche Ereignisse, die sich in aller Öffentlichkeit abgespielt hatten, vor den Gerichtshöfen und in den Amphitheatern, vor aller Augen.10
Und doch war das, was Christen wie Cyprian ein »außergewöhnlicher« Tod schien, für den durchschnittlichen Heiden eher abnorm, ja krankhaft. In den Augen ihrer heidnischen Mitbürger waren die Christen ein Haufen selbstmörderischer Exhibitionisten. Wie der Kaiser Marc Aurel (161–180) in seinen Selbstbetrachtungen geschrieben hatte: Ein weiser Mann dürfe sich sehr wohl entschließen, seinem Leben selbst ein Ende zu bereiten. Aber den Tod allein aus Trotz herauszufordern »wie [...] bei den Christen«, war ein »theatralisches Gebaren«, das den Kaiser abstieß. Mag sein, dass der Zusatz »wie [...] bei den Christen« von einem späteren Kopisten eingefügt worden ist.11 Aber auch der Kopist hätte die Sache dann auf den Punkt gebracht: Manche Tode (und nicht nur die von Christen) waren öffentliche Spektakel der aufdringlichsten und unerfreulichsten Art.
Wir dürfen nicht vergessen, dass aus der Sicht eines durchschnittlichen Nichtchristen jener Zeit die christlichen Märtyrer so besonders überhaupt nicht waren. Vielmehr passten sie nur zu gut in eine lange Reihe blutverschmierter und irrer Gestalten: Gladiatoren spielten in der Arena mit ihrem Leben. Ihre blutigen, verstümmelten Leichname assoziierte man mit übermenschlichen Kräften.12 Auch rebellische Philosophen setzten ihr Leben aufs Spiel, indem sie alles daransetzten, die Mächtigen zu beleidigen. Der Verrückteste unter ihnen, der Philosoph Peregrinus, hatte sogar eine Zeit lang mit dem Christentum geliebäugelt. Unter den Christen hatte er großes Ansehen als potenzieller Märtyrer erlangt. Im Jahr 165 n. Chr. nahm er sich das Leben, indem er sich unweit der Zuschauermassen, die sich in Olympia zu den Olympischen Spielen versammelt hatten, anzündete und verbrannte.13 Die Tode der christlichen Märtyrer machten auf Außenstehende nicht zwangsläufig Eindruck. Viel eher wirkten sie auf diese grotesk und verstörend. Dennoch hatten Christen und Nichtchristen eines gemein: Ob sie ihnen nun heldenhaft oder krankhaft erschienen, die grausigen, ganz und gar öffentlichen Tode der christlichen Märtyrer hielten ihre Aufmerksamkeit in Bann – und andere, gewöhnlichere Tode hatten das Nachsehen.