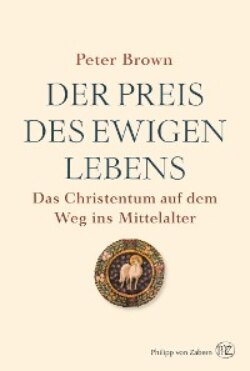Читать книгу Der Preis des ewigen Lebens - Peter Brown - Страница 14
Das Jenseits des Julian von Toledo
ОглавлениеNachdem wir uns in den Jenseitswelten Cyprians und Tertullians umgesehen haben, können wir diese nun mit den Vorstellungen Julians von Toledo vergleichen. Dazu wollen wir uns vorstellen, wie ein Tertullian oder ein Cyprian womöglich auf das Jenseitsbild reagiert hätten, das Julian in seinen Schriften entwirft. Welche Aspekte dieses Bildes wären ihnen wohl seltsam vorgekommen?
Um es ganz kurz zu machen: In den Werken Cyprians (und mehr noch bei Tertullian) verbindet sich die epochale Wucht, die dem Gedanken an die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde innewohnt, mit einer starken Akzentuierung der Einmaligkeit eines jeden Märtyrertodes. Daneben konnte eine durchschnittliche Seele nur blass aussehen. Die Vorstellungswelt jener frühen Christen bot nur wenig Raum, in dem sich ein Interesse an postmortalen Einzelschicksalen oder an individualisierten »Jenseitsprofilen« einzelner Verstorbener hätte ausbilden können. Dazu war die Zeitspanne, die zwischen dem Tod und der Herrlichkeit der Auferstehung lag, schlichtweg zu kurz.
Für Julian von Toledo hatte sich, im Gegensatz dazu, der Abstand zwischen Tod und Auferstehung vergrößert. So war genügend Zeit, den individuellen Weg der Einzelseele im Jenseits mit einer je eigenen Dramatik und Bedeutung aufzuladen. Eine ganze Entwicklungsgeschichte der einzelnen Seele im Jenseits wurde nun entfaltet und in allen ihren Details ausgemalt. Das Leben nach dem Tod bedeutete nun auch für Durchschnittschristen mehr als nur den flüchtigen Moment zwischen ihrem Sterben und jener gewaltigen Umwälzung, der Auferstehung.
Natürlich gibt es auch in Julians Prognosticon vieles, was an die älteren christlichen Glaubensvorstellungen eines Cyprian oder Tertullian unmittelbar anknüpft. Jene gewaltigen Veränderungen durch das Jüngste Gericht und die Auferstehung der Toten ragten auch an Julians eschatologischem Horizont. Dort standen sie, unveränderlich – so ungeheuer und erhaben wie der Himalaja. Doch bis in Julians Zeit waren auch die niederen Ausläufer dieser gewaltigen Bergkette aus dem Dunst hervorgetreten: Die »kleine Zukunft« in der Welt zwischen Tod und Auferstehung wurde nun genauso gründlich in den Blick genommen wie die »große Zukunft« am Ende der Zeiten. Julian und Idalius wollten ganz genau wissen, wie es ihren Seelen in jener Zwischenzeit ergehen würde.20
Tatsächlich könnte man das Prognosticon als eine Art »Futurologie der christlichen Seele« beschreiben. Und die beiden Bischöfe suchten jedes noch so kleine Detail zu erfahren, das ihnen bei dieser Zukunftsschilderung von Nutzen sein konnte. Im Gegensatz zu früheren Jenseitsvorstellungen war diese Zukunft nun keine reine Wartezeit mehr. Vielmehr wurde sie Raum und erstreckte sich vor Julians und Idalius’ Vorstellungskraft als ein Abenteuerland, in dem die Seele auf unzählige Gefahren treffen mochte, die in keiner Karte verzeichnet waren. Der Tod war nichts weiter als der Beginn einer großen Reise. Beim Aufbruch der Seele in jene andere Welt – im Augenblick des Todes – war fortan mit einem Beiklang von gespannter Erregung zu rechnen, der als »Reisefieber« wohl nur unzureichend beschrieben wäre. Um das Sterben großer Heiliger – oder großer Sünder – hatten sich schon früher drastische Geschichten von entsprechenden Nahtoderfahrungen gerankt, von Begegnungen mit Engeln und Teufeln auf der Schwelle des Todes. Julian kannte diese Geschichten und er nahm sie durchaus ernst.21 Doch vor allem ging es ihm – anders als etwa Cyprian – um den Tod und das jenseitige Schicksal ganz normaler Christen und nicht um die je einzigartigen Tode der Märtyrer.
Wir sollten uns also einen Moment Zeit nehmen, um Julians Sicht auf das Schicksal der christlichen Durchschnittsseele nach dem Tod genauer zu betrachten. Drei Punkte stechen besonders hervor. Zunächst einmal, und das ist bereits angeklungen, mussten die Seelen nach Julians Vorstellung nicht einfach (statisch) abwarten, sondern blieben in Bewegung; und zwar bewegte sich jede Seele in ihrer eigenen Geschwindigkeit auf den Himmel zu – vorausgesetzt natürlich, dass sie nicht in die Hölle gekommen war. Manche Seelen waren wesentlich langsamer unterwegs als andere. Das christliche Jenseits ähnelte also nicht mehr einem riesigen Wartezimmer (wie Tertullian es sich vorgestellte hatte), sondern viel eher einem heutigen Stadtmarathon: Vorn hatte sich eine kleine Spitzengruppe abgesetzt, dahinter folgte – mit einigem Abstand – das große Feld der Nachzügler in diesem Seelenmarathon. Zweitens war für jeden der Nachzügler – gemeint sind die Nichtheiligen – die Jenseitsreise mit einer grundsätzlichen Unsicherheit verbunden: In welche Richtung würde die Seele sich bei ihrem Eintritt in jenes unentdeckte Land wenden – dem Himmel zu? Oder in Richtung Hölle? Welche überirdischen Wesen – Engel oder Teufel – würden ihr dabei begegnen?22 Zu guter Letzt war Julian davon überzeugt, dass manche Seelen ein reinigendes Feuer erwarte, das sie – wiederum jede in ihrem eigenen Tempo – zu durchqueren hätten.23 (Dies war jener purgatorius ignis, der sich erst später zu dem voll entwickelten Purgatorium oder »Fegefeuer« entwickeln sollte, wie es die katholische Kirche des Mittelalters und der Neuzeit postuliert hat.)
Als frommer Bischof durfte Idalius zwar noch immer darauf hoffen, nach seinem Tod statim – sofort – zu erwachen und in Christi Angesicht zu schauen, wie es Cyprian für die Märtyrer vorhergesagt hatte. Aber das Prognosticon seines Freundes Julian hielt noch ein ganzes Spektrum anderer Optionen für weniger perfekte Seelen bereit. Denn jede Seele barg fortan ihr eigenes Schicksal. Das lag daran, dass – wie man glaubte – die Seelen der Verstorbenen ihr ganzes irdisches Leben als »Gepäck« mit sich ins Jenseits trugen. Jede einzelne von ihnen war gezeichnet – ob zum Guten oder zum Schlechten – von ihrer je eigenen, unauslöschlichen Individualität, über die sie bis ins kleinste Detail Rechenschaft abzulegen hatte (nicht selten vor furchterregenden Teufeln oder gestrengen Engeln). Die Leichtigkeit (oder eben Schwierigkeit), mit der die einzelne Seele den Himmel erreichen konnte, hing maßgeblich von dieser Individualität ab – von einem komplexen Gemisch aus Tugenden und Lastern, Sünden und Verdiensten, die sich im Laufe eines ganzen Lebens um sie angelagert hatten.
Dieses zunehmende Augenmerk auf das Schicksal der Einzelseele war es – verstanden als Funktion des spezifischen Mischungsverhältnisses ihrer Sünden und Verdienste –, das das Jenseits Julians von Toledo so völlig anders erscheinen ließ als jenes Cyprians von Karthago. Aus der Welt eines früheren Christentums, in dem die unglaubliche Erschütterung von Weltgericht und allgemeiner Auferstehung im Zentrum des Interesses gestanden hatte, sind wir in eine Welt gelangt, in der (um es salopp zu formulieren) jede Seele ihr eigenes Süppchen kochte.