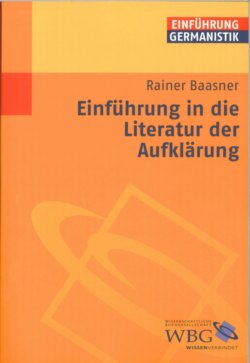Читать книгу Einführung in die Literatur der Aufklärung - Rainer Baasner - Страница 10
Оглавление[Menü]
II. Forschungsbericht
1. Aufklärungsforschung im 19. und 20. Jahrhundert
Zwei Phasen verstärkter Aufklärungsforschung sind zu beobachten, seit es eine disziplinär ausdifferenzierte Germanistik gibt. Die erste ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts situiert, die zweite im 20. Jahrhundert ab 1968. In beiden Zeiräumen ist das Interesse für den Gegenstand ‚literarische Aufklärung‘ an spezifische methodische Entwicklungen gebunden, zuerst an den Positivismus, später an Tendenzen der historisch-materialistischen und der sozialgeschichtlichen Literaturwissenschaft. Beide Phasen weisen die Eigenart auf, dass sie breite, faktengestützte Fundamente schaffen, auf denen differenzierte Hypothesen und Synthesen aufruhen. Die gebotene Kürze der hier vorliegenden Überblicksdarstellung erlaubt freilich dazu nicht mehr als skizzenhafte Andeutungen.
Wo immer ‚Aufklärung‘ als literarische Epoche ernst genommen wird, führt das zu einer relativen Abwertung anderer wichtiger Epochen; viele der oben dargelegten grundlegenden Züge von ‚Aufklärung‘ werden als Gegensätze zu einer ‚klassischen‘ oder ‚romantischen‘ Dichtung gesehen. Der Rationalitätsanspruch der ersteren scheint kaum mit dem auratischen Literaturbegriff einer ästhetischen und nahezu seherischen autonomen Literatur vereinbar. Als Übergangsphänomen und Wendepunkt wird das Œuvre Lessings betrachtet,
denn ihm verdanken wir sowohl eine inhaltsvolle Dichtung, als auch einen der bedeutendsten Anfänge einer Philosophie, die von ‚trüber Tiefe‘ und oberflächlicher Deutlichkeit gleich weit entfernt ist. (Danzel/Guhrauer 1880 I, 2)
Formulierungen dieser Art beherrschen die frühe Literaturgeschichtsschreibung seit Georg Gottfried Gervinus‘ Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen (1835 ff.) und setzen sich bis in die jüngste Vergangenheit fort. In einer derartigen Modellbildung wird die Blüte der deutschen Literatur mit der Weimarer Klassik angesetzt und Lessing sowie Klopstock werden strikt teleologisch als ‚Vorklassiker‘ oder ‚auf dem Weg zum Parnaß‘ befindlich (vgl. Rosenberg 1999) bezeichnet. Mit einem ernsthaften Forschungsinteresse für Gottsched oder Bodmer geht in den Augen dieser Tradition immer eine Herabsetzung der Klassik einher. Auch Hermann Hettners Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert (1856–70) beschäftigt sich deshalb nicht schwerpunktmäßig mit Aufklärung, sondern würdigt – bei aller historischen Differenziertheit ihrer Darstellung – vor allem die Goethezeit. So erringt die Epoche ‚Aufklärung‘ in der Blütephase des nationalistischen Paradigmas ‚Klassik‘ noch keine eigenständige Geltung, sondern nur eine mittelbare im Schatten der vorgeblichen Weimarer Gipfeldichtung, wenngleich bis 1890 einige große detaillierte Monographien über Vertreter der frühen Aufklärung erscheinen (z. B. Theodor Wilhelm Danzel: Gottsched und seine Zeit. Auszüge aus seinem Briefwechsel. Leipzig 1850; Jacob Minor: Christian Felix Weiße und seine Beziehungen zur deutschen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts. Innsbruck 1880 u. a.).
2. Aufklärungsforschung nach 1968
Die zweite Phase der Aufklärungsforschung in der deutschen Literaturwissenschaft beginnt nach 1968. Sie entsteht aus einer ganz anderen Fragestellung in völlig neuen Kontexten; nicht mehr ‚wie konnte es zu so etwas Bedeutendem wie der deutschen Klassik kommen?‘ wird gefragt, sondern eher ‚was gab es außer der vom deutschen Faschismus ideologisierten deutschen Klassik sonst noch?‘ Das Interesse richtet sich aus einer kritischen Haltung gegenüber der Tradition des Nationalen auf Aspekte des Vor-Nationalen, von der Obrigkeitskultur hin zu kulturellen Wurzeln demokratischer Gesinnungen und von der angeblichen Auserwähltheit des Dichters zur bürgerlichen Egalité des Schriftstellers. Der klassizistische Kanon wird bestritten, ein Gegenkanon aus Aufklärung und Vormärz versuchsweise diskutiert, ferner die affirmative werkimmanente Interpretation zugunsten alternativer kritischer Ansätze, von der kritischen Theorie über mehr oder weniger marxistisch beeinflusste Sozialgeschichte bis zur Empirischen Theorie der Literaturwissenschaft, verdrängt.
Anschlussmöglichkeiten und eine gewisse Kontinuität finden die divergierenden Forschungen zur Literatur des 18. Jahrhunderts unter den Stichworten ‚Bürgertum‘ und ‚Öffentlichkeit‘. Unter beiden Begriffen werden soziale Konstrukte verstanden, die als Anknüpfungspunkte für eine in Deutschland zu institutionalisierende zivile Gesellschaft genauer erforscht werden. Die politische Motivierung dieser Fragestellung erleichterte die fachübergreifende Verständigung, mit der Bezeichnung ‚18. Jahrhundert-Forschung‘ (auch im Deutschen gängig ist der französische Terminus ‚Dixhuitièmisme‘) wird ein interdisziplinäres Feld aus Philologien, Historischen und Sozialwissenschaften begründet.
Methodische Innovation
Die Forschungsarbeiten zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts weisen zwei Richtungen auf: Die erste widmet sich eher der Entwicklung neuer theoretischer und methodischer Ansätze am Beispiel des neu erschlossenen Gegenstandes (Sozialgeschichte, Empirische Literaturwissenschaft, Diskursanalyse, Systemtheorie u. a.), die zweite stellt die Erschließung neuer Quellenbereiche (Textedition ‚vergessener Texte‘, unbekannte Autoren, Verlags- und Buchhandelsgeschichte, Literaturkritik) in den Mittelpunkt. Nie zuvor ist in rund zwei Dekaden derart viel ernste Theorie betrieben und zugleich soviel Material erhoben und ausgewertet worden, wie in den 1970er und -80er Jahren.
Quellenstudium
Da der Zeitraum seit 1968 zugleich günstige institutionelle Voraussetzungen für eine breit angelegte historische Forschung mit sich bringt, wächst die Vielfalt der Ergebnisse derartig, dass sie die Möglichkeiten einer stringenten Systematisierung übersteigt. So liegen bis heute divergierende Befunde und kaum ausgewertete Materialkonvolute vor, die als Überschuss einer florierenden Forschungslandschaft gelten können und noch kaum abschließend verarbeitet worden sind.
Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts allerdings sind die Zeiten einer lebhaften Aufklärungsforschung vorbei. Die disziplinäre Selbstreflexion attestiert dem Fach retrospektiv den Abschluss einer Forschungsphase sowie den Niedergang des gesamten Themenbereichs. Der Aufsatztitel Nach der Aufklärungsforschung (vgl. Erhart 1999) markiert das vorläufige Innehalten besonders deutlich. Trotzdem wird die Literatur des 18. Jahrhunderts weiterhin erforscht, doch lauten die leitenden Stichwörter anders. Verändert hat sich die politische Einstellung, die sich vielfach dem Nationalen und der Kanonkonsolidierung wieder angenähert hat, ferner das Problem von ‚Bürgertum‘ und ‚Öffentlichkeit‘ in so genannte anthropologische und medienhistorische Fragestellungen übergeführt hat.