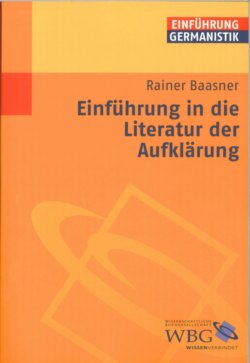Читать книгу Einführung in die Literatur der Aufklärung - Rainer Baasner - Страница 8
1. Epochenstruktur
ОглавлениеEpoche Aufklärung
‚Aufklärung‘ bezeichnet in der deutschen Literaturgeschichte eine umfangreiche Epoche. Schon ihre zeitliche Ausdehnung ist sehr groß; der Zeitraum, der ihr in der Literaturgeschichtsschreibung zugeordnet wird, reicht von etwa 1690 bis nach 1800. Im Gegensatz zu ‚Klassik‘, ‚Romantik‘ oder anderen Epochen ist ‚Aufklärung‘ weder auf Literatur noch auf die Künste im Allgemeinen beschränkt: Ihren inneren Zusammenhalt gewinnt diese Epoche durch weitreichende, relativ stabile Strukturen, die weitaus mehr als nur Literatur einschließen. Sie etablieren ausgedehnte Kontexte, in denen Literatur als Bestandteil eines umfassenden Wissens- und Bildungssystems im Verlauf des Jahrhunderts eine immer bedeutendere Rolle gewinnt und schließlich für mehr als die darauf folgenden zwei Jahrhunderte kulturelle Hegemonie erlangt.
Selbstbeschreibung
Als literaturwissenschaftliche Epochenbezeichnung wird ‚Aufklärung‘ zwar erst nachträglich eingeführt, doch bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist der Terminus den Zeitgenossen zur Selbstbeschreibung ihres Zeitalters geläufig. Größte Wichtigkeit für die Literatur im deutschen Sprachraum gewinnt ‚Aufklärung‘ zunächst dadurch, dass sie deren flächendeckende Herausbildung in der Nationalsprache erstmals konsequent betreibt. In den vorausgegangenen literarischen Epochen war immer das Latein neben dem Deutschen Literatursprache, erst im Verlauf der Aufklärung kommt es zu einer unstrittigen Konzentration auf die eigene Muttersprache. Zugleich werden in diesem Zeitalter jene Bildungsgrundlagen gelegt, die weiteren Teilen der Bevölkerung schließlich den Zugang zur Schriftkultur ermöglichen.
Historische Umbruchphase
In der Epoche der Aufklärung wird der Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit abgeschlossen; Wissen, Gesellschaft, Staat und Wirtschaft erhalten im Laufe des 18. Jahrhunderts jene Prägung, die später als ‚neuzeitlich‘ selbstverständlich wird. Die Funktion der Literatur in diesen Wandlungsprozessen ist bedeutender als in jedem früheren oder späteren Jahrhundert. Wenn auch seitdem nur wenige aufklärerische Werke als ‚überzeitliche hohe Dichtung‘ des ‚Höhenkamms‘ kanonisiert wurden, so wirken doch die literarischen und literaturbezogenen Strukturen des Zeitalters nachhaltig auf die gesamte spätere Entwicklung. Diese Umstände verleihen der literarischen Aufklärung einen einzigartigen historischen Sonderstatus, der innerhalb der Literaturgeschichte eine wirkungsvolle Umbruch- und Formationsphase markiert.
Frühe Neuzeit/ Neuzeit
Im Laufe des 18. Jahrhunderts entsteht eine Literatur, die die schon von den Zeitgenossen als altertümlich empfundenen Eigenarten des Barocken ablegt und schließlich zur Klassik überleitet. Rückblickend lässt sich sagen, dass sie am Ende des 18. Jahrhunderts neuzeitliche, ja teilweise beinahe moderne Merkmale annimmt. Die Erfahrung zeigt, dass man heute Literatur aus der Anfangsphase der Aufklärung nur schwer verstehen, in Texten um 1800 aber durchaus bereits vertrautere Züge finden kann. Die Literatur der Aufklärung bietet somit das Bindeglied zwischen Früher Neuzeit und Neuzeit, sie initiiert einen Prozess fortwährender, in eine Richtung weisender Entwicklungsdynamik. Diese Modernisierung beschränkt sich nicht auf die Literatur, sondern schließt die gesamte Weltwahrnehmung und das Menschenverständnis ein, auch im Hinblick auf Wissenschaften, Politik und Technik kann die Epoche der Aufklärung als eine Art Wiege unserer Jetztzeit beschrieben werden.
Epocheninterne Differenzierungen
Da die historisch-kulturellen Ereignisse innerhalb des großen Zeitraumes von über hundert Jahren eine hohe Dynamik und Vielfalt aufweisen, lässt sich diese Großepoche kaum mit einigen wenigen Schlagwörtern angemessen charakterisieren. In den Jahren 1700 und 1800 gleichermaßen Merkmale derselben Aufklärung zu sehen, erfordert erhebliche Abstraktionen, die über konkrete historische Einzelheiten hinweggehen. Die Aspekte, die im 18. Jahrhundert bei diachroner wie synchroner Betrachtung zu einem Gesamtphänomen ‚Aufklärung‘ beitragen, weisen, aus der Nähe gesehen, nämlich durchaus auch heterogene Eigenschaften auf.
Zur literarhistorischen Binnendifferenzierung werden im selben Zeitraum deshalb weitere literarische Epochen angesetzt; die wichtigsten darunter heißen ‚Empfindsamkeit‘ (ab etwa 1750), ‚Rokoko‘ (veraltet!, ab etwa 1760), ‚Sturm und Drang‘ (ab etwa 1770), ‚Klassik‘ (ab 1786) und ‚[Jenaer] Romantik‘ (ab 1790). Sie bestehen neben der fortlaufenden Aufklärungsbewegung, ja können mehr oder weniger als kontroverse Teile von ihr betrachtet werden, die ohne eine permanente Reibung an aufklärerischen Prinzipien keine Legitimation besäßen.
Die eigentliche Strömung wiederum wird in sich in Frühaufklärung (1690–1730), Hochaufklärung (1730–1770) und Spätaufklärung (1770– nach 1800) gegliedert. Sowohl im Hinblick auf politische und gesellschaftliche als auch auf literarische Entwicklungen bieten alle drei Phasen jeweils eigentümliche Problemstellungen. Jeder dieser Zeiträume umfasst unter literaturtheoretischen, gattungstypologischen und sozialfunktionalen Aspekten unterschiedliche Entwicklungsstände und Themenkonstellationen. Als Schwellenereignisse und Strukturierungsschwerpunkte dieser Subepochen werden gewöhnlich folgende angenommen:
Frühaufklärung
Die literarische Frühaufklärung beginnt mit Forderungen nach nationalsprachlichem akademischem Unterricht und Schrifttum. Strukturelle Prägung erhält der Entwicklungsabschnitt durch die Verbreitung dieser Idee, zugleich aber vor allem durch die Popularisierung und Dynamisierung allgemeiner aufklärerischer Fragestellungen, die eine Grundlegung der Epochensignaturen bewirken und nach und nach die barocken Traditionen verabschieden.
Hochaufklärung
Die literarische Hochaufklärung steht unter dem beherrschenden Einfluss des wichtigsten poetologischen Regelwerks, des Versuch einer critischen Dichtkunst (1730) Johann Christoph Gottscheds (1700–1766), an dessen Verbreitung und Durchsetzung sich zugleich eine vehemente Debatte anschließt. Darin wird einerseits der Literaturbegriff der Aufklärung methodisch geklärt, andererseits auch bald in eine Vielzahl divergierender Facetten zergliedert. Ein Effekt dieser weitreichenden Diskussionen ist die Aufsprengung der vermeintlich einheitlichen Entwicklung in die bereits erwähnten (Teil-)Strömungen der zeitgenössischen Literatur. Hier wirkt sich besonders die Kritik an der Einseitigkeit verstandesmäßiger Aufklärung aus, empfindsame Konzeptionen stärken die Wertschätzung der Sinnlichkeit und des moralischen Gefühls, die in konkurrierenden Literaturkonzeptionen gewürdigt werden.
Spätaufklärung
Eine literarische Spätaufklärung lässt sich hingegen weniger an einem eigenen konstitutiven Ereignis festmachen als am Auftreten der erwähnten konkurrierenden literarischen Strömungen (Sturm und Drang, Klassik, Romantik), das eine klärende Rückbesinnung auf ein Selbstverständnis von ‚Aufklärung‘ erzwingt. In den Auseinandersetzungen wandeln sich die Rahmenbedingungen aufklärerischer Literatur auch in Bezug auf ihre epistemologischen und sozialen Fundamente. Zugleich wird für die Zeitgenossen selbst erkennbar, dass das ehedem zuversichtlich betriebene Projekt ‚Aufklärung‘ an Grenzen stößt.
Strukturgeschichte
Kein Überblick über die Literaturgeschichte der deutschen Aufklärung lebt von der Aufzählung einzigartiger dichterischer Werke. Im Lichte der anspruchsvollen ästhetischen Wertmaßstäbe späterer Epochen bietet das 18. Jahrhundert scheinbar nur wenig Bewahrenswertes, Lessings Nathan und Klopstocks Oden mögen dazuzählen. Die unerhörten Werke, vom Werther über den gestiefelten Kater bis zum Don Karlos, allesamt erst aus dem letzten Drittel des Jahrhunderts, werden bereits den neueren literarischen Strömungen zugerechnet. Und doch sind auch sie nicht plötzlich aus dem Nichts erschienen, sie alle beruhen auf Ergebnissen aufklärerischer Debatten.
Was für die Konstitution der literarischen Aufklärung zunächst einmal zählt, sind die gemeinsamen Eigenschaften, die die literarischen Werke, so unbedeutend sie im Einzelnen wirken mögen, untereinander in Verbindung setzen. Diese seriellen Eigenschaften der Texte werden durch die literarischen Normen einer relativ geschlossenen Poetik in ihren Grundlagen bestimmt und erhalten darüber hinaus noch gewisse differierende Ausprägungen. Beschränkt man jedoch die Betrachtung nicht allein auf kulturelle Phänomene, nämlich Texte (Werkgeschichte), publizistische Strategien (Mediengeschichte) und gewerbliche Verteilung (Buchhandelsgeschichte), sondern bezieht Autoren als handelnde Personen mit in die Betrachtung ein, so erhält die Darstellung weiterhin eine sozialgeschichtliche Komponente. Unter diesen Voraussetzungen wäre es kaum sinnvoll, Literaturgeschichte der Aufklärung ausschließlich als Ereignisgeschichte, als Skizze eines epochalen ‚Höhenkamms‘ unverwechselbarer auratisierter Kunstwerke zu rekonstruieren; es entsteht vielmehr eine Strukturgeschichte, die vor allem wiederkehrende Epochenmerkmale (vgl. Müller 1989, 205 ff.) der literarischen Texte, ihrer allgemeinen Kontexte sowie ihrer Urheber und Rezipienten ins Blickfeld nimmt.
Komplementäre Strömungen
Neben den Hauptentwicklungslinien der aufklärerischen Literatur, die vor allem an Prinzipien der rationalistischen Wissensvermittlung orientiert ist, finden sich weitere Entwicklungszusammenhänge der Literatur, die als Nebenstömungen bezeichnet werden können. Sie gehören durch ihre komplementäre Ausprägung ebenfalls unverzichtbar in die Literaturlandschaft des Zeitalters. Hervorzuheben wäre unter ihnen zunächst der Sturm und Drang, der jedoch in der vorliegenden Einleitung nicht berücksichtigt wird.
Empfindsamkeit
Des Weiteren entstehen in der Schönen Literatur seit etwa 1740 Tendenzen der Empfindsamkeit, die der rücksichtslosen Vorherrschaft der Vernunft Grenzen zu setzen bemüht sind. Der Terminus ‚Empfindsamkeit‘ bezeichnet eine Strömung der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts, die in diesem Sinne als Komplement zur Aufklärung entsteht und parallel zu ihr verläuft. Im Gegensatz zu ‚Aufklärung‘ hat diese Bezeichnung eine deutlich geringere Reichweite, sie ruht erstens auf deren Grundprinzipen auf und ist zweitens auf die Schöne Literatur und ihre Berührungsbereiche mit Moralphilosophie, pietistischer Theologie und anderen kulturellen Feldern beschränkt. Die Verwendung des Terminus ‚empfindsam‘ zur Bezeichnung einer neuen Gefühlskultur geht wohl auf Lessings Vorschlag zurück, das in der englischen Literatur geläufige Wort ‚sentimental‘ im Deutschen mit diesem Begriff wiederzugeben.
Die Entwicklung der deutschen Literatur des fortgeschrittenen 18. Jahrhunderts ist ohne eine Würdigung der ‚Empfindsamkeit‘ nicht zu verstehen. Wo Aufklärung bloß auf den Verstand des Menschen setzt, bezieht Empfindsamkeit Herz und Sinne in die Betrachtung mit ein. Die in diesem Kontext vorgenommene Aufwertung des Gefühls geht auf die Erfahrung zurück, dass nicht alle menschlichen Äußerungen oder Handlungen rational sind, sondern gleichfalls oder häufig allein auf Empfindungen beruhen. Diese sind nicht aufklärbar, das heißt, sie können dem logisch-systematischen Denken nicht sinnvoll untergeordnet, ja oft nicht einmal in dessen Kategorien erklärt werden. Dieser Bereich markiert eine Grenze für die traditionelle, rationalistische Aufklärung und ihrer anthropologischen und erkenntnistheoretischen Auffassungen.
In der Empfindsamkeit wird somit – in einer positiven Auslegung – die rationalistische Aufklärung um wichtige menschliche Dimensionen erweitert. Diese betreffen erstens die natürliche Veranlagung und intuitive Fähigkeit zum moralischen Handeln (dies wird bewirkt und angeleitet durch ein von Gott oder der Natur gegebenes ‚gutes Herz‘), zweitens die sinnliche Wahrnehmung und die Entwicklung von Gefühlen. Weder die Entscheidungen des Herzens noch die Entstehung sinnlicher Eindrücke und Gefühle müssen dem Verstand unterworfen werden, wie es die Aufklärungstheorie postuliert. Die Kriterien der Empfindsamkeit sind jedoch nicht nur im positiven Sinne als Abgrenzung von Aufklärung zu verstehen. Die Vertreter des Rationalismus lehnen sie ab und erheben den Vorwurf, durch Empfindsamkeit werde jede objektivierbare Regelung der vernunftorientierten Aufklärung einer moralischen und subjektivistischen Gefühlsduselei (‚Empfindelei‘) geopfert.
Gefühlskultur
Die Literatur der Empfindsamkeit widmet sich der Exploration und Darstellung der neuen Erlebnis- und Wahrnehmungsbereiche, die sich dem empfindsamen Individuum erschließen. Während in der traditionellen Gesellschaftsform der Frühen Neuzeit – und entsprechend in ihrer Literatur – kein Platz für individuelle oder gar private Gefühle war, weil die Dinge durch rigide ständische Sozialordnungen und religiöse Verhaltensanweisungen eingerichtet waren, kann mit der kritischen Auflösung der sozialen Traditionsformen ein abweichender Ton aufkommen. Gefühle der Zärtlichkeit, der Liebe und des Mitleids sind die wirksamsten, die in der empfindsamen Literatur dargestellt werden. Aber auch Gegenstände, die sonst nur wissenschaftlicher Wahrnehmung oder topischer Gestaltung zugänglich waren, wie etwa die Natur, können hier zum Gegenstand und Ziel von individuellen Gefühlen werden: Naturgefühl entsteht. Empfindsame Reiseberichte zeugen davon ebenso wie die Naturlyrik, die sich von der lehrhaften Beschreibung einer naturgeschichtlich aufgefassten Umgebung abwendet und Natur als Illustration und Symbol der menschlichen Gemütszustände begreift und poetisch nutzt. Weiterhin äußert sich die entwickelte Empfindsamkeit in einer neuartigen ausgeprägten Gefühlskultur, die im zwischenmenschlichen Bereich Zärtlichkeit und Freundschaft als Handlungsmuster einführt und -fordert.
Empfindsamkeit in Deutschland hat daneben eine weitere Wurzel in der intensiven religiösen Gefühlspflege des Pietismus (in diesem Sinne erscheint Empfindsamkeit als säkularisierter Pietismus), wo die Glaubensfähigkeit des Einzelnen davon abhängt, sein Inneres akribisch zu beobachten und seine Psyche dem religiösen Erleben zu öffnen. Prägende Gedanken vermittelt die englische ‚moral sense‘-Philosophie, wie sie von Anthony A. C. Shaftesbury (1671–1713), David Hume (1711–1776) und anderen ausgearbeitet wurde. Sie geht aus von einem gutwilligen, auf Gutes gerichteten Kern des menschlichen Inneren. Allerdings nur, wenn die Vernunft die Kontrolle behält, darf der Mensch seinen Gefühlen nachgeben, ohne in die Gefahr zu kommen, gegen die Gebote der Moral zu verstoßen. Auf die Vernunftkontrolle zu verzichten scheint aber fast allen zu riskant, da dann in gefühlsbetonter Maßlosigkeit der Verlust aller Selbstbeherrschung drohe.