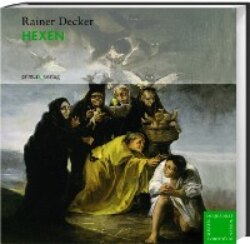Читать книгу Hexen - Rainer Decker - Страница 8
DAS ANTIKE ERBE
ОглавлениеDer Alte Orient
Die ältesten kulturellen Wurzeln Europas liegen außerhalb: im Vorderen Orient, in Ägypten, Israel und Mesopotamien, insbesondere in der jüdischen Religion und dem daraus entstandenen Christentum. Israel war seinerseits vielfältigen Einflüssen der Hochkulturen am Nil und an Euphrat und Tigris ausgesetzt. Schon einige der frühesten Schriftzeugnisse der Menschheit, babylonisch-assyrische Keilschrifttexte, haben die Bekämpfung von gesundheitsschädlichem Zauber zum Thema.
Trotz des sich durchsetzenden Monotheismus gab es im alten Israel einen vielfältigen Dämonenglauben. Damit verwandt war der Glaube an die Kraft der Toten, die Möglichkeit, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und von ihnen zu profitieren. In einem benachbarten Kulturraum, dem der alten Griechen, ist ein berühmtes Beispiel dafür die Reise des Odysseus in den Hades, das Totenreich, wo er die Seelen der Verstorbenen, so seiner Mutter und des Achill, trifft, bevor ihm die Seele des blinden Sehers Teiresias die Rückkehr ins heimische Ithaka weissagt.
Für die spätere christliche Diskussion war die Bibel wichtiger als der heidnische Mythos. Hinsichtlich Totenbeschwörung und Magie bietet dabei die Begebenheit um Saul und die „Hexe von Endor“ einen Anhaltspunkt (1 Sam 28): König Saul ist in Bedrängnis, weil ihm das Heer der Philister zusetzt und ihm Gott die Hilfe versagt. Sauls großer Ratgeber, der Prophet Samuel, ist gerade verstorben. So sucht er nach einer Möglichkeit, mit dem Toten in Verbindung zu treten, obwohl er selbst Geisterbeschwörung und Zeichendeuten verboten hatte: „Als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich … Und er befragte den Herrn; aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch das Los … Da sprach Saul zu seinen Getreuen: ‚Sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und diese befrage.‘ Seine Männer sprachen zu ihm: ‚Siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören.‘“ Die Frau weigert sich erst, weil sie die Bestrafung fürchtet, lässt aber schließlich Samuel aus der Unterwelt aufsteigen. Dieser prophezeit Saul, er werde gegen die Philister die Schlacht und das Leben verlieren. Sein Nachfolger im Königtum werde David; und so erfüllt sich die Weissagung.
Das angesprochene Verbot der Geisterbeschwörung hat seine Grundlage im 3. Buch Moses, wo es heißt: „Wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten kann, so sollen sie des Todes sterben; man soll sie steinigen; ihre Blutschuld komme über sie“ (Lev 20, 27). Christliche Hexenverfolger beriefen sich auf die berühmte Stelle im 2. Buch Moses (Ex 22, 17), die Martin Luther so übersetzte: „Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.“ Der Begriff im Originaltext, Mechaschepha, meint eindeutig Frauen. In der für die katholische Kirche maßgeblichen lateinischen Übersetzung aus der Spätantike, der Vulgata, steht dagegen: maleficos non patieris vivere – die Zauberer sollst du nicht leben lassen. Korrekt hätte dort maleficas stehen müssen. Die Fokussierung auf die weibliche Hexe blieb in der jüdischen Tradition erhalten. Der Begriff ist aber noch nicht so scharf definiert wie seit dem europäischen Spätmittelalter, sondern bezieht sich auf magische Rituale aller Art.
Im Neuen Testament werden Frauen nicht mit Magie in Verbindung gebracht. Dem neugeborenen Jesus huldigen männliche Magier (magoi), die weisen Sterndeuter aus dem Osten, die später zu Heiligen Drei Königen umgedeutet wurden. An vielen Stellen der Evangelien und der Apostelgeschichte kommen böse Geister vor, stumme oder redende. Jesus treibt sie aus und gibt diese Macht weiter: „Und er rief die Zwölf zu sich und hob an und sandte sie je zwei und zwei und gab ihnen Vollmacht über die unsauberen Geister … Sie gingen aus und predigten, man sollte Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund“ (Mk 6, 12). Auch Paulus verfügt über diese Gabe des Exorzismus.
AUSTREIBUNG DES BÖSEN
Exorzismus „ist die rituelle Vertreibung od. Verbannung böser Mächte od. Geister aus Personen, Lebewesen od. Gegenständen“ (kath. Lexikon für Theologie und Kirche). Im Neuen Testament wird an zahlreichen Stellen berichtet, dass Jesus Dämonen ausgetrieben und diese Fähigkeit den Aposteln verliehen habe. Die geistige Grundlage des Exorzismus ist der Glaube, dass es den Teufel als Person gibt (oder mehrere Teufel) und er von einem Menschen Besitz ergreifen, ihn „besessen“ machen kann.
Der Exorzismus wird in der katholischen Kirche von einem Priester, der heutzutage eine ausdrückliche Vollmacht seines Bischofs haben muss, vollzogen, indem er in Gebeten und rituellen Handlungen (z. B. Segnen mit Weihwasser) die Kraft Gottes zur Austreibung des Bösen anruft und dem Teufel befiehlt, den Besessenen zu verlassen. Hexen und Besessenen ist eine enge Verbindung mit dem Teufel gemeinsam. Der Unterschied besteht darin, dass Hexen sich freiwillig, wenngleich dazu verführt, mit dem Teufel einlassen, wogegen Besessene seiner Macht ausgeliefert sind. Während der Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit war der Glaube verbreitet, dass Hexen unschuldigen Menschen den Teufel in den Leib gezaubert hätten.
Die Römer
Wie andere Kulturen verstanden Griechen und Römer unter Magie im Wesentlichen zweierlei: Zum einen Divination, die Seher-Kunst, mithilfe der Götter und besonderer Kenntnisse und Begabungen Verborgenes und Zukünftiges zu erkennen, und zum Zweiten geheimen Zauber zu guten oder bösen Zwecken.
Schwarze Magie, also Schadenszauber, wurde von der Gesellschaft missbilligt und unterlag Sanktionen. So bereits in dem ältesten römischen Rechtsdokument, dem Zwölftafelgesetz aus der Frühzeit der Republik: „Es soll keiner nicht in seinem Besitz befindlichen Feldertrag heraussingen.“ Heraussingen bedeutet: mithilfe von Zaubersprüchen entwenden und sich aneignen. Darauf stand die Todesstrafe. Magie konnte sich auch gegen Gesundheit und Leben richten. In der Zeit der Bürgerkriege am Ende der Republik erließ der Diktator Sulla ein Gesetz De sicariis et veneficis, gegen Meuchelmörder und Giftmischer. Dolch und Gift sind hier die heimtückischen Mittel eines plötzlichen Todes. Wo Gift gebraucht wurde, war Magie nicht weit, insbesondere dann nicht, wenn keine äußere Ursache des Schadens zu erkennen war. Tragische Zufälle und naturwissenschaftliche Kausalität gibt es in diesem Denken nicht. Hinter den Ereignissen ist eine Absicht verborgen. Zum Beispiel die Strafe der Götter für Fehlverhalten. Dies würde die Anerkennung eigener Schuld bedeuten, was bekanntlich schwer fällt. Einen Ausweg bildet die Annahme eines Anschlags, einer Verschwörung. So war der Schmerz ehrlich und tief, den römische Eltern auf dem Grabstein ihres Kindes ausdrückten: „Mich entriss eine Hexe mit grausamer Hand. Überall, wo sie sich auf Erden aufhält und mit ihrer Kunst Schaden anrichtet, passt auf eure Kinder auf, Eltern, damit nicht der ganze Schmerz das Herz erfasst.“ Der Text zeigt, dass die vermeintlichen Opfer sich nicht völlig hilflos den bösen Mächten ausgeliefert sehen. Es gibt Möglichkeiten, ihnen zu entkommen oder ihnen Widerstand zu leisten, auf dem Rechtsweg oder vorbeugend durch ein Amulett.
Der Verdacht, Magie sei im Spiel, war zu keinen Zeiten eine bloße Schimäre. Aus der römischen Antike haben sich zahlreiche Fluchtäfelchen erhalten. Auf Papyrus geschrieben, sollten sie in den Konflikten des Alltags helfen: bei Prozessen, im Geschäftsleben, in Liebessachen, gegen Diebstahl und üble Nachrede, überhaupt im Konkurrenzkampf, zum Beispiel beim Pferderennen: „Binde ihnen [den Pferden] den Lauf, die Beine, den Sieg, die Kraft, den Mut, die Geschwindigkeit, mach sie verrückt, ohne Muskeln, ohne Glieder, damit sie morgen im Hippodrom nicht laufen, nicht gehen, nicht siegen, die Starttore nicht verlassen, die Zielsäule nicht umrunden können, damit sie vielmehr mit ihren Lenkern stürzen … Binde ihnen [den Lenkern] die Hände, nimm ihnen den Sieg, die Sicht, damit sie ihre Gegner nicht sehen können, reiße sie von ihren Wagen und schleudere sie zu Boden, damit sie überall im Hippodrom stürzen, vor allem aber an den Zielsäulen, zusammen mit ihren Pferden.“ Angesichts dieses real praktizierten Zaubers werden die entsprechenden Anklagen nachvollziehbar. Aus der Kaiserzeit hat sich eine Gerichtsrede erhalten, in der sich der Jurist und Dichter Apuleius gegen den Magievorwurf zur Wehr setzt. Als junger Mann hatte er eine wesentlich ältere, vermögende Witwe geheiratet. Deren Verwandtschaft entging damit ein reiches Erbe, was Ärger und Neid erregte. Schnell war man mit dem Vorwurf zur Hand, Apuleius sei ein Magier und Giftmischer (magus et veneficus). Dafür gab es Anhaltspunkte. Unter anderem warf man ihm vor, instrumenta magica, Geräte für magische Zwecke, zu besitzen. Der Angeklagte gab offen zu, es handele sich um Objekte verschiedener Mysterienkulte. In dieser Zeit, Mitte des 3. Jahrhunderts, konnte er sich offensichtlich vor Gericht gefahrlos auf Kontakte zu neuen, aus dem Osten einströmenden Religionen berufen.
In den letzten Jahrhunderten der Republik wäre dies riskant gewesen. Denn am Anfang des 2. Jahrhundert v. Chr. war Rom von einem Skandal erschüttert worden. Von Wanderpriestern war aus dem östlichen Mittelmeerraum ein Mysterienkult in Rom verbreitet worden. Diese Bewegung im Untergrund der römischen Gesellschaft trat eine Lawine von Gerüchten los. Die Teilnehmer nähmen an bacchanalia teil, Verräter würden ermordet, in großem Umfang werde Gift zur Erreichung finsterer Zwecke gebraucht, überhaupt wolle man die Grundlagen des Staates unterwandern. Der Vorwurf des Hochverrats und die Angst, mit den normalen Gesetzen der angeblichen Verschwörung nicht Herr zu werden, führten im Jahre 186 v. Chr. zu dem Senatus consultum de bacchanalibus, einem Senatsbeschluss, durch den die Konsuln Sondervollmachten erhielten und der den Teilnehmern die Todesstrafe androhte. Tatsächlich wurde durch diese drakonischen Maßnahmen die Verbreitung östlicher Mysterienkulte gestoppt. Erst in dem ruhigeren gesellschaftlichen Klima der Kaiserzeit konnten sie sich wieder entfalten. So wurde auch Apuleius vor Gericht freigesprochen – nicht nur wegen der Toleranz gegenüber neuen Bewegungen, sondern auch, weil es in Rom keine panikartige Angst vor Magie gab. Schadenszauber war verboten, aber spektakuläre Massenverfolgungen gab es nicht – mit einer Ausnahme: den Christen des 2. Jahrhunderts. Ihnen warf man zwar nicht Zauberei vor, aber im Übrigen kehrt hier die Verschwörungsfurcht der späten Republik zurück. Die Sektenmitglieder träfen sich heimlich zu nächtlichen Orgien, planten dort Anschläge gegen Staat und Gesellschaft und, noch über frühere Schreckensbilder hinausgehend, man schlachte kleine Kinder, um sie rituell zu verspeisen. Darin schlägt sich eine Fehldeutung der Messe und des eucharistischen Mahls mit dem in Leib und Blut Jesu Christi verwandelten Brot und Wein nieder. Im 3. Jahrhundert, mit besserer Kenntnis des Christentums, hörten zwar diese Vorwürfe auf. Die Anklage konzentrierte sich nun auf die Ablehnung des Kaiserkultes, aber es ist auffällig, dass rund 1000 Jahre später das Schreckbild einer staats- und religionsfeindlichen Sekte, die Kannibalismus und Kindermord praktizierte, innerhalb der christlichen Kirche selbst wiedererstehen sollte. Denn auch den Hexen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit warf man solche Kapitalverbrechen vor.
Bis dahin war noch ein weiter Weg. Die Gesetzgebung der römischen Kaiser kannte keine Hexen im späteren Sinne. Die Magieparagraphen richteten sich gegen Giftmischerei und verbotene, also nicht von den staatlichen Priestern praktizierte Wahrsagekunst. Kaiser Antoninus Pius (reg. 138–161) verkündete: „Es ist schlimmer, einen Menschen mit Gift zu ermorden als mit dem Schwert zu töten“ – mit Gift, das bedeutet in jedem Fall: heimtückisch, ein Wehrloser wird ermordet.
Die Folter durfte im Strafverfahren gegen freie römische Bürger nur in Ausnahmefällen angewandt werden. Sie schloss aber Magier ein, was zeigt: Dieses Delikt wurde als besonders gefährlich angesehen. Darunter verstand man auch artem geometriae (Astrologie und verwandte Künste). Sie wurde um 300 von den Kaisern Diokletian und Maximian verboten. Damit ist selbstverständlich nicht die von den staatlichen römischen Priestern offiziell ausgeübte Divination gemeint, sondern die von Privatleuten. Diese Bestimmungen nicht-christlicher Kaiser wurden von ihren getauften Nachfolgern übernommen und ergänzt. Einem haruspex oder sacerdos, einem Weissager oder Priester, der die verbotenen Künste (z. B. Traumdeutung) ausübte, wurde Tod durch Verbrennen angedroht. Wer seine Dienste in Anspruch nahm, musste in die Verbannung gehen, und das Honorar fiel an den Fiskus.
Auch diese Sonderbestimmungen im Verfahren und beim Strafmaß (Folter, Todesstrafe, Scheiterhaufen) nahmen spätmittelalterliche Tendenzen in der Rechtslehre vorweg. Eine andere Frage ist, in welchem Umfang diese Normen im römischen Staat Anwendung fanden, also verbotene Magie praktiziert wurde und mit welcher Schärfe der Staat dagegen vorging. Dies ist erst wenig erforscht.