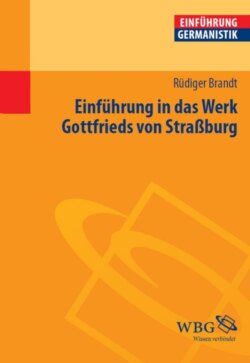Читать книгу Einführung in das Werk Gottfrieds von Straßburg - Rüdiger Brandt - Страница 9
III. Der Autor und sein Werk 1. Biographische Fragmente und puzzles
ОглавлениеHilfsdatierungen
Mittelalterliche Autoren selbst liefern nur spärliche Informationen über ihr Leben, und es gab keine Instanzen, die solche Daten systematisch dokumentiert hätten. Das hängt damit zusammen, dass der mittelalterliche Autor, selbst wenn er erfolgreich ist, noch nicht das Prestige des ‚Dichters’ späterer Zeiten besitzt. Nur selten und dann gebunden an bestimmte Kontexte findet man biographisch verwertbare Informationen. Autoren selbst erwähnen sich häufiger gegenseitig. Biographisch ist der Ertrag meist gering; je nach Erwähnung eines Autors als noch lebend oder tot kann man aber zumindest zu Hilfsdatierungen gelangen. Interessanter ist, dass solche Erwähnungen oft Wertungen enthalten, die Ersatz für eine noch nicht vorhandene volkssprachliche Literaturtheorie bieten. Wenn man über einen Autor biographisch wenig weiß, stellt schon seine zeitliche Einordnung ein Problem dar. Anhaltspunkte muss man sich neben den o.a. Erwähnungen bei anderen Autoren aus Rekursen etwa auf historische Ereignisse in den Texten zusammensuchen. Meist kommt man nicht über einen terminus post quem (Zeitpunkt, nach dem ein Werk verfasst, sein Autor geboren oder gestorben sein muss) oder das Gegenteil, einen terminus ante quem, hinaus. Gottfried gehört zu den mittelalterlichen Autoren, über die Auskünfte besonders dünn gesät sind. Er selbst nennt im Tristan nicht einmal seinen Namen; vielmehr ist dieser versteckt und in verstümmelter Form nur in einem Akrostichon zu finden. Ansonsten kennt man seinen Namen aus Nennungen bei anderen Autoren:
| Autor/Text | Information |
| Rudolf von Ems, Alexander (beend. nach 1243) | lobende Erwähnung des wise[n] Gotfrit von Strazburc als Tristan-Autor; Zuschreibung und Zitierung eines Sangspruchs ‚Vom gläsernen Glück’ |
| Rudolf von Ems, Willehalm von Orlens(zwischen 1235 und 1243) | lobende Erwähnung maister Goetfrides von Strazburc und seines Tristram (so!) |
| Konrad von Würzburg, Herzmaere (um 1260?) | inhaltliche Berufung auf Gottfried für den Gedanken, dass Lektüre von Liebesdichtung den rechten Weg zur Liebe weise |
| Konrad von Würzburg, Die goldene Schmiede (vor 1287) | lobende Erwähnung von Strazburc meister Gotfrit[s] als unerreichbares Vorbild |
| Konrad von Stoffeln, Gauriel von Muntabel (nach 1250) | neutrale Erwähnung (meister Gotfrit hat – wie andere – nichts über den Ritter geschrieben, über den Konrad berichtet) |
| Heinrich von Freiberg, Tristan-Forts. (um 1280/90?) | – Lob meister Gotfrit [s] von Strazburc, dessen Können Anlass für (topische) Selbstzweifel ist – bei Erwähnung der Minnegrotte: die fossiuren/die meister Gotfrit hat genant/la fossiure a la gentamant |
| Ulrich von Türheim, Tristan-Forts. (vor 1243) | Klage über den Tod meister Gotfrit[s], der als Grund für die Nichtfertigstellung des Tristan gesehen wird; emphatisches Lob |
| Johann von Würzburg, Wilhelm von Österreich (beend. 1314) | lobende Erwähnung als unerreichbares Vorbild (awe zarter maister clar/genender Strazburger/Goetfrid ein guot tihter usw.) |
| Manessische Liederhandschrift (Minnesang-Sammelhs. C; entst. ab ca. 1300 entst.) | drei Lieder (Minnelied, Marienlob, religiös-didaktisches Lied Von der Armut; s. Kap. IV) mit vorangestelltem Autorbild; Überschrift Meister Goetfrit von Strasburg |
| Kleine Heidelberger Liederhandschrift (Minnesang-Sammelhs. A; etwas älter als C) | ein Minnelied (dass., das auch in C überliefert ist, aber mit einer Strophe weniger), Überschrift Gotfrit von Strasburc |
| Wolfram von Eschenbach, Parzival (um 1200/1210) | Lieferung eines terminus post quem (falls die Kritik in Gottfrieds Literaturexkurs auf den Parzival bezogen ist) |
Erwähnungen Gottfrieds gibt es noch bis ins 15. Jh. (Ulrich Füetrer, Jacob Püterich von Reichertshausen), sie fügen an Informationen nichts hinzu. Die groben Datierungen lassen sich verfeinern durch Hinweise auf Tristan-Rezeption in Werken anderer Autoren; eine solche Rezeption ist zeitnah nachweisbar in Rudolfs von Ems Der gute Gerhard, wodurch man einen terminus ante quem von etwa 1220 gewinnen könnte. Problematisch ist, dass die Datierung anderer Werke auch selten fest steht – Datierungen bewegen sich also z.T. im Kreis. Das gilt im Fall Gottfrieds auch aus umgekehrter Perspektive, nämlich für seine Nennung lebender (Bligger von Steinach, Hartmann von Aue, Walther von der Vogelweide) und verstorbener Autoren (Heinrich von Veldeke, die Nachtigall ‚von Hagenau’ [= Reinmar der Alte]) im Literaturexkurs des Tristan. Hinzu kommt an Informationen’ im Tristan im Prolog-Akrostichon die Erwähnung eines DIETERICH. Hinter diesem vermutet man einen Auftraggeber. Um die Wende vom 12. zum 13. Jh. sind aber in Straßburger Urkunden mehrere Personen dieses Namens nachweisbar; für keinen von ihnen hat man Hinweise gefunden, die eine genauere Zuordnung ermöglichen.
Die wenigen Fakten
Greifbar ist also nur Folgendes: Der Name ‚Gottfried’ (in Schreibvarianten) für den Verfasser des Tristan und lyrischer Texte steht fest. Der Zusatz ‚von Straßburg’ ist gut belegt – ob er den Herkunfts- oder den Wirkungsort bezeichnet, ist nicht feststellbar. Die dialektalen Kennzeichen des Tristan sind mit der regionalen Zuordnung vereinbar. Eine Datierung des Tristan auf um 1210/15 ist plausibel. Für den Tristan lässt sich ein Auftraggeber Dieterich vermuten; dieser ist jedoch nicht identifizierbar. Dass der Auftraggeber in Straßburg ansässig war, ist nicht zu beweisen; es käme auch eine Zugehörigkeit zum Adel in der Umgebung der Stadt in Frage. Ein Epos vom Umfang des Tristan ist aber in dieser Zeit nur als Auftragswerk denkbar. Über eine literarische Szene in Straßburg im 12. und 13. Jh. weiß man wenig (anders als z.B. in Bezug auf Basel, Zürich oder einige Adelshöfe). Literatur steht aber im Mittelalter immer im allgemeinen Kontext repräsentativer Funktionen und spielt dort bis ins 15. Jh. eine herausgehobene Rolle. In Straßburg bzw. an den adligen Höfen der Umgebung muss es daher in gewissem Umfang ein literarisches Leben gegeben haben – über Spezifika, etwa Gattungsvorlieben, liegen keine Kenntnisse vor. Der von Rudolf von Ems als eine Art Literaturkenner erwähnte maister Hesse/von Strasburg der scribaere (Willehalm von Orlens 2280f.) ist mit Sicherheit ein Indikator für ein solches literarisches Leben; aber auch hier ist die Aussagekraft beschränkt: Der Passus steht im Zusammenhang eines Räsonnements des Erzählers über die eigene literarische Leistungsfähigkeit. Es geht um die Frage, ob der Dichter den von anderen Vertretern des Metiers gesetzten Qualitätsmaßstäben gerecht werden kann. Hesse ist Bestandteil eines langen Namenskatalogs; als Autor eines Werkes wird er nicht erwähnt. scribaere meint mehr als den technischen’ Schreiber: Wer im Mittelalter professioneller Schreiber ist, gehört zum Stand der Gebildeten und verfügt auch über literarische Kenntnisse, weil zu seiner Tätigkeit z.B. das Abschreiben anderer Texte gehört. Man glaubt, Hesse mit dem Straßburger Stadtschreiber und Vorsteher der Stadtkanzlei Hesso notarius burgensium (drei urk. Belege aus den Jahren 1233 und 1237) identifizieren zu können, der von der Forschung in Beziehung zu Rudolf von Ems und Konrad von Winterstetten (Auftraggeber des Tristan-Fortsetzers Ulrichs von Türheim, Großvater des Minnesängers Ulrich von Winterstetten) gesetzt wurde. Hesso soll auch Leiter einer Schreibstube gewesen sein, in der eine Parzival-Hs. und die Hs. M des Tristan entstanden sind. Gleichgültig, wie viel davon im Einzelnen stimmt, verfügt man damit doch über ein Beispiel für die Kontakte Straßburger Führungsschichten mit Literatur. Denn als Stadtschreiber stand Hesso auch in politischen Kontexten, was Beziehungen zu potenziellen Auftraggebern impliziert. Das wirft ein Schlaglicht auf literatursoziologische Konstellationen in Straßburg und Umgebung, aber mehr nicht.
Die historische Person Gottfried von Straßburg liefert also keine Hilfe bei der Interpretation seiner bzw. der ihm zugeschriebenen Texte. Bei dem Versuch, umgekehrt aus den Texten Informationen über den Autor zu destillieren, ist man heute vorsichtig geworden: Die Einführung der Kategorien Rollen-Ich’ und ‚Erzähler’, die beide nicht identisch sind mit dem biographischen Autor, verbietet eine Auffassung des in Texten Geäußerten als ‚Meinung’/,Lebenseinstellung’/,Konzept’ usw. des Autors. So gewinnt man aus Äußerungen des Erzählers in der Minnegrotten-Episode des Tristan über sein eigenes ‚jugendliches Liebesleben’ keine biographischen Informationen, da es sich um ein lediglich prätendiert biographisches Spiel handeln kann. Möglich sind jedoch Befunde zu Gottfrieds Bildung, in Zusammenhang damit mit einiger Einschränkung auch zu seinem Stand: In den o.a. Quellen wird Gottfried positiv bewertet, als wise (klug, schriftliterarisch gebildet) bezeichnet und als meister tituliert. Mhd. meister, kontrah. aus lat. magister, meint einen akademischen Titel, den man an einer Hochschule erwerben kann, oder ist ein lobendes Epitheton, das die besondere Könnerschaft einer Person in einem bestimmten Metier hervorhebt, und zwar schon vor der Institutionalisierung des Titels im handwerklichen Bereich vor allem in Bezug auf Wissen und poetische Qualifikation. In der Liederhs. C werden außer Gottfried noch als meister tituliert Teschler, Hadlaub, Konrad von Würzburg, Frauenlob, Friedrich von Sonnenburg, Sigeher, Rumslant. Nicht bei allen Genannten wird der meister-Titel auch sonst verwendet; umgekehrt findet sich anderwärts die Bezeichnung auch für Autoren, die in C nicht so benannt werden. Ob Gottfried einen Magister-Titel an einer Hochschule erworben hat, weiß man nicht; denkbar wäre als Ausbildungsort auch eine kirchliche Bildungseinrichtung in Straßburg oder Umgebung. Daher kann das meister-Epitheton Anerkennung von Kennerschaft und Könnerschaft ohne Bezug auf den institutionell-universitären Bereich ausdrücken. Denn die Tatsache, dass Gottfried überhaupt Verfasser (zumindest) des Tristan ist, setzt schon schriftliterarische Bildung voraus. Seit der 1. Hälfte des 13. Jhs. wird meisterschaft/meisterschefte besonders im Bereich der Sangspruchdichtung zu einem Konstituens künstlerischen Selbstbewusstseins, mit dem eine Abgrenzung des schreib- und lesefähigen Autors von nicht gebildeten, allenfalls rudimentär literarisierten Konkurrenten stattfindet. Das ist rückgebunden an die Implikationen des Schreibens und Lesens. Lesen macht Stoffe und Vorlagen zugänglich; Gottfrieds Quellenkritik im Tristan-Prolog oder seine Kritik an zu fabulösen Motiven wurde erst möglich durch die Kenntnis mehr als einer Tristan-Fassung; das, was er im Literaturexkurs über Autoren äußert, setzt Vertrautheit mit Texten und literarischen Entwicklungen voraus. Und im Rahmen des Schreiben-Lernens erwirbt man die Fähigkeit, insbesondere den Ornatus, den dichterischen Schmuck, zu verfeinern und auszubauen. Beides fließt ineinander, indem das Lesen von Texten rhetorische Vorbilder liefert, aber auch Inhalte, die eine Anreicherung der Texte über deren Kerninhalt hinaus ermöglichen. Eine solche ist Demonstration des eigenen Bildungshorizontes und führt zu einem wissenschaftlichen Mehrwert’ für das Publikum: Epen erzählen nicht nur eine spezifische Handlung, sondern bieten auch allgemeines ‚Weltwissen’, das der Handlung zusätzliche Perspektiven verleiht; lehrhafte Sangsprüche binden ihren jeweils speziellen Lehrgegenstand in einen größeren Komplex von ‚Weisheit’ ein.
artes liberales
Der Tristan beweist über schriftliterarische Grundfertigkeiten hinaus besondere Fähigkeiten im Bereich des Triviums, aber auch Kenntnisse in weiteren Fächern der septem artes liberales sowie im Bereich der aktuellen Poetik. Im 12. und 13. Jh. sind eine Reihe neuer Poetiken erschienen. Zwei Verfasser, Matthäus von Vendôme und Galfredus de Vino Salvo, sind Zeitgenossen Gottfrieds; an eine Galfredus-Rezeption wäre zu denken im Zusammenhang mit dessen Konzept des Dichters als Architekt (Minnegrotte) und der Herausstellung der Bearbeitungstechniken von abbreviatio (Kürzung) und dilatatio/amplificatio (Erweiterung); auch Gottfrieds Ansätze zur Quellenkritik im Tristan-Prolog könnten durch entsprechende Maximen in neueren Poetiken angeregt worden sein. Dass Gottfried angesichts seiner Vorlage über frz. Sprachkenntnisse verfügt hat, ist möglich, war aber für eine Bearbeitung nicht notwendig: Es gibt Fälle, in denen Bearbeiter sich der Hilfe eines Übersetzers bedient haben. Andererseits flicht Gottfried in den Tristan relativ viele frz. Wendungen ein, so dass eine über Grundkenntnisse hinausgehende Vertrautheit vorhanden gewesen sein könnte. Lateinkenntnis ist auf jeden Fall vorauszusetzen, da das Studium der septem artes schon auf der Stufe des Triviums mit lateinischer Lektüre verbunden war. Unter den Schulautoren – einen festen Kanon gibt es nicht, dafür aber breite Überschneidungsbereiche – befinden sich solche, die formal und stofflich einflussreich waren, antike, spätantike und mittelalterliche. Angesichts der Verbreitung ihrer Schriften muss eine Rezeption nicht immer direkt erfolgt sein, und aus dem freien Umgang mit den Quellen können durchaus verschiedene Ausprägungen eines Autors bzw. Œuvres als Vorlage resultieren (vgl. etwa die Ovid-Interpretation der Schule von Chartres). Zur Bildung des Autors Gottfried gehört auch die Kenntnis deutschsprachiger Literatur: Wer auf Deutsch für ein sozial hochstehendes Publikum schreibt, muss, wenn er den Ansprüchen eines Auftraggebers entsprechen will, über inhaltliche und sprachliche Muster verfügen. Mit dem Tristan bewegt Gottfried sich innerhalb einer seit Heinrichs von Veldeke Eneit (beend. 1187/89) fortlaufenden Tradition neuer höfischer Epik. Bei den unsicheren Werken wäre für das Minnelied zu verweisen auf die Richtung des ‚hohen Minnesangs’ (seit ca. 1170); das Marienlob steht zwar einerseits in mittellateinischen Traditionen, konnte sich aber zur Zeit Gottfrieds auch schon auf einen Fundus deutschsprachiger Texte des Genres stützen.
Bildung und Stand
Unter dem Aspekt seiner Schichtzugehörigkeit ist Gottfried also Mitglied der Bildungselite – was nach mittelalterlichen Maßstäben für eine soziale Verortung nicht genügt: Nicht die Bildung definiert einen Menschen sozial, sondern seine Zugehörigkeit zu einem Stand, denn nur dieser regelt die Rechte und Pflichten einer Person und ordnet sie in die Gesellschaft ein. Gottfried war wohl kaum Niederadliger oder Ministeriale; bei seiner relativen Bekanntheit wäre es sonst seltsam, dass nirgendwo diesbezügliche Hinweise zu finden sind. Im Autorbild der Manesse wurde ihm auch kein Wappen zugeordnet. Von den o.a. in C als meister Bezeichneten fehlen nur noch bei Konrad von Würzburg, Sigeher und Rumslant Wappen, während Teschler, Hadlaub, Frauenlob und Sonnenburg eines beigegeben worden ist. Boppe, der Schmied gewesen sein soll, hat ein Wappen bekommen, desgleichen der sog. Tugendhafte Schreiber, der wegen seiner Berufsbezeichnung auch kaum als Adliger gegolten haben dürfte. Weder schließt also der meister-Titel eine Vorstellung eines Autors als adlig aus, noch beweist die Beigabe eines Wappens den Adelsstatus. Gottfrieds Bildung, die eine klerikale Ausbildung voraussetzt, lässt aber auch keinen sicheren Schluss auf klerikalen Status zu. Es ist nicht selten, dass jemand für eine klerikale Laufbahn bestimmt war, eine entsprechende Ausbildung genossen hat, dann aber doch nicht ordiniert wurde bzw. sich hat relaikalisieren lassen. Sollte Gottfried jedoch Kleriker gewesen sein, muss man sich ihn nicht unbedingt als Inhaber einer Pfarrstelle, Hofkaplan o.Ä. vorstellen: Seine Ausbildung hätte auch Grundlage dafür sein können, ihn in sonstigen Funktionen einzusetzen. Für die Frage nach der intellektuellen Sphäre, in der Gottfried sich bewegte und die Grundlage seiner Dichtung war, ist dies unerheblich: Alle genannten Tätigkeiten gründen auf Schreib- und Lesekenntnissen, alle führen daher auch zu den erwähnten Auswirkungen dieser Kenntnisse auf die eigene literarische Tätigkeit.
Einzugehen ist noch auf mögliche Zusammenhänge bestimmter Inhalte des Tristan und der beiden religiösen Lieder mit der Stadt. Der Beiname ‚von Straßburg’ verweist ja auf ein städtisches Umfeld. Für ein solches ergäbe sich bei den religiösen Liedern ein spezieller Resonanzraum, da sich die Stadt ab dem 13. Jh. neben den literarischen Zentren Kloster und Adelshof zu einem breiteren Rezeptionsumfeld für Literatur entwickelt, in dem religiöse Texte eine besondere Rolle spielen. Solche erlebten seit etwa 1220 einen Aufschwung durch die Intensivierung der Seelsorge in den Städten, und in diesem Rahmen besaß Literatur eine wichtige Funktion. Das Spektrum der Texte ist breit; es reicht von katechetischen Anweisungen über Legenden bis zur emotional-psychologisierenden Evozierung bestimmter Frömmigkeitshaltungen. In diesen Kontext fügen sich auch das Marienlob und das Lied von der Armut ein – aber das ist noch kein Beweis für ihre Entstehung in der Stadt, da entsprechende Texte sich natürlich nicht nur dort lokalisieren lassen (in der religiösen Lyrik an Adelshöfen etwa war Marienlyrik zeitweise dominant).
Städtische Bezüge?
Im Fall des Tristan gibt es vor allem zwei inhaltliche Bestandteile, die dazu geführt haben, eine besondere Aktualität in der Stadt bzw. speziell in Straßburg anzunehmen:
1. An einigen Textstellen werden Kaufleute erwähnt. So wird Tristan von Kaufleuten entführt, spielt aber auch, um seine Identität zu verbergen, die Rolle eines Kaufmanns und stellt sich in Irland mit den Worten vor (8800ff./Ranke, 8804ff./Marold): wir sîn werbende liute/und mugen uns des niht geschamen./koufliute heizen wir binamen (‚Wir sind Leute, die sich um Kunden bemühen, und haben keine Ursache, uns deswegen zu schämen. Deshalb bezeichnet man uns als Kaufleute.’ Übersetzungen in einfachen Anführungszeichen von mir; R. B.). Kaufleute, insbesondere Fernhändler, spielen in den größeren mittelalterlichen Städten eine wichtige Rolle. Das Zitat drückt ein gewisses Selbstbewusstsein aus – aber das gehört zur Rollenfiktion Tristans. Die Wertschätzung kann also nicht unbedingt als allgemeines Lob verstanden werden, zumal die einzigen Akteure im Tristan, die tatsächlich Kaufleute sind, eine negative Rolle spielen. Um ein Identifikationsangebot kann es sich also wohl kaum handeln, jedenfalls nicht, wenn der Auftraggeber des Tristan aus den Kreisen der hohen Geistlichkeit oder der Adels stammt. Man wird dann nur von einer bloßen Reminiszenz an etwas ausgehen können, das zum Erfahrungsbereich von Menschen gehört, die in Städten leben. Dass Tristan sich als Kaufmann verkleidet, macht auf der Textebene Sinn, weil zu den Kennzeichen dieses Standes die Mobilität gehört; damit wird ein Erscheinen an fremden Orten plausibel. Das ist aber bei Spielleuten genauso der Fall, und Tristan agiert ja auch als ein solcher. Daher findet man in anderen Texten ebenfalls solche Rollenübernahmen, wenn es darum geht, die eigene Identität zu verbergen und einen Aufenthalt an Orten, an denen man unbekannt ist, zu begründen. 2. In eine andere Kategorie gehört das betrügerische Gottesurteil im Tristan; hier hat man gemeint, Anspielungen auf einen Fall aus der Straßburger Geschichte sehen zu können: Gottesurteile waren in der Kirche umstritten, Ende des 12. Jhs. dominierten die ablehnenden Stimmen, was 1215 zu einem Verbot durch das IV. Laterankonzil führte. Der Straßburger Bischof Heinrich von Veringen dagegen gehörte zu den Befürwortern und erhielt 1212 eine Mahnung Papst Innonenz’ III., keine gottesgerichtlichen Prozeduren mehr anzuwenden (speziell erwähnt wird u.a. das iudicium ferri, die Eisenprobe, um die es sich auch im Gottfriedschen Tristan handelt). Anlass für diese Mahnung könnte ein Straßburger Ketzerprozess von 1211/12 gewesen sein, dessen Verlauf die Kritik an der Zuverlässigkeit von Gottesurteilen bestätigte. Unabhängig von der genauen Datierung des Tristan bietet für die Zeitgenossen die Darstellung eines Gottesurteils, vor allem aber Gottfrieds Kommentar aktuelle Assoziationsmöglichkeiten: Kuriales Verbot, Mahnschreiben an den Bischof und Prozess sind nur Schlusspunkte einer länger andauernden und öffentlichkeitswirksamen Diskussion. Gottfried muss sich dieser Aktualität bewusst gewesen sein (auch wenn betrügerische Gottesurteile in Literatur außerhalb des Tristan-Stoffs ebenfalls vorhanden sind).
Die Kaufmannsthematik fügt sich also in ein städtisches Umfeld ein, das Gottesurteil in eine historische Phase der Stadt Straßburg. Das macht den Tristan noch nicht zu städtischer Literatur – und schon gar nicht zu ‚bürgerlicher’; beides ist nämlich angesichts der Heterogenität der mittelalterlichen Stadtbevölkerung und ihrer Wertvorstellungen noch nicht identisch. Höfische Literatur bedient auch in der Stadt traditionelle Adelsinteressen. Die gleiche Einschränkung gilt für andere Textaspekte wie die Herausstellung von Rationalität, Langzeitplanung, Psychologisierung oder die Aufstiegsthematik; auch dies und noch mehr ‚passt’, aber es ist nicht dezidiert stadtbürgerlich.