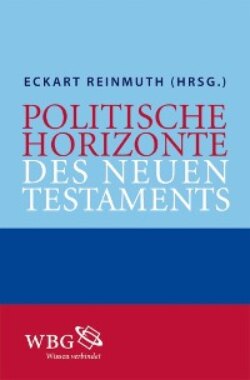Читать книгу Politische Horizonte des Neuen Testaments - Reiner Anselm - Страница 9
Der Politikbegriff der neutestamentlichen Wissenschaft in Deutschland
Оглавление(1)Die folgenden Überlegungen analysieren zunächst die wissenschaftsgeschichtlichen Rahmenbedingungen, die das Politikverständnis der deutschsprachigen universitären Exegese seit Ende des 19. Jh.s geprägt haben. (2) Anhand einer Kontroverse in der Zeit des Nationalsozialismus um die Interpretation neutestamentlicher Texte, die das Verhältnis der Kirche zum Staat betreffen, wird gezeigt, wie einerseits ein führender Fachexeget, Gerhard Kittel (1888–1948), seine radikale Bejahung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes im Gewand eines rationalen Staatsverständnisses zum Ausdruck bringt und wie andererseits die kirchliche Opposition um Karl Barth (1886–1968) ihre Verweigerung gegenüber der NS-Rassenpolitik mit einer irrational anmutenden Dämonisierung des NS-Staates exegetisch abzusichern versucht. (3) Schließlich werden die Folgen eines staatsfixierten Politikbegriffs für die Nachkriegsexegese bis in die gegenwärtige internationale Diskussion um eine politische Theologie des Paulus nachgezeichnet und mögliche exegetische und hermeneutische Neuansätze vorgestellt.
1. Neutestamentliche Wissenschaft und Politik
Wer sich mit dem Politikbegriff in der deutschsprachigen neutestamentlichen Wissenschaft beschäftigen möchte, tut gut daran, eine Zeit in den Blick zu nehmen, in der die politische Frage mit Macht an die neutestamentliche Wissenschaft herangetragen wurde. Die Zeit des Nationalsozialismus und seine geistige Vorbereitung in der Weimarer Republik bilden eine Epoche, die die Eigenart deutscher geistes-wissenschaftlicher Forschung bis in die Gegenwart hinein geprägt hat. Sie sollte in der Wissenschaftsgeschichte ebenso ernst genommen werden wie die Phase zum Ende des 19. Jahrhunderts, die der Wissenschaftshistoriker Oexle als „Achsenzeit“ moderner Wissenschaft bezeichnet und die hier zunächst als notwendige Verstehensvoraussetzung knapp skizziert werden soll.1Die Gründe für das Urteil Oexles sind schnell genannt. Ende des 19. Jh.s wurden wohl zuerst in Deutschland die Fachdisziplinen definiert und das Prinzip der Ausdifferenzierung von Spezialdisziplinen etabliert. So wurde die Grundlage für die bedeutende Rolle der deutschen Wissenschaften gelegt. Deutsch etablierte sich als Wissenschaftssprache und das deutsche Modell der Universität galt in vielen Ländern als eine nachahmenswerte Organisationsform von Wissenschaft. An den Strukturen des so beschriebenen Modells richteten sich die Universitätsreformer anderer Länder aus, etwa die Reform der Harvarduniversität und die Gründung der hebräischen Universität Jerusalem in den zwanziger Jahren. Gleichzeitig ist aber ein erheblicher Unterschied zwischen den politischen Rahmenbedingungen der deutschen und der genannten internationalen Entwicklungen festzuhalten. Anders als in den Ländern der beiden genannten Beispiele wurden die erläuterten Strukturen der Wissenschaftsorganisation in Deutschland in einer großen Nähe zum Staat entwickelt. Die Fächerstrukturen der Fakultäten und die Denominationen der Lehrstühle wurden in Verhandlungen mit den Ministerien, letztlich aber durch ministerielle Entscheidung festgelegt. Man lernte in der universitär-akademischen Sozialisation von Anfang an, dass die Durchsetzung der eigenen wissenschaftlichen Positionen wesentlich auf die Unterstützung durch die staatliche Macht angewiesen war. Hinter den wissenschafts-adäquaten Strukturen, die in Deutschland ausgebildet wurden, entwickelten die Wissenschaftler auch „Dispositionen“ und „Haltungen“,2die nicht nur von diesen Strukturen, sondern auch von der besonderen Beziehung der Wissenschaft zum Staat bestimmt waren. Mit Recht wird in der Einleitung zu dem Band „Deutsche Historiker im Nationalsozialismus“ festgehalten, dass die Geisteswissenschaften im Wechsel der Herrschaftsformen von 1900 bis 2000 einem paradoxen Prinzip folgten:
„Die Autonomie der Wissenschaft hielt man am besten in steter Nähe zur Macht gewahrt.“3
In der Zeit des Nationalsozialismus lässt sich das so in Zahlen fassen: Reichsweit waren 1945 etwa 40 % der Universitätsprofessoren Mitglied der NSDAP und ein erheblicher weiterer Teil war Mitglied in anderen Partei-, SA- und SS-Organisationen.4 In den Entnazifizierungsverfahren werden letztere Mitgliedschaften jeweils als Vermeidung einer Parteimitgliedschaft angeführt. Angesichts eines doch erheblichen Teils der Hochschullehrer, die ohne Mitgliedschaft in NS-Organisationen ihr Amt ausübten, muss dieser Zwang als vermeidbar angesehen werden, wie zahlreiche Beispiele zeigen.5 An der Universität Rostock, deren Geschichte während der NS-Zeit jüngst von M. Buddrus und S. Fritzlar erforscht wurde, lag die Parteimitgliedschaft bei 51,3 %.6
Aber in Zahlen allein lassen sich die Dispositionen und Haltungen, die dem Forschen und dem Handeln der Geisteswissenschaftler zugrunde lagen, nicht zureichend beschreiben, geschweige denn analysieren. Es ist vielmehr zu fragen, in welchem Verhältnis die wissenschaftlichen Aussagen und intellektuellen Äußerungen der Wissenschaftler zur politischen Realität standen.7 In den letzten Jahren ist die Forschungsgeschichte vieler Fächer erforscht worden. Dabei sind auch zahlreiche Sonderentwicklungen näher beleuchtet worden, die dem Paradigma der „völkischen Wissenschaft“ folgten.8 Die Geschichtswissenschaft, mit der sich die Exegese dieser Zeit durch die gemeinsame historische Methode verbunden wusste, ist in besonderer Weise zum Gegenstand intensiver Untersuchungen geworden, da hier — anders etwa als im Falle der Politikwissenschaft9 — eine erhebliche personelle und möglicherweise auch geistige Kontinuität zu diskutieren war. Große Teile der Geschichtswissenschaft hatten in der NS-Zeit ein politisches Verständnis von Wissenschaft, das über die Funktion einer intellektuellen Legitimationswissenschaft noch hinausgeht. Geschichtswissenschaft sei vielmehr als „initiative, hochgradig politisierte, tonangebende, zuletzt als im Wortsinne ‚kämpfende’ Wissenschaft“ in Erscheinung getreten.10 Einige der wichtigsten Protagonisten dieser kämpfenden Wissenschaft mit menschenverachtender Wissenschaftspraxis waren nach 1945 die Begründer der Sozialgeschichte (z.B. Theodor Schieder),11 deren Schüler wiederum bis heute das Fach dominieren.12 Diese Skizze sollte genügen, um das universitäre und geisteswissenschaftliche Umfeld theologischer Forschung in Deutschland zu beschreiben.
An den theologischen Fakultäten selbst gab es besondere Bedingungen. An der Rostocker theologischen Fakultät etwa waren 2 von 11 Professoren Parteimitglieder (18,2 %).13 Auch hier gab es das, was die Verfasser der Untersuchung einen „kreativen Umgang“ mit der nationalsozialistischen Erwartungshaltung nennen.14 Zwei Mitglieder der Fakultät beteiligten sich an den Rednereinsätzen zur Truppenbetreuung, darunter auch der Neutestamentler Friedrich Büchsel.15 Die Theologen in Rostock wirkten damit „eher immateriell systemstabilisierend“16. Die Ablehnung eines konfessionell gebundenen Christentums durch den Nationalsozialismus setzte hier Grenzen und führte auch in Rostock zu Formen von „Renitenz“ und „Nonkonformismus“, die aber nach Buddrus/Fritzlar bei realistischer Prüfung keinesfalls als Widerstand bezeichnet werden können.17
Dennoch waren die meisten theologischen Fakultäten seit 1938/39 in ihrer Existenz gefährdet. In den Ministerien und Parteigliederungen lagen Pläne zur Schließung der Fakultäten. Auch die Studentenzahlen waren erheblich zurückgegangen, in Rostock von 225 (von 2686 der Gesamtuniversität) im Jahr 1932 auf 5 (von 493) im Jahr 1941, danach liegen keine Zahlen mehr vor.18 Ein Entwurf des Ministeriums vom 6. 4. 1939 sah die Schließung von fünf Fakultäten (Heidelberg, Bonn oder Münster, Leipzig, Rostock, Berlin) vor. In diesem Zusammenhang verfasste der Reichsdozentenführer Schulze ein Memorandum, in dem er die Fakultäten gemäß ihrer politischen Haltung in drei Kategorien einteilte. Rostock wurde dort in die Gruppe der Fakultäten mit Nähe zur Bekennenden Kirche eingeordnet, was aus nationalsozialistischer Sicht eine negative Beurteilung war.19 In der ersten Gruppe, also der der Fakultäten, die in der Diktion Schulzes „positiv zum Nationalsozialismus“ standen, waren Berlin, Wien, Jena und Gießen notiert. Von diesen wiederum sollte Berlin geschlossen werden20 und auch für Wien war kein weiterer Ausbau vorgesehen.21 Selbst die extrem nationalsozialistisch orientierte Jenaer theologische Fakultät,22 an der zudem mehrere Professoren als Agenten des SD tätig waren,23 sollte nur noch eine Zeit der Bewährung erhalten.24 Die Protagonisten dort entwickelten in dieser Zeit als „Jenaer Denkschrift“ ein Konzept für eine „völkische Theologie“, nach der die theologischen Fakultäten in „religionswissenschaftliche Fakultäten völkisch-rassischen Gepräges“ umgewandelt werden sollten.25
Die weitere Planung im Ministerium und die nationalsozialistische Wissenschaftspolitik überhaupt wird von Wolgast so zusammengefasst:
„Der Nationalsozialismus war entschlossen, sich der Kirchen und der Theologie vollständig zu entledigen – nur die militärische Niederlage und der politische Zusammenbruch des Systems retteten auch die theologischen Fakultäten.“26
Dieses Urteil von Wolgast setzt eine eindeutige Ausrichtung der NS-Wissenschaftspolitik voraus, die aber angesichts des von der Forschung immer wieder konstatierten Chaos von widerstreitenden Kräften innerhalb des NS-Systems überraschen würde.27 Die Lage der Theologie in der NS-Zeit war zumindest von zahlreichen Ambivalenzen geprägt. Die nationale Gesinnung der meisten Fakultätsmitglieder der älteren Generation hatte aufgrund der weltanschaulichen Grenzen, die von Seiten des Nationalsozialismus gezogen wurden, nur eingeschränkte Wirkungsmöglichkeiten. Die Anstrengungen einer überschaubaren Zahl von Theologen für eine „völkisch“ orientierte Theologie, die den Erwartungen der nationalsozialistischen Weltanschauung eher entsprechen sollte, waren zwar erheblich, stießen aber doch auch auf breite Vorbehalte und verzettelten sich in der Regel in heute obskur anmutende innere Auseinandersetzungen. Selbst die beiden radikalsten Vertreter einer rassisch orientierten und nationalsozialistisch ausgerichteten theologischen Wissenschaft wie Gerhard Kittel (1888– 1948),28 der bereits 1933 Überlegungen zur Ausrottung der Juden anstellte,29 und Walter Grundmann (1906–1976),30 der eng mit dem Reichssicherheitshauptamt zusammenarbeitete, 31 mussten einsehen, dass die nationalsozialistische Wissenschaftspolitik eine Zukunft ohne Theologie plante.
2. Christus und Imperator
Diese Konfliktlage, die ich gerade wissenschafts- und institutionengeschichtlich analysiert habe, wirkte sich auch auf die neutestamentliche Exegese aus. Es rückten Themen in den Vordergrund des theologisch-wissenschaftlichen Diskurses, deren Bearbeitung in enger, wenn nicht in direkter Beziehung zur Rechtfertigung oder Bestreitung politischer Positionen des nationalsozialistischen Regimes standen. Der neutestamentlichen Exegese fiel dabei die Aufgabe zu, normative Aussagen durch historisch-philologische Exegese zu begründen und zu untermauern.32 In der Folge wurden dann etwa unter der Überschrift „Christus und Imperator“ exegetische Forschungsergebnisse vorgetragen, die aber letztlich Stellungnahmen zum aktuellen Verhältnis von NS-Staat und Kirche sein wollten.
Diese Forschungen vollzogen sich zudem in einer politisch und kirchlich höchst angespannten Situation. Im Jahr 1933 gewannen Kreise, die die nationalsozialistische Machtergreifung begrüßten, in großen Teilen der Evangelischen Kirche zunächst die Oberhand. Bei ihrem Versuch, die NS-Rassenpolitik innerhalb der Kirche durchzusetzen, stießen sie jedoch auf innerkirchlichen Widerstand. Die „rassische“ Orientierung des Staates wurde zwar nicht grundsätzlich abgelehnt,33 im Raum der Kirche widersprach sie aber allzu offensichtlich der unbedingten Integration aller Glaubenden in die christliche Gemeinschaft durch die Taufe.34 „Rassische“ Überlegungen waren mit diesem Verständnis der Taufe nur schwer zu vereinbaren. Um diese bekenntnismäßigen Bedenken auszuräumen, mussten die Protagonisten der NS-Politik innerhalb von Kirche und Theologie theologisch argumentieren. Sie forderten, dass die Kirche die nationalsozialistische Machtergreifung als ein Handeln Gottes in der Geschichte (gr. erga theou, Werke Gottes) anzuerkennen habe, aus dem dann für die Kirche neue Ordnungen zu begründen seien. Die Legitimation für die Einführung neuer Lehren, etwa die Gründung einer separierten Kirche für Christen mit jüdischen Vorfahren,35 sollte durch die Behauptung erreicht werden, dass sich Gott in der NS-Politik, namentlich in Hitler, geschichtlich offenbart habe. Es galten und bezeichneten sich nun diejenigen Theologen als „politisch“, die bereit waren, die Kirche im Sinne der NS-Weltanschauung grundlegend zu verändern.36 In dieser Situation formulierte Karl Barth sein berühmtes Diktum, nun ginge es darum Theologie zu treiben, „als wäre nichts geschehen“:
„Das Entscheidende (ist)…, dass ich mich bemühe, hier in Bonn mit meinen Studenten in Vorlesungen und Übungen nach wie vor und als wäre nichts geschehen – vielleicht in leise erhöhtem Ton, aber ohne direkte Bezugnahmen – Theologie und nur Theologie zu treiben. … Ich halte dafür, das sei auch eine Stellungnahme, jedenfalls eine kirchenpolitische und indirekt sogar eine politische Stellungnahme!“ 37
Diese Aussage prägte in ihrer verkürzten Form, „Theologie und nur Theologie treiben, als wäre nichts geschehen“, die so genannte Bekennende Kirche und weite Teile der Nachkriegstheologie. In der Rezeption des barthschen Diktums wurde die Opposition theologisch versus politisch hervorgehoben, der barthsche Hinweis auf den „indirekt“ politischen Charakter hingegen wurde häufig übergangen.38
Nachdem die Positionen der Bekennenden Kirche in der Barmer Erklärung vom 29.–31. Mai 1934 ihren klaren Ausdruck fand und der Einfluss der nationalsozialistisch inspirierten Theologen sank, wandte sich der bereits genannte Gerhard Kittel an Karl Barth. Kittel, neben seinem Lehrer Adolf Schlatter (1852–1938) und seinen Schülern Karl Georg Kuhn (1906– 1976) und Walter Grundmann (1906–1976) ein führender Vertreter der Tübinger theologischen Judenfeindschaft,39 spricht hier „von uns württembergischen nationalsozialistischen Theologen“,40 die unter anderem die „Hinzuziehung geeigneter Männer, die der NSDAP angehören“, in die Kirchenführung forderten.41 In diesem Briefwechsel spielte wiederum das Diktum „als wäre nichts geschehen“ eine wesentliche Rolle. Kittel greift es auf, verwirft es in einer öffentlichen Stellungnahme als „falsche Lehre“ und fordert von Barth letztlich seine Aussage zu widerrufen. Kittel formuliert öffentlich am 9. Juni 1934:
„Wir verwerfen die falsche Lehre, als ob es zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort eine Verkündigung des Evangeliums ohne Bezogenheit auf den geschichtlichen Augenblick gäbe, welche erfolgen könnte ‚als wäre nichts geschehen’.“
Im Hintergrund dieser Verwerfung steht Kittels Forderung, „den 30. Januar“, Hitlers Machtergreifung, als „Tag von Gott“ anzuerkennen.42 Die scharfe Zurückweisung Barths vom 12. Juni 1934 gipfelt in der Gegenforderung an Kittel, er möge die „gnostische Sekte“, der er jetzt angehöre, verlassen und zur Kirche zurückkehren.43 Kittel reagiert gegenüber der Bezeichnung der nationalsozialistischen Theologen als Sekte am 15. Juni 1934 gereizt. Er fragt:
„Wie in aller Welt kommen Sie dazu, dem, der unter das Hakenkreuz tritt, von vorneherein streitig zu machen, was sie dem Paulus zuerkennen ... Woher nehmen Sie die Vollmacht, diesem Geschehen die legitime biblische Betrachtung des Ergon Theou [Werk Gottes, LB] zu verwehren?“44
Barth führt nun die Unterscheidung zwischen privater politischer Überzeugung und kirchlicher Lehre ein. Barth schreibt am 19. Juni 1934 an Kittel:
„Stehen sie ruhig unter dem Hakenkreuz, wenn Sie es so für richtig halten. Man kann auch unter dem Schweizerkreuz, unter dem Doppeladler, unter dem Sowjetstern stehen.“45
Ob man unter dem Hakenkreuz, dem Schweizer Kreuz oder dem Sowjetstern stehe, sei theologisch gesehen Privatsache und ohne Belang, was aber die Kirche als ihre Lehre vertrete, sei hingegen höchst bedeutsam und müsse unabhängig von historischen Ereignissen und privaten politischen Vorlieben festgehalten werden.
Die Einbeziehung des „Sowjetsterns“ in die Überlegungen Barths war damals eine ungeheure Provokation, die Kittel natürlich aufgriff, um sie auszuschlachten. Kittel schreibt an Barth am 28. Juni 1934:
„Aber wenn die Entscheidung der Weltgeschichte in einem Volke fällt zwischen dem Sowjetstern und dem Deutschland des 30. Januar, dann ist die Kirche unter Gottes Geist und unter Gottes Wort nicht so arm, daß sie nicht die Vollmacht hätte, zu sagen, ob die Entscheidung dieses Tages von Gott oder vom Satan ist.“
Diese im Original gesperrt gedruckte Formulierung, die Kittel an dieser entscheidenden Stelle wählt, ist wie so oft in den Schriften Kittels in eine deutungsoffene verklausulierte Wenn-Dann-Formulierung mit weiteren Unterbedingungen („Vollmacht hätte“, „ob“) gefasst. Sie zielt auf den Kern der Debatte. Kittel fordert, die Kirche müsse doch zwischen Gott und Satan unterscheiden können. K.L. Schmidt zitiert ebenfalls diese Formulierung und erläutert dazu, dass:
„Kittel ... in Hitlers Machtergreifung am 30. Januar 1933 ein ergon theou [Werk Gottes, LB] und in der Sowjetherrschaft ein ergon tou satana [Werk des Satans, LB] sehen zu dürfen meint“.46
Die im Briefwechsel des Sommers 1934 einigermaßen offen geführte Kontroverse klärte die theologischen Fronten. Der Konflikt schwelte allerdings weiter und verschob sich nun auf exegetische Fragen, deren Beantwortung als normativ für die politische Haltung der Kirche galt. Angesichts der offensichtlichen Rechtsbrüche durch den NS-Staat stellte sich die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat neu. Insbesondere die Interpretation von Röm 13,1–7 war hoch umstritten.
1939 publizierte Gerhard Kittel seine Schrift „Christus und Imperator. Das Urteil der Ersten Christenheit über den Staat“, die auf einen Aufsatz aus dem Jahr 1937 zurückging.47 Diese Schrift tritt als historisch-exegetische Untersuchung auf, die eine „geschichtliche Frage“ untersuche.48 Aber bereits das „und“ im Titel zeigt, dass Kittel an eine positive Beziehung zwischen Bekenntnis und staatlicher Macht denkt, und auch das vorangestellte Zitat aus Tertullian über das Verhältnis von Caesar und Christen soll wohl andeuten, dass die Christen der staatlichen Macht näher stünden als andere.49 Beide Vorgaben, mit denen Kittel die Rezeption seiner Schrift bestimmen möchte, sind programmatisch gemeint und bereiten auf die folgende affirmative und polarisierende Exegese vor.50 Nach Kittel wertet das Neue Testament die staatliche Ordnung grundsätzlich positiv als göttliche Ordnung. Die Apokalypse sei zwar „voll der radikal kritischen Polemik gegen die staatlich-politische Macht des Imperium Romanum“,51 diese Kritik erkläre sich aber durch die Sondersituation der Verfolgung, die in Kleinasien durch den Kaiserkult gegeben sei.52 Christen seien gezwungen worden, das „Tier anzubeten“ (Apk 13,15), d.h. am Kaiserkult teilzunehmen. Ausschließlich diese „symbolische Handlung“, nicht aber die staatliche Ordnung als solche, markiere die Grenzüberschreitung, die als Pervertierung des Staates zu werten sei.53 Zudem sei der kritisierte römische Staat für die ersten Christen „nicht Volksstaat, sondern heidnischer Fremdstaat“ gewesen, so dass eine Übertragung dieser Kritik nicht statthaft sei.54
Das zeige sich vor allem daran, dass die Christen weder in der Hinrichtung Jesu noch in den anderen Übergriffen, die Paulus und Jesus bekannt gewesen seien (Apg 16,37ff; 2. Kor 11,24; Lk 13,1ff), eine Grenzüberschreitung des Staates gesehen hätten. Sie hätten zwar den „Römischen Staat von seiner schwärzesten Kehrseite“ erlebt, sie kannten tatsächlich „die Gewaltsamkeit und Grausamkeit der Römischen Fremdherrschaft“, und dennoch hätten Paulus in Röm 13 und Jesus in der Zinsgroschenperikope und im Wort über die Fürsten der Völker den Staat anerkannt55:
„Mark 10,42: ‚Ihr wisset, daß, die als Fürsten der Völker gelten, über sie als Herren schalten und daß ihre Großen Gewalt über sie ausüben’. Aber auch
ein solcher Satz hebt den Befehl, jenen zu geben, was ihnen gebührt, nicht auf, läßt ihn vielmehr als um so bewußter und um so ernsthafter gemeint erkennen.“56
Die Gefangennahmen, Folterungen und Morde durch die Staatsgewalt, die in den neutestamentlichen Texten genannt seien, hätten die grundsätzliche Anerkennung des römischen Staats durch Jesus und Paulus also nicht erschüttert.57 Nur die Apokalypse habe sich wegen der geforderten symbolischen Handlung im Kaiserkult zum äußersten treiben lassen, zur Dämonisierung des Staates. Dabei sei aber immer zu beachten, dass es sich „also nicht um eine Obrigkeit handelt, der Jesus und Paulus volksmäßig angehören: nicht um einen Volksstaat, sondern um einen Fremdstaat“.58
Deutlich genug, wenn auch in sprachlichen Konstruktionen, die Ausflüchte ermöglichen sollen, will Kittel hier die Übergriffe und Rechtsbrüche des nationalsozialistischen Staates rechtfertigen und an ihm als legitime Obrigkeit festhalten. Kittel reagiert mit seinen Veröffentlichungen auf eine Exegese der kirchlichen Opposition um Karl Barth, der so genannten „Bekenntnisfront“. Deren „neue“ Interpretation nennt er – in der für ihn typischen, verstellten Weise, indem er das Urteil dem Irenäus in den Mund legt – „eine häretische Exegese“.59
Die kirchliche Opposition um Barth interpretierte Röm 13,1–7 neu, indem sie ‚Mächte’ (exousiai) und ‚Gewalten’ (archai) als Engelsmächte verstanden.60 Die Verbindung des Staates mit diesen ambivalenten Zwischenwesen rückte die staatliche Ordnung auch in die Nähe zu den dämonischen Mächten:
„Aber Engel können fallen. … Auf den Staat bezogen heißt das aber: irdische Obrigkeit, hinter der die Engelmächte stehen, kann dämonisch werden.“61
Basis dieser Überlegungen war die religionsgeschichtliche These, dass das Neue Testament mit dem Begriff exousia (‚Macht’) eine Engelsmacht bezeichne, die im Staat auch als dämonische Macht wirksam werden könnte. Der in Röm 13,1 genannte „jedermann“ sei eben nicht jeder, sondern ein qualifizierter Jedermann, der Christ. Er habe sich den „Mächten“– die Übersetzung Luthers von exousia mit „Obrigkeit“ wird vermieden – nur deswegen zu beugen, da diese ihrerseits der Macht (exousia) Christi unterworfen seien (Eph 1,20f; 3,10). Diese Unterwerfung der irdischen Macht unter Christus, den Herrn, sei notwendige Voraussetzung für den Gehorsam. Bei Paulus, zu dessen Briefen man damals Kolosser- und Epheserbrief hinzuzählte, sei die irdische Macht von dämonischen und satanischen Mächten abhängig (Eph 2,2; 6,12 und Kol 1,13; 2,10.15):
Eph 2,1f: „Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams.“
Eph 6,12: „Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“
Die irdische Macht sei mit Dämonen verbunden, so Barth. Diese dämonische Macht müsse durch Christus erst unterworfen werden, ehe sie wieder von den Christen Gehorsam verlangen könne. Vom Sieg Christi über diese Mächte sprächen Kol 2,10 und 15:
Kol 2,10: „Und ihr seid in ihm zur Fülle gekommen, der das Haupt jeglicher
Macht und Gewalt ist.“
Kol 2,15: Christus „hat die Mächte und Gewalten entkleidet, er hat sie in aller Öffentlichkeit zur Schau gestellt und hat sie mit sich im Triumphzug geführt.“
Christus habe die Mächte seiner Herrschaft unterworfen. Das sei die Bedingung für den Gehorsam gegenüber dem Staat. Es bleibe aber trotz dieser Unterwerfung die grundsätzliche Gefahr der dämonischen Pervertierung staatlicher Ordnung. Nach Barth sei damit bei Paulus zum Ausdruck gebracht, dass der Staat als „höchste menschliche Ordnungsmacht“62 im Innersten dem Einfluss widergöttlicher Mächte ausgesetzt sei:
„Sie [die höchste menschliche Ordnungsmacht] ist nämlich eine von jenen Engelsmächten, die (nach dem Philipper-, Kolosser- und Epheserbrief) ohne ihren an sich widergöttlichen Charakter und ihre Gefährlichkeit eingebüßt zu haben, Jesus Christus dienstbar geworden ist.“63
Für die Exegeten um Barth war damit klar, dass auch in Röm 13,1 die exousiai hyperechousai, die Gewalten, denen man sich unterzuordnen habe, vor diesem Hintergrund zu interpretieren seien.64 Die Gewalten seien von Gott eingesetzt und hätten Christus zu dienen. Ihre Aufgabe sei es, „die Welt in dieser Zeit vor dem Chaos zu bewahren und damit dem Evangelium den nötigen Raum zu sichern“.65 Es bestehe aber auch die Gefahr, dass:
„der Staat seinem zweideutigen Wesen als einer beherrschten aber doch nicht vernichteten Engelmacht entsprechend, sich noch einmal zur antichristlichen Gegenkirche entwickeln könnte.“66
In der Nachkriegszeit wird diese im Konflikt entwickelte Lehre Barths eine dogmatisch geordnete Fassung bekommen.67 Für heutige Leser/innen mutet eine solche mythologische Dämonisierung staatlicher Macht als „Engelmacht“ befremdlich an. Im Kontext systemtheoretischer Politiktheorien kann eine solche Exegese nur als irrational bezeichnet werden.68 Aber es ist deutlich genug, dass diese scheinbar irrationale Dämonisierung des Staates der Preis war, der für den Bruch mit der Obrigkeitshörigkeit gegenüber dem NS-Staat zu zahlen war. Für die geschilderte Kontroverse zwischen dem historisch argumentierenden Kittel und dem mythologische und metaphysische Anleihen nicht scheuenden Barth wird man jedenfalls festhalten können, dass die politische Dimension der Exegese unabhängig von historischer Richtigkeit und philologischer Präzision zu beurteilen ist. Die scheinbar nüchterne Anerkennung staatlicher Legitimität, die Kittel aus der Zinsgroschenperikope und aus Röm 13 entwickelte, stellte sich in den Dienst des nationalsozialistischen Unrechtsstaates und rechtfertigte dessen Übergriffe.
Die von Barth entwickelte Engel- und Dämonenlehre hingegen, die sich heute befremdlich liest, öffnete die Augen dafür, dass im Staat das Dämonische und Molochartige irdischer Ordnungen zu gewärtigen sei, und vermochte daraus widerständige Handlungsoptionen abzuleiten.69
Diese Geschichte einer politisch-theologischen Kontroverse hat noch eine bedeutsame Ironie. Kittel selbst, der scheinbar nüchterne Philologe, wird im Rahmen seines Entnazifizierungsverfahrens die Dämonen zu seiner Verteidigung beschwören, die ihm im Gegensatz zu Barth zwischen 1933 und 1945 verborgen geblieben waren:
„heute ist offenkundig, … dass die dynamischen Kräfte der Dämonien unaufhaltsam waren, gleichgültig was immer ein Professor für oder gegen die Juden oder über ihre Geschichte schreiben mochte.“70
Nun, durch die Franzosen interniert und aus dem Amt entfernt, nennt er sich einen „weltfremde(n) Gelehrte(n)“, der missbraucht worden wäre.71 Seinen Lebensweg im Nationalsozialismus beschreibt er mit den Worten:
„Er [Kittel, LB] konnte seinen Weg, der wahrhaft mitten durch die Felder und Abgründe der Dämonen führte, wahrhaft u. in buchstäblichen Sinne zwischen Tod und Teufel – … – nur völlig einsam gehen: im Gehorsam und im Glauben.“72
Kittels öffentliche antisemitische Wendung im Jahr 1933 ist bekannt.73 Auch die problematischen Voraussetzungen seiner Konzeption des Theologischen Wörterbuchs als „Lexicographia Sacra“, nach der die zentralen Begriffe des Neuen Testaments ihr „eigentlichstes und tiefstes Wesen ... erst ... in Jesus Christus“ fänden, sind weitgehend erforscht.74 Zwar wird immer wieder versucht, selbst in den Arbeiten Kittels, die nach 1933 erschienen sind, die wissenschaftlich wertvollen Leistungen von den ideologisch beeinflussten Aussagen zu trennen, aber diese apologetischen Bemühungen scheitern meist bereits an den inneren Widersprüchen, die Kittel in seinem Werk selbst angelegt hat.75
Die politische Dimension seiner wissenschaftlichen Arbeit hingegen, seine unehrliche und gleichzeitig sich wissenschaftlich gebende Rhetorik sind in seinen Folgen für die deutsche neutestamentliche Wissenschaft nicht näher reflektiert worden.
Die neutestamentliche Exegese der Nachkriegszeit meinte, dass die Problematik auf der Ebene der historischen, religionsgeschichtlichen und philologischen Arbeit zu klären sei. Damit reduzierte sich der Problemhorizont des Exegeten auf die philologische Frage, ob das Syntagma ‚Mächte und Gewalten’ (archai kai exousiai) dämonische Mächte meinen könne, ob das auch in Röm 13,1 der Fall sei oder ob dort, in Röm 13,1, nicht vielmehr konkrete staatliche Funktionen und Ämter im Blick seien.
3. Die politische Theologie des Paulus und der Kaiserkult
Das Diktum Karl Barths, es gehe darum, Theologie zu treiben als wäre nichts geschehen, ist im Nachkriegsprotestantismus zum geflügelten Wort geworden. Es wurde meist in Erinnerung gerufen, um das Ideal einer bekenntnistreuen und doch unpolitischen Kirche zu beschwören. Die sehr konkrete Entstehungsgeschichte im Jahr 1933, die diesem Wort als ein Deutungsschatten anhaftet, der in seiner Paradoxität kaum zu überbieten ist, wurde meist ausgeblendet. Angesichts des größten Unrechtsregimes, das die menschliche Geschichte kennt, Theologie zu treiben, als wäre nichts geschehen? In diesem Diktum und in seinen motivlichen Rahmenbedingungen verdichten sich die Ambivalenzen, die auch den deutschen Nachkriegsprotestantismus prägen.
Die deutschsprachige Exegese der Gegenwart knüpft nach wie vor an einem Politikverständnis an, nach dem Politik eng mit dem Staat verbunden ist.76 Es wird als selbstverständlich unterstellt, dass Politik dort beginne, wo staatliches Handeln berührt werde. Die Frage, ob das Neue Testament oder ob die Theologie des Paulus überhaupt politisch sei, wird bis heute in der Regel in diesem Horizont beantwortet. Omerzu erörtert eingehend die merkwürdige Frage, ob Paulus ein Politiker gewesen sei, und meint im Ergebnis, dass die Beantwortung dieser Frage vom „Politikverständnis des Interpreten“ abhänge, womit sie die Problematik in den Bereich privater Meinungen verlagert.77 In der Regel bewegen sich die materialen Aussagen zum politischen Paulus nach wie vor auf der Linie Kittels. Wolter meint, sowohl der Verfasser des Lukasevangeliums wie der Apostelgeschichte als auch Paulus zeichneten:
„ein Bild von der imperialen Rechtsordnung, die es seinen Lesern unmöglich macht, sie abzulehnen – ungeachtet des Fehlverhaltens einzelner Rechtsträger wie des Pilatus (Lk 23,24f.), der Beamten von Philippi (Act 16,22.37) oder des Felix (Act 14,26.27). In analoger Weise gilt dies auch für Paulus: Er fordert in Röm 13,1–7 die römischen Christen zur Unterordnung unter die magistrale potestas auf.“ 78
Neben dieses einseitig affirmative Verständnis der römischen Staatsordnung tritt eine Unterscheidung zwischen Ethik und Politik, die die politikrelevanten Bereiche der Ethik im Bereich des vorstaatlich Privaten verortet. Der Einwand, Paulus habe nicht Senator werden wollen, sei also kein Politiker gewesen, wird dann bisweilen als die Erledigung der Frage nach der Politik des Paulus verstanden. Die Aussagen hingegen, die allzu offensichtlich in den Bereich des Politischen vordringen und sich nicht in ein affirmatives Verständnis von Röm 13 integrieren lassen – etwa über Steuer, über die Ehe, über Gehorsamsstrukturen in der Gemeinde, über Ämter, über das Verhältnis von Mann und Frau und das von Sklaven und Herren, über reich und arm – werden aus dem Bereich des eng mit dem Staat verbundenen Politischen herausgenommen und einer auf die religiöse Gemeinschaft beschränkten Ethik zugewiesen. Die zugrunde liegende Unterscheidung von Ethik und Politik schafft dann in der Gemeinde einen Raum individuellen Handelns, in dem dann Regeln gelten dürfen, deren Berücksichtigung sonst keineswegs für erstrebenswert gehalten würden, etwa Feindesliebe, Gewaltverzicht und Rechtsverzicht. Das formuliert Wolter so:
„Es geht vielmehr darum, dass die gemeinsame Identität eine Relation begründet, die die unter Christen bestehenden Rechtsverhältnisse transzendiert und ihren lebensweltlichen Umgang miteinander dominieren soll.“79
Handlungsimperative wie etwa die Gleichstellung von Sklave und Freigeborener (Gal 3,28; Kol 3,11) gelten Wolter aber als dezidiert unpolitisch, da sie die Sphäre des Staates nicht berührten, sondern in der „symbolischen Sinnwelt“ der Gemeinde verblieben.80 Das Politische hingegen beginnt nach einem solchen Verständnis erst, wenn Vorstellungen entwickelt werden, die auf staatliches Handeln Einfluss gewinnen wollen.
Tatsächlich aber zahlt die Exegese für ein derart unpolitisches Neues Testament und einen derart unpolitischen Paulus einen hohen Preis. Es werden Texte, die allzu deutlich von Machtkonstellationen sprechen, entweder in eine symbolische Welt der innergemeindlichen Ethik oder in einen Bereich des Jenseitigen verwiesen. Gerade die Begriffsgruppe um Herrschaft, Gewalt, Macht, Herrsein (arche, dynamis, exousia, kyrios) usw. wird ihrer engen Beziehung zu den politischen Äquivalenten beraubt.
In der internationalen Forschung hingegen wird seit einigen Jahren intensiv gefragt, ob das politische Äquivalent dieser neutestamentlichen Begriffe im römischen Kaiserkult bzw. in der Augustusverehrung zu finden sei.81
Natürlich war der Kaiserkult schon lange bekannt.82 Man neigte aber im Horizont eines christlich verengten Religionsverständnisses, das auf die Frage wahrer Gott oder Götzendienst fixiert war, zu der Interpretation, dass der Kaiserkult erst mit der Verehrung lebender Cäsaren als Gottheiten für die Christen zu einem relevanten Problem geworden sei.83 Mit der Ausnahme des Verhaltens des Gaius Caligula, das auch von römischer Seite verabscheut worden sei, habe es eine solche Vergottung des lebenden Kaisers frühestens mit Domitian gegeben.84 In diese Zeit falle dann auch die scharfe Kritik am römischen Staat und an der Caesarenverehrung, die sich in der Johannesoffenbarung in der Vision des Tieres, das die kultische Verehrung fordert, findet.85 Apk 13,2 (Übers. Satake):
„Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und ihm gab der Drache seine Macht und seinen Thron und große Gewalt (exousia megale). ... 8: Und ihn werden alle Bewohner der Erde anbeten (proskynein), jeder, dessen Name nicht im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben steht.“86
Für Paulus und seine Zeit hingegen sei der Kaiserkult ohne Belang gewesen.
Die Erforschung der römischen Herrscherverehrung führte dann aber bald zu anderen Ergebnissen. Zunächst löste man sich von der jüdischchristlichen Perspektive auf das Phänomen. Die Verengung auf die Frage, ob lebende Kaiser explizit als Gottheit verehrt wurden, wurde aufgebrochen. Die Vielzahl der Formen religiös-politischer Propaganda von Seiten der Herrscher und die Vielzahl der Formen, in denen die Reichsbevölkerung die Herrscherverehrung lokal etabliert hat, zeigen, dass es sich um ein umfassendes politisch-gesellschaftliches Integrationsprogramm handelt. Die römische Herrscherverehrung war durch viele Vorformen vorbereitet. In der frühen Kaiserzeit diente sie einerseits der Legitimation der neuen Prinzipatsverfassung, andererseits war sie aber auch eine Möglichkeit, die Politik des Prinzeps mitzugestalten. Price hat für eine solche Neuinterpretation den Boden bereitet, indem er einerseits die bereits erwähnte Abwendung von einer theozentrischen Sichtweise der jüdisch-christlichen Perspektive forderte und andererseits mit dem Ritualbegriff die Wechselseitigkeit des Kaiserkultes in den Mittelpunkt stellte.87 Er versteht in Anschluss an den Ritualbegriff von Geertz den Kaiserkult als ein Ritual, das die soziale Welt strukturiert, oder „ritual as a public cognitive system”.88 Für das Verständnis des Kaiserkults bedeutet das einen erheblichen Perspektivenwechsel:
„I do not see rituals merely as a series of ‚honours’ addressed to the emperor but as a system whose structure defines the position of the emperor.”89
Ebenso bedeutsam ist die interaktionistische Interpretation antiker Wohltätigkeit, die auf Veyne zurückgeht. Sein Konzept des Euergetismus verweist darauf, dass aus der Wechselbeziehung von materiellen Erwartungen der Armen an die Reichen und statusbezogenen Erwartungen der Reichen an die Armen eine erstaunliche Bereitschaft zu einer scheinbar uneigennützigen Wohltätigkeit hervorgegangen sei.90 Darin wird deutlich, wie bedeutsam Formen der symbolischen Kommunikation, z.B. statusbezogene Ehrungen, für die Gestaltung und Wahrnehmung von Gesellschaft sind. Bezieht man diese Einsichten auf die Theologie des Paulus, dann stellt sich nicht mehr die Frage, inwieweit und auf welche Weise Paulus sich mit staatlichen Institutionen und deren Handeln auseinandersetzte, sondern es rückt vielmehr in den Mittelpunkt, welches Verhältnis die soziale und religiöse Praxis der paulinischen Gemeinde zu den integrativen und inkludierenden Formen symbolischer Kommunikation der römisch-dominierten Gesellschaft hatte. Das „Politische“ an der paulinischen Theologie besteht dann im Umgang mit diesen Integrationsforderungen.
Hier wird nun allerdings ein Begriff des Politischen verwendet, der sich nicht eng an ein staatsfixiertes Politikverständnis anlehnt. Vielmehr wird in Aufnahme einer der Intentionen von Carl Schmitt das Politische als eine Qualität des Handelns verstanden, die sich erst in der Analyse erschließt. Vollrath schlägt eine solche hermeneutische Analyse des Politischen vor.91 Die Politik erschließe sich einem hermeneutischen und phänomenologischen Zugang. Sie „zeige“ sich und müsse wahrgenommen werden:
„Das Phänomen des Politischen zeigt sich in seiner Wahrnehmung und von dieser her. Es ist außerhalb seiner Wahrnehmung gar nicht sichtbar, d.h. kein Phänomen. Noch mehr: das Politische, das, ohne etwas bloß Subjektives zu sein, kein objektives Ding ist, existiert außerhalb seiner Wahrnehmung gar nicht.“92
Vollrath gehört damit in die Tradition einer politischen Theorie, die Politik weder als System noch als Prozess ausreichend beschrieben findet, sondern vielmehr das Politische als eine Qualität bezeichnen, der im hermeneutischen Akt verstehend zu begegnen ist.
Verbindet man die neuen ethnographisch und interaktionstheoretisch inspirierten historischen Zugänge mit der hermeneutischen Sensibilität gegenüber dem Politischen, dann werden Interpretationen des Verhältnisses von paulinischer Theologie und der politischen Loyalitätsreligion der Augustusverehrung möglich, die sowohl historisch wie politikwissenschaftlich verantwortbar sind.
Eine solche Perspektive bewegt sich jedenfalls noch im Rahmen einer historisch-hermeneutischen Exegese. Möglicherweise muss man aber noch einen Schritt weitergehen, um dem Politischen im Neuen Testament gerecht zu werden. Lyotard hat die Aporien der master narrative der Wissenschaft thematisiert.93 Das Emanzipationsversprechen der Wissenschaften, ihre politische Qualität, scheitere daran, dass die Wissenschaften nicht in der Lage seien, die Wahrheit und die Gerechtigkeit ihrer Aussagen zueinander in ein verlässliches Verhältnis zu setzen. Selbst die antizipierte herrschaftsfreie Kommunikationsgemeinschaft könne nicht vermeiden, dass sie an einen Punkt gerate, an dem zwar der Konsens als Zustand erreicht, die Gerechtigkeit als Ziel aber verfehlt werde.94
Das historisch signifikante exemplum der exegetischen Barth-Kittel-Kontroverse aus einer Zeit, in der wirklich etwas auf dem Spiel stand, und die theoretischen Überlegungen zur Leistungsfähigkeit von Wissenschaft nötigen gleichermaßen dazu, auf die Stimmen der „neuen Pauliner“ und ihre Vorläufer zu hören,95 um das Politische in den neutestamentlichen Texten besser zu verstehen. Die „neuen Pauliner“, die radikal-kritischen philosophischen Paulusinterpreten, bieten hier Analysen des Politischen bei Paulus, die dem Außerordentlichen im exegetisch-theologischen Diskurs der Jahre 1933/34, dessen Schärfe sowohl Bekenntnis- wie Widerrufsforderung produzierte, eher gerecht werden.
Versteht man mit Barth ‚Macht’ (exousia) als eine Gestalt von Macht, die nicht einseitig institutionell, etwa als Staat im Sinn von Obrigkeit, definiert werden muss, dann hat man die Basis für eine paulinische, ja neutestamentliche politische Theologie. Ohne die religionsgeschichtliche These Barths wiederzubeleben, nach der exousia als Engel- oder Dämonenmacht zu verstehen sei, lässt sich eine (partikulare) Grundüberzeugung neutestamentlicher politischer Theologie formulieren, nach der der biblische Gott dem Christus als kyrios alle Mächte (exousiai) unterworfen hat, und nun die von diesen Mächten befreite Gemeinde in den Situationen, in denen sie von Innen wie von Außen zur politischen Integration gedrängt wird, als „Platzhalter des Universalen“ (Žižek) handeln und widerstehen kann.96