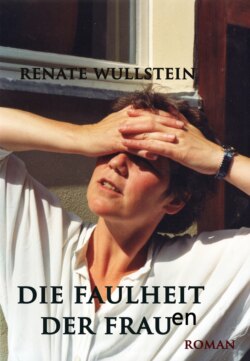Читать книгу Die Faulheit der Frauen - Renate Wullstein - Страница 4
In der Euphorie der Wende
ОглавлениеIn diesem Sommer war ich kaum aus dem Viertel gekommen. Hier war alles, was ich brauchte. Die Wohnung, das Stammlokal und die Arbeit. Wenngleich der Begriff Arbeit in die Irre führt, denn ich saß den ganzen Tag herum, wartete auf Kundschaft und war verstrickt in die aufreibende geistige Tätigkeit, die meinen künftigen Ruhm betraf. Oder meinte ich Reichtum? Von der Hitze wie festgenagelt, gab ich mich andererseits der Illusion hin, in einem südlichen Land zu sein, wo man an einem schattigen Platz vor sich hin döst und nur wenig braucht, um am Leben zu bleiben. Beide Optionen waren denkbar und in meinen Augen vollkommen gleichwertig. Was für ein Dilemma. Könnte es sich als hilfreich erweisen, einen unlösbaren Widerspruch zum Prinzip zu erheben? Um mich herum Menschen, die genau wussten, was zu tun war. Loretta, die ihre Glaskunst vorantrieb, Toni, der ein Barockhaus sanierte, Mona, die wieder Bilder malte. Maske, der sogar begründen konnte, welche Bedeutung der Boxkampf hatte. Man lebte, und ich war nicht einmal zum See gegangen wie früher. Spazieren, wandern, baden. Der Laden war eine Falle, Mona hatte das erkannt.
Ich las Bücher und Zeitschriften und dachte sogar längere Zeit über die sieben freien Künste des Altertums nach, unter denen sich seltsamerweise die Grammatik und die Logik befanden, aber weder Malerei noch Literatur. Kurz und gut, ich war rundum beschäftigt mit sinnlosen Ideen und hatte keine Ahnung, worauf es hier ankam, bis der Vollstrecker mir die Augen öffnete und sich alles ändern sollte.
In der Euphorie der Wende und unter dem Motto, dass nun alles möglich sei, hatten wir den Laden aufgemacht. Loretta, die Glasmalerin, besaß dieses Haus im Holländischen Viertel, hatte es mühselig saniert und tätigte schon seit Mitte der achtziger Jahre einen Atelierverkauf einmal in der Woche.
„Jetzt ist Westen“, hatte Mona zu ihr gesagt. „Jetzt musst du dein Atelier täglich öffnen, so geht Marktwirtschaft.“
Loretta wusste es, hielt aber gern an alten Gewohnheiten fest.
„Ihr habt genug Zeit“, sagte sie. „Macht ihr doch den Verkauf. Ich…Ich habe keine Zeit dafür.“
Wir besprachen die Idee und ich erinnerte mich daran, wie wir im Spätsommer Neunundachtzig bei Loretta auf dem Hof unter der Pergola die flüchtenden DDR-Bürger mit Sekt gefeiert hatten. Die Wohnungsknappheit würde ein Ende haben. Die Vision einer leeren Stadt, nur wir würden hier bleiben mit all den Außenseitern, Randfiguren, verbotenen Künstlern, unsere Pläne verwirklichen, Kneipen und Läden eröffnen. Wo man hinkam, lautete die Frage, soll man die Gelegenheit nutzen und über Ungarn in den Westen fliehen, bevor es zu spät ist?
„Ich will nicht in den Westen“, hatte Mona gesagt. „Ich will, dass der Westen zu mir kommt.“
Und das tat er dann ja.
Loretta sagte: „Bitteschön. Verkauft meine Spiegel und Glasbilder und eure Sachen auch.“
Nach und nach kamen die anderen vorbei. Die Schmuckgestalterin, der Trödelhändler, einige Grafiker und Maler. Das Geschäft quoll über. Wir waren bald gezwungen, eine strenge Qualitätsauswahl vorzunehmen. Aber nur im ersten Jahr lief es gut, als wir unsere besten Produkte zu Schleuderpreisen anboten. Mona hörte auf zu malen, ich fertigte keine Keramik mehr. Wir hatten einen Laden.
Angezogen von der Attraktion holländischer Backsteinhäuser im historischen Stadtkern nutzten die Touristen zunehmend unser Geschäft, um Informationen über die Entstehung des Viertels zu erlangen oder Statements über den verkommenen Osten abzugeben. Nachdem wir anfangs beleidigt und bockig jede Auskunft verweigert hatten, natürlich auch deshalb, weil uns über die Geschichte des Viertels jegliches Wissen fehlte, verließ Mona bald das gemeinsame Unterfangen und widmete sich wieder ausschließlich der Malerei. Ich eignete mir die notwendigsten Kenntnisse über das Holländische Viertel an. Trotzdem verwechselte ich lange Zeit den Soldatenkönig mit Friedrich dem Großen und sagte schlicht: "Dem König haben die holländischen Handwerker imponiert, er wollte sie nach Potsdam locken."
Wenn ich schlecht gelaunt war, wies ich wortlos auf den gegenüberliegenden Giebel, an welchem die Jahreszahl 1742 prangte.
Die meiste Zeit jedoch saß ich am Schreibtisch und liebte über alles den Blick, den ich durch das Fenster auf den tiefblauen Himmel über den roten Häusern hatte.
Anfangs stand der Schreibtisch anders, quer in der Mitte des Ladens am schmalen Wandstück zwischen den Fenstern, so dass jeder Kunde, der hereinkam, zunächst in das erwartungsvolle Gesicht der Inhaberin blickte. Unangenehm für beide Seiten, fand ich. Deshalb stellte ich den Tisch vor das hintere Fenster, saß fortan seitlich zur Kundschaft und hatte außerdem den Vorteil, die Straße beobachten zu können.
Das undurchdringliche Blau des Himmels über den roten Dächern faszinierte mich. Das Blau war absolut. Ich erdete mich an diesem Schreibtisch, und niemand konnte mir weismachen, woanders sei es schöner. Nun war es jedoch vorbei mit dem schattigen Platz.
Ich stand auf, als hätte ich inzwischen mehrere Zentner zugelegt und ging nach hinten. Ich musste unbedingt sofort Loretta erzählen, was passiert war.
Durch den Flur und das Lager gelangte ich in ihre Werkstatt. Niemand da. Ich rief im Treppenhaus nach ihr. Keine Antwort. Ich griff zum Telefon, um Toni anzurufen.
In seinem Büro lief der Anrufbeantworter. Ich hatte noch nie auf so einen Apparat gesprochen, holte tief Luft und redete schnell nach dem Piepton: ”Hier ist Nora, ich möchte Toni sprechen, bitte ruf' an, es ist wichtig.”
Ich ging zurück in den Laden, sah mich um, ging in die Werkstatt und wieder nach vorn. Erst mal Kaffee kochen, beschloss ich, und dann hinsetzen und nachdenken.
Auch ohne einen Blick in die Bücher war klar, dass der Vollstrecker Recht hatte; ich sollte den Laden aufgeben. Meine Geschäftsbücher waren kleine Hefte, in denen jedes verkaufte Stück aufgelistet war, jedoch nicht für das Finanzamt, sondern als Beleg für die Klientel, die ihre Ware zu mir in Kommission gab. Der Umsatz würde kaum steigen, denn obwohl ich nichts investierte, erhöhten sich die Schulden ständig. Wieso vermehrten sich die Schulden, wenn der Umsatz zwar schwach, aber konstant war? Wofür gab ich Geld aus? Das schien ein unbekanntes Naturgesetz zu sein. Ich tätigte keine Einkäufe, keine Möbel, keine Geräte, kein Hausrat, keine Kleidung. Ich zahlte zweihundert Mark Miete an Loretta, bei ihr war ich bereits seit drei Monaten im Rückstand, was mich allmählich kümmerte. Ich nahm meine Mahlzeiten im Café ein, die mich nichts kosteten, weil ich dort drei Abende in der Woche in der Küche aushalf. Manchmal fuhr ich mit Toni nach Berlin in ein Restaurant und ins Kino. Wir zahlten abwechselnd. Aber auch mit der Wohnungsmiete war ich in Rückstand geraten. Ich schob die „Geschäftsbücher“ beiseite und wusste, dieses Unternehmen muss beendet werden. Schluss, aus, vorbei, so schnell wie möglich.
Toni hatte mich oft kritisiert. „Du betreibst einen Laden“, sagte er. „Aber du machst nichts draus. Du gibst dir keine Mühe.“
Er hatte Recht. Geschäftsinhaber waren rührig, sie kümmerten sich, sie feilschten mit den Lieferanten, machten Sonderangebote, ließen sich ständig etwas einfallen, machten Werbung, versuchten aufzufallen und suchten Partner. So ging Marktwirtschaft. Ich wusste es, aber was hatte das mit mir zu tun? Ich war hier nur zufällig.
Ich hoffte noch eine Weile auf Tonis Rückruf und beschloss, den Abend abzuwarten. Ich hängte ein Schild in die Glastür
mit der Aufschrift: ”Geschlossen”, und machte den Laden zu.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Den späten Nachmittag verbrachte ich mit einem Spaziergang. Das erste Mal in diesem Jahr lief ich zum Schlosspark.
Ich fühlte mich plötzlich unwohl beim Anblick des verpassten Sommers. Der wunderbare See, sauber und klar, nach Schilf duftend und frischem Wind; er blinkte in vereinzelten Lichtpunkten ohne den geringsten Vorwurf.
Der Sommer war vorbei, ich saß hier und hatte alles versäumt. Die Sonne, das Wasser und den Liebhaber. Ich war pleite und musste von vorn anfangen. Ich kehrte zurück in die Stadt.
Im Hofcafé bestellte ich ein Glas Rotwein, nahm eine Wochenzeitung aus dem Halter, setzte mich allein an einen Tisch und wartete auf Toni. Die meisten Stammkunden waren da, und wie jeden Abend war die Kneipe voll. Stammgäste und Fremde machten den Aufenthalt interessant, auch wenn man allein war. Ich wechselte ein paar Worte mit dem Wirt und überlegte, ob ich statt drei mal, jeden Abend kochen sollte. Ich saß am Tresen, um mich in Ruhe auf meinen platonischen Freund vorzubereiten. Aber er kam nicht. Ich las die Zeitung von hinten nach vorn. Ich bestellte ein Omelett und einen französischen Salat, trank noch ein Glas Wein und wurde müde. Ich musste nur vier Treppen ersteigen, um in die kleine Wohnung zu gelangen. Es war seit Monaten der erste Abend, den ich ohne Toni verbracht hatte. Welch rätselhaftes Zusammentreffen.