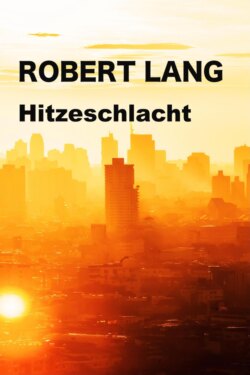Читать книгу Hitzeschlacht - Robert Lang - Страница 3
Erstes Kapitel: Hitzewelle
ОглавлениеRobert Lang
Hitzeschlacht
Roman
Prolog
Der Himmel wölbt sich in mattem Grau über der Stadt. Am Abend soll ein Gewitter aufziehen, aber zu dieser Vormittagsstunde ist davon noch nichts zu spüren. Die Luft ist stickig und macht das Atmen schwer, schon am frühen Morgen ist die Temperatur wieder auf dreißig Grad geklettert, und es soll bis zum Nachmittag noch schlimmer werden.
Ausgerechnet heute ist im Konferenzraum 12 des „Frankfurter Hof“, des besten Hotels am Platz, die Klimaanlage ausgefallen. Eilends herbeigerufene Techniker finden den Fehler nicht sofort, aber der Festakt zu Ehren des Jubilars kann so kurzfristig nicht in einen anderen Raum verlegt werden, weil man eine provisorische Bühne errichtet hat, auf der ein kleines, aber erlesenes Orchester Schuberts‘ „Forellenquintett“ zum Besten geben soll. Die Musiker sind dabei, ihre Instrumente noch einmal nachzustimmen, was dringend erforderlich ist, weil sich durch die Hitze die Saiten ihrer Instrumente dehnen, und das ruiniert jeden Klang.
Es sind an die achtzig Einladungen verschickt worden, aber beinahe die Hälfte der Eingeladenen hat sich wegen anderweitiger Verpflichtungen entschuldigt, ein paar sind - ohne abzusagen - ferngeblieben, vielleicht der Hitze wegen, vielleicht aber auch, weil sie kein Interesse an einem alten Geschäftsmann haben, der von der Stadt mit schwülstigen Reden und einer Ehrenurkunde für seine besonderen Verdienste um Versöhnung, Bildung und Kultur ausgezeichnet wird.
Richling hat sich in eine der hinteren Reihen gezwängt und schwitzt wie ein Schwein, wie er selbst es formulieren würde, weil er die Dinge gern beim Namen nennt. Das liegt zum einen an seinem Körper, den man wohlmeinend als beleibt bezeichnen mag; zum anderen hat er sich an dem reichhaltigen Büffet schon ein paar Lachshäppchen und zwei Glas Sekt genehmigt, was er besser gelassen hätte, denn das Zeug will jetzt partout aus all seinen Poren wieder hinaus.
Wenn er um sich schaut, sieht er nur piekfeine Leute, die viel zu nobel sind, um zu schwitzen. Die transpirieren stattdessen, denkt er voller Hohn. Und die Weiber sind mitten im Sommer mit mehr Schmuck behängt als ein Weihnachtsbaum Lametta trägt.
Der Oberbürgermeister ist an diesem Tag unabkömmlich, weil er bei einer Veranstaltung des Deutschen Städtetages in Dresden auftritt, und so muss für die Laudatio sein Stellvertreter herhalten, der gerade nach einem Blick auf die Uhr den Saaldiener gebeten hat, die Tür zu schließen, weil nicht anzunehmen ist, dass noch weitere Gäste hinzukommen. Das Gemurmel in den Reihen verstummt. Die Musik setzt ein.
Irgendein Schlaumeier ist auf die Idee gekommen, ein Fenster aufzureißen, aber die Luft steht still, und so ist es in dem kleinen Saal inzwischen genauso heiß und schwül wie draußen im Freien.
Richling, der außer ein paar gelegentlichen Takten Wagner so gut wie nie klassische Musik hört und sich für diese auch nicht die Bohne interessiert, hätte wohl schleunigst das Weite gesucht, wenn er gewusst hätte, dass das verdammte Stück eine geschlagene Dreiviertelstunde dauert. Er schließt die Augen, faltet die Hände über seinem Bauch und hofft, dass das ganze Theater irgendwie vorübergeht. Er sehnt sich nach einer kalten Dusche, und auf die Toilette wird er auch bald wieder müssen. So ist das eben bei Männern, wenn sie alt werden.
Ohnehin hat er nicht die geringste Ahnung, warum er zu diesem Festakt eingeladen worden ist; natürlich kennt er Erdmann dem Namen nach, und bei Google hat er herausgefunden, dass dieser der reichsten Männern der Stadt ist und vor kurzem seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag gefeiert hat. Das ist bis auf ein paar Banalitäten alles, und persönlich begegnet ist er ihm nie. Wäre er nicht ohnehin in der Nähe gewesen, hätte er sich diese Veranstaltung nicht einmal im Traum angetan. Er kann sich seinen Schampus selbst kaufen.
Endlich ist das Orchester fertig, das ermattete Publikum applaudiert dankbar, weil zu hoffen ist, dass man nun bald wieder hier rauskommt, in ein klimatisiertes Büro oder Auto, nur raus aus dieser Sauna.
Der stellvertretende Bürgermeister, vielleicht mit Rücksicht auf die widrigen Umstände, vielleicht aber auch, weil lange Reden nicht seine Sache sind, tritt an ein Mikrofon am rechten Bühnenrand und gibt einen kurzen Abriss von Erdmanns Lebenslauf; den Kriegsjahren, der Auswanderung nach Palästina noch im Vorschulalter, seiner Zeit in den USA, wo er den Grundstein für sein beträchtliches Vermögen gelegt hat, seiner Rückkehr nach Frankfurt, und natürlich den vielen Wohltaten, die er seiner Heimatstadt im Laufe von mehr als fünf Jahrzehnten erwiesen hat. Er betont, dass die Stadt Frankfurt diese Auszeichnung in den letzten zweihundertzwanzig Jahren nicht öfter als dreißig Mal verliehen hat. Um dem gestressten Publikum das Kopfrechnen zu ersparen, fügt er hinzu, dass eine Veranstaltung wie die heutige statistisch gesehen nur alle sieben Jahre stattfindet. Gott sei Dank, mag ein Teil der Gäste denken.
Richling hört kaum zu, ihm läuft der Schweiß von der Stirn in die Augen und er atmet so schwer, dass sich eine ältere Dame, die vor ihm sitzt, beunruhigt zu ihm umdreht und mit den Augen fragt, ob er in Ordnung sei. Lass mich in Ruhe, du alte Vettel!
„Und nun einen Applaus für den Mann, der sich wie kaum ein anderer für die Belange unserer Stadt eingesetzt hat. Frankfurt wäre ohne diesen Mann nicht das, was es heute ist. Bitte, Herr Johannes Erdmann!“
Erneuter Applaus, etwas lebhafter als zuvor, und auf die Bühne schlurft ein alter Mann in einem schwarzen Anzug, auf dem Kopf ein ebenso schwarzes Käppchen, unter dem schneeweißes, aber noch volles Haar hervorschaut. Noch bevor der Beifall verklungen ist, nimmt er aus der Hand des Bürgermeisters die Ehrenurkunde der Stadt entgegen, bedankt sich mit einem langen Händedruck und wendet sich dann dem Mikrofon und damit auch dem Publikum zu.
„Vielen Dank, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren.“ Er ist sichtlich gerührt. „Meine Mutter sagte, als ich einst noch ein kleiner Junge war, zu mir…“
Richling ist wie vom Donner gerührt, er sitzt auf der Vorderkante seines Stuhls, der unter dem Gewicht des massigen Körpers beinahe unter ihm wegrutscht, und seine Augen quellen ihm fast aus den Höhlen. Seine Lippen bewegen sich stumm, ein Speichelfaden hängt von seinem rechten Mundwinkel herab und er sieht aus, als hätte er ein Gespenst gesehen. Sein Unterkiefer beginnt Luft zu kauen, alle Farbe ist aus seinem Gesicht gewichen. Es ist ein Gespenst, das da vorne steht, aber es ist ein sehr reales und sehr lebendiges Gespenst.
Sein Verstand droht auszusetzen, Bilder von Schmach und Scham, von Aufruhr und Wut folgen in wilder Abfolge, das alles geschieht in Sekunden.
„Das ist nicht Erdmann“, flüstert er endlich, „das ist nicht Erdmann.“
„Pssst!“
„Das ist gar nicht Erdmann…“ Er kann es nicht fassen. Er hat den Alten zuerst nicht erkannt, als dieser die Bühne betrat. Aber er kennt diese Stimme. Die hohe, singende Stimme, die durch Mark und Bein geht, eine Stimme, die schon vor einem halben Jahrhundert so geklungen hat; er würde sie niemals vergessen, nicht bis zum jüngsten Gericht. „Das ist nicht…“
„Jetzt halten Sie aber die Klappe“, die ältere Frau vor ihm schaut jetzt nicht mehr besorgt, sondern wütend.
„Das ist Seligman, Joshua Seligman! Der Jud‘…“
Köpfe rucken herum, entgeisterte Blicke treffen ihn, die er aber nicht mehr bemerkt, denn er springt bereits auf und verlässt hastig den Saal, in dem es schlagartig totenstill geworden ist. Aber kaum hat er die Tür hinter sich zugeschlagen, bricht ein mittlerer Tumult los.
Der alte Mann steht am Mikrofon und kann sich ein feines Lächeln nicht verkneifen. Er weiß ganz genau, wer da soeben die Flucht angetreten hat.
Joshua Seligman, heute bekannt als Johannes Erdmann, wartet, bis es im Publikum wieder ruhig geworden ist; dann setzt er seine Rede fort, ohne auf das soeben Geschehene einzugehen. Er hat seinen Spaß an diesem kurzen Zwischenfall gehabt, denn schließlich hat er sich diesen Spaß selbst ausgedacht.
Der Rest der Veranstaltung verläuft ungestört, und nachdem Erdmann seine Rede beendet und nochmals auf das Büfett hingewiesen hat, springen seine Gäste auf und eilen nach draußen. Immerhin haben sie gänzlich unverhofft eine saftige Klatschgeschichte aus dieser insgesamt recht unerfreulichen Veranstaltung mitnehmen können. Und das sättigt um einiges nachhaltiger als jedes noch so leckere Lachshäppchen.
1
Rebecca Silberschmied kommt nach Unterrichtsschluss am Goethe-Gymnasium gegen 13:30 Uhr bei ihrem Großvater an. Sie isst dort zu Mittag und verlässt kurz darauf das Haus im Frankfurter Westend, um nach Sachsenhausen zu fahren und dort mit ihrer besten Freundin für einen Test in Chemie zu pauken. Die zerknitterte U-Bahnfahrkarte in ihrer Hosentasche belegt dies später; einen Rückfahrschein finden die Ermittler nicht. Die junge Frau besitzt keine Monatskarte, weil sie in Fußnähe zu ihrer Schule wohnt und sich deshalb eine solche nicht für sie lohnt.
Und da auch ihre Freundin später aussagt, dass sich Rebecca für mehr als zwei Stunden in ihrer Wohnung aufgehalten hat, fokussiert sich die Suche nach ihr auf die Umgebung der U-Bahn-Station, an der sie nach menschlichem Ermessen ihre Heimfahrt hätte antreten sollen.
Die Beamten, die sofort nach Eingang der Vermisstenanzeige ausgeschwärmt sind, um nach möglichen Augenzeugen zu suchen, erfahren - wie zu vermuten - im Westend nichts Verwertbares. Dagegen glaubt eine Zeitungsverkäuferin in Sachsenhausen gesehen zu haben, wie ein Mädchen von einem Mann angesprochen wird und kurz darauf in ein Auto steigt – oder eher hineingeschubst wird, als dass sie es freiwillig tut. Das Fahrzeug ist dunkel und sehr gepflegt, vielleicht ist es ein BMW oder Audi. Den Mann, der das Mädchen angesprochen hat, kann sie nur ungenau beschreiben. Er sei groß gewesen, mit Glatze oder Kurzhaarschnitt.
Der Beamte, der mit der Verkäuferin gesprochen hat, hat dieser Aussage den Hinweis hinzugefügt, dass die Frau trotz der frühen Stunde der Befragung (ca. elf Uhr vormittags) deutlich nach Alkohol riecht, und dass sie offensichtlich ein starkes Mitteilungsbedürfnis besitzt, wenn sie getrunken hat. Beides entwertet ihre Aussage möglicherweise ganz, zumindest aber teilweise. Ein Witzbold hat mit Bleistift hinter dem entsprechenden Abschnitt des Protokolls das Wort „Schnapsdrossel“ gekritzelt.
Gefragt, warum sie ihre Beobachtung nicht schon am Vortag der Polizei gemeldet hat, kann die Frau das nicht erklären. Der Beamte mutmaßt, dass sie auch zum Zeitpunkt der möglichen Entführung von Rebecca S. alkoholisiert war und deshalb Angst hatte, sich zu blamieren.
Trotz aller Unwägbarkeiten bezüglich dieser Zeugenaussage kann man davon ausgehen, dass das Mädchen auf den wenigen Metern von der Haustür ihrer Freundin zur nächstgelegenen U-Bahn-Station entführt worden ist. Es findet sich trotz aller Bemühungen nirgends eine Aussage, die Zweifel an diesem Sachverhalt aufkommen lässt. Man hat aber jetzt eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wann Rebecca Silberschmied überfallen wurde. Tage später wird der Pathologe feststellen, dass der Tod der Schülerin vermutlich bald darauf eingetreten ist, wobei er damit eine Zeitspanne von einigen Stunden meint. Daraus folgt für Kommissar Schuchardt von der Mordkommission, dass es bei diesem Verbrechen nicht um Lösegeld gegangen ist.
Die Freundin der Toten weint und weint, und zwischendurch erfahren die Beamten, dass gemeinsames Chemielernen im Wesentlichen bedeutet, dass sie zwei Stunden lang über die Jungs in ihrer Klasse lästern und sich zwischendurch eine große Pizza kommen lassen, etwas, das bei Rebecca zuhause nicht möglich wäre, denn ihre Eltern und der Großvater haben eine ziemlich vorsintflutliche Meinung zu Fast Food (und nebenbei auch zu Jungs).
Rebecca trägt eine weiße Bluse, als sie bei Claudia eintrifft; sie zieht sie aber direkt nach ihrer Ankunft aus und setzt sich in einem nabelfreien Top auf den Balkon, ein weiterer Akt zivilen Ungehorsams gegen die restriktive Jugendpolitik in ihrer Familie.
Den Gedanken, dass die mutmaßlich Entführte einen festen Freund haben könnte, empfindet ihre Freundin als abwegig. Ihre Eltern würden sie eher in einem Kohlenkeller anketten als eine solche Liaison zuzulassen. Sie sei auch mit Sicherheit noch Jungfrau, ansonsten wüsste sie als ihre engste Vertraute es bestimmt. Der Pathologe wird auch das bestätigen, was eher nebenbei geschieht angesichts all der Gräueltaten, die Rebecca Silberschmied zugefügt worden sind. „Verkrustetes Blut an den Innenseiten beider Oberschenkel“, spricht er resigniert in sein Diktiergerät, bevor er an diesem Tag nach Hause geht, um einen Joint zu rauchen, mindestens so groß wie ein Ofenrohr.
Mutmaßliche Entführung in der Nähe einer U-Bahn-Station nachmittags gegen siebzehn Uhr dreißig. Dunkles Fahrzeug, großer Kerl mit kurzem Haar plus ein Fahrer. Viel ist das nicht.
Sofort schickt die Polizei ein paar Spezialisten zur Wohnung der Familie Silberschmied, lässt das Telefon an ein Aufnahmegerät koppeln und wartet auf einen Anruf, der in den üblichen ersten vierundzwanzig Stunden nicht eingeht. Dann tritt der Vater des Mädchens auf den Plan und verbietet den Beamten die weitere Überwachung. Zu groß sei das Risiko, dass die Entführer Wind davon bekommen und ihre Tochter das büßen muss.
Am Morgen nach dem Verschwinden von Rebecca fallen ein paar Beamte im Goethe-Gymnasium ein und befragen ihre Freunde und Freundinnen einzelnen und parallel in mehreren eilig geräumten Klassenzimmern. Von den Mädchen wollen die Beamtinnen unter anderem wissen, ob Rebecca vielleicht von irgend einem Jungen besonders hartnäckig angehimmelt wird. Doch diese Spur führt offenbar nirgendwo hin, und man lässt sie fallen, sobald zwei Stunden später die Aussage der Zeitungsfrau vorliegt. In der zehnten Klasse fährt noch niemand einen Wagen der Oberklasse; also kann es kein durchgedrehter jugendlicher Verehrer gewesen sein.
Man überprüft selbstverständlich auch die Kartei der polizeibekannten Sexualstraftäter und unter diesen welche, die wegen Übergriffen auf junge Mädchen eingesessen haben und erst vor kurzem wieder entlassen worden sind. Von diesen kommen vier in die engere Auswahl, und die Polizei rückt mit Spezialeinheiten aus, um diese aufzusuchen und zur Sache zu befragen.
Einer der vier liegt im Krankenhaus, einer ist unterwegs in Südfrankreich, ein dritter hat ein einwandfreies Alibi. Der vierte Mann wohnt bei seiner Mutter, und er erklärt, dass er spezielle Medikamente nimmt, die ihn impotent machen. „Sie könnten mir Marilyn Monroe nackt und in High Heels auf den Schoß setzen, und bei mir würde sich absolut nichts rühren.“ Nach einem Anruf bei seinem Arzt und nach einer einvernehmlich entnommenen Blutprobe lässt man den Mann schweren Herzens in Ruhe.
2
„Wir haben es der Kleinen anständig besorgt, Chef, und jetzt wollen wir wissen, wann Sie endlich mit der Kohle rüberkommen.“ – „Ihr solltet mich doch in nächster Zeit nicht abrufen, ihr Idioten!“
„Die Jungs sind ungeduldig, sie wollen feiern. Und wir sind auch keine Idioten. Wir wissen, wann es Zeit zu säen ist, und wir wissen, wann es Zeit zu ernten ist.“
„Ich muss morgen Mittag zur Bank. Ich hab solche Summen nicht unter dem Kopfkissen liegen. Sagen wir, achtzehn Uhr in eurer Wolfsschanze. Und vorher kein weiterer Kontakt, ist das klar?“
„Klar. Nichts für ungut, Richling. Wir sind alle noch ein bisschen durch den Wind nach dieser Aktion.“
Wolfsschanze nennen sie einen kleinen Schrebergarten in Frankfurt-Rödelheim, der den Großeltern eines Mitglieds der Bande gehört und den sie ungestört nutzen dürfen, weil ebendiese Großeltern nicht mehr mobil genug sind, um noch Gartenarbeit zu verrichten. Zum Grundstück gehören eine kleine Hütte mit einem Kühlschrank und ein Elektrogrill unter einem kleinen Vordach. Die Bande trifft sich hier regelmäßig während der Saison von April bis Oktober. Im Garten hängt an einem neun Meter hohen Mast eine große Deutschland-Fahne - eine Reichbürgerflagge und die noch härteren Sachen zieren die Innenwände der Hütte und werden in einer alten, abschließbaren Holztruhe verwahrt, wenn die Jungs nicht anwesend sind.
Richling trainiert im Garten seine beiden Dobermänner Adolf und Joseph, als sein Handy summt. Die Viecher sind zu dämlich, um einer mannshohen Strohpuppe an die Kehle zu gehen, aber sie kosten ihn ein Vermögen an Frischfleisch. Immer wieder beißen sie sich an den längst zerfetzten Beinen fest, obwohl er ihnen schon ein dutzend Mal gezeigt hat, wie man es richtig macht. Naja, vielleicht macht die Hitze den Burschen genauso große Probleme wie ihm. Er schmort seit Tagen im eigenen Saft, und im Fernsehen sagen sie, dass dieses verfluchte Wetter noch sehr lange so oder vielleicht noch schlimmer weitergehen wird.
Wenn man den Zeitungen vom heute früh glauben kann, hat seine Jungschar gute Arbeit geleistet. Das Judenmädchen lebt nicht mehr.
Aber seltsamerweise ist er nicht wirklich zufrieden, sein Triumph ist nicht vollkommen. Vielleicht liegt es daran, dass die Medien kaum ein Wort darüber verlieren, auf welche Weise die kleine Prinzessin um die Ecke gebracht worden ist. Nur eine einzige Zeitung hat das Ganze ein „grausames Verbrechen“ genannt, alle anderen Drecksblätter haben nur erwähnt, dass die Leiche gefunden wurde. Das fühlt sich für ihn so an, als sei er um etwas Wichtiges betrogen worden. Etwas, das er nicht genau benennen kann, das er aber deutlich fühlt.
Fünfzig Riesen hat er sich den Spaß kosten lassen, obwohl ihn bald nach der Vereinbarung des Deals der Verdacht kam, dass er das Ganze auch für einen Bruchteil dieser Summe hätte haben können. Seine Jungs sind doch angeblich vom selben Schlag wie er. Stattdessen zocken sie ihn ab und lachen sich wahrscheinlich hinter seinem Rücken über ihn kaputt.
Er hat ein paar Wertpapiere verkaufen müssen, die in den letzten vierundzwanzig Monaten etwa ein Drittel ihres Kurswertes verloren haben und deshalb tun ihm die fünfzigtausend doppelt weh. Vielleicht sollte er nachverhandeln, wenn sie sich morgen treffen. Schließlich sitzen sie im selben Boot, und er hat die Bande mindestens ebenso sehr in der Hand wie diese ihn.
Er spritzt seine Hunde mit dem Wasserschlauch ab, bei diesen äußeren Bedingungen ein herrlicher Spaß für die Bestien. Danach sperrt er sie in ihren Zwinger und geht ins Haus, um selbst zu duschen. Während er sich vom kühlen Nass berieseln lässt, versucht er sich vorzustellen, wie es wäre, wenn jetzt Gas anstelle von Wasser aus der Brause käme. Das ist ein wenig beklemmend, aber nicht wirklich unangenehm. Es muss nur die richtigen Leute treffen, dann ist die Vorstellung gar nicht so schlimm.
Er trocknet sich ab, zieht einen Morgenmantel an und setzt sich an seinen Computer, um ein paar Wertpapierpositionen zu liquidieren. Dann transferiert er die Erlöse auf sein Girokonto und ruft seinen Bankberater an, um ihm zu sagen, dass er morgen Nachmittag achtzigtausend Euro in bar braucht. Der Mann faselt etwas über die Gefahr von Bargeschäften, und Richling lässt ihn reden. Nach ein paar weiteren Sätzen gibt der Berater nach und sagt ein wenig verschnupft, es sei schließlich Richlings Geld.
So ist es, du Penner!
3
Schuchardts Katze tut, was sie immer tut, wenn dieser versucht, morgens die Zeitung zu lesen. Kaum, dass er sich an den Küchentisch gesetzt hat, springt sie auf den Tisch und legt sich – schnurrend wie ein Rasenmäher – auf genau diese Zeitung und ist mit friedlichen Mitteln nicht mehr zu vertreiben. Das hat er nun davon, dass er dieses dumme Tier aus dem Heim geholt und zu sich genommen hat. „Runter mit dir, du Räuber, sonst bringe ich dich zurück zu der alten Schabracke. Da kenne ich gar nichts.“ Das dumme Tier bleibt unbeeindruckt und schnurrt einfach weiter.
Er hat den kleinen Kerl aus dem Tierheim geholt. Das war vor acht Wochen, nachdem er einen kniffligen Fall gelöst hatte und auch dabei einige prominente Landespolitiker in sein Visier geraten waren. Danach haben sie sie ihn eine Zeitlang wie einen Nestbeschmutzer behandelt und seine Arbeit argwöhnisch beobachtet.
Dieser Sturm hat sich inzwischen – seit alle Fakten auf dem Tisch sind – wieder gelegt. Er aber fühlte sich danach so einsam, dass er sich den lange gehegten Wunsch nach einer Katze erfüllte. Das Resultat dieses Entschlusses liegt nun auf seiner Morgenzeitung und grinst ihn spöttisch an.
Aber Schuchardt steht heute ohnehin nicht der Sinn nach Zeitungslektüre. Man hat das Mädchens im Stadtwald gefunden. Rebecca Silberschmied, noch nicht einmal ganz fünfzehn Jahre alt. Sie war zuletzt gesehen worden, als sie in ein wartendes Fahrzeug einstieg, vor inzwischen vier Tagen.
Er hat schon geahnt, dass diese Geschichte schlimm ausgehen wird, denn den verzweifelten Eltern des Mädchen ist bis zum späten gestrigen Abend keine Lösegeldforderung zugestellt worden. Das ist für gewöhnlich kein gutes Zeichen.
Der Kommissar verzichtet an diesem Morgen auf feste Nahrung, denn ihm steht ein Besuch in der Pathologie des Uniklinikums bevor, und dieser – man hat ihn vorgewarnt - soll unappetitlich werden. Multiple schwere und schwerste innere und äußere Verletzungen.
Den Beamten, der ihn angerufen hat, weist er an, die Eltern noch nicht zu informieren. Er selbst wird diese traurige Pflicht erfüllen, denn der Fall wird ohnehin bei ihm landen, weil es jetzt Mord ist und nicht mehr nur Kidnapping. Und wenn er von Anfang an dabei ist, erfährt er mehr, als wenn er solche Dinge einem Kollegen überlässt.
Man hätte bei der Familie des Mädchens eine Genehmigung zur Obduktion einholen können, hat aber darauf verzichtet. Mord ist Mord, und da steht Landesgesetz über religiösen Vorschriften. Die Eltern von Rebecca sind nicht gerade ultraorthodox und hätten wahrscheinlich sowieso zugestimmt. Bei allem ist Eile geboten, denn der Leichnam muss so schnell wie möglich beerdigt werden. Und zwar per Erdbestattung, denn Verbrennung ist bei Juden nicht üblich.
Sein erster Weg wird ihn also in die Pathologie führen, denn er will vorbereitet sein, wenn die Fragen der Angehörigen und der Presse auf ihn einprasseln. Denn das werden sie unausweichlich tun.
Schuchardt ist erst vor ein paar Tagen aus einem einwöchigen Urlaub im Schwarzwald zurückgekehrt, wo er mit seiner Katze in dem Renchtal-Städtchen Oppenau in einer Ferienwohnung gewohnt, dreimal täglich gut und reichlich gegessen und den Stress der letzten Monate durch ausgedehnte Wanderungen in der Umgebung abgebaut hat. Er muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass der Erholungseffekt dieser Woche schnell wieder aufgebraucht sein wird.
„Na, Bobby“, fragt er seinen Kater, „meinst du auch, dass das eine böse Geschichte wird?“ Aber dieser hat sich offenbar noch keine Meinung zu diesem Fall gebildet, und überhaupt sind Kategorien wie Gut und Böse für einen vier Monate alten Kater noch kein Thema.
„Katze 1, Schuchardt 0“, brummt der Kommissar.
Schuchardt hat nicht die geringste Lust auf diese Ermittlung - ein totes Mädchen, und als ob das nicht genug wäre, ein jüdisches Mädchen, das impliziert vielleicht eine politisch motivierte Tat durch Nazis oder andere Judenhasser, beispielsweise aus der islamistischen Ecke, und das ganze Paket riecht überhaupt nicht verlockend. Das ist schlüpfriges Parkett, auf dem man nur zu leicht ausrutschen und sich das Genick brechen kann. Ihm liegt der Fall schon seit Tagen schwer im Magen, obwohl er von dem Hintergrund der Tat und dem Tod des Mädchens noch gar nichts gehört hat; nein, allein deshalb, weil Rebecca aus einer der angesehensten Frankfurter Familien kommt und er von Beginn an skeptisch war, was ihre Überlebenschancen anging.
Und so ist es dann gekommen. Er hat es schon gewusst, als er an diesem Morgen die SMS vom Polizeipräsidenten gelesen hat. „Rückruf, aber bitte sofort!!!“ Schuchardt mag keine Nachrichten mit drei Ausrufezeichen, egal, von wem sie kommen.
Er setzt Bobby in die oberste Höhle seines Kratzbaums, sagt ihm, er solle die Stellung halten, bis er wieder nach Hause kommt.
Danach zieht er eine leichte Windjacke an, um in ihren Taschen Handy, Schlüssel und ein paar Kirschbonbons zu verstauen; dann verlässt er die Wohnung. Es ist so warm, dass er auch nur in Badehose und Strandlatschen hätte ausgehen können. Nur tut man so etwas nicht, wenn man sich auf den Weg zu einem Mordopfer macht.
4
Die Mitglieder der Gang treffen sich schon zwei Stunden vor dem mit Richling anberaumten Termin, um ihre Darstellung der Tat aufeinander abzustimmen. Es ist nicht alles gut gelaufen vor vier Tagen, weiß Gott nicht, denkt der Anführer der Bande, der gerade seine Krawatte lockert. Er ist direkt von seiner Arbeit im Backoffice einer Frankfurter Großbank hierher zur Wolfsschanze gefahren, denn es war nicht mehr genügend Zeit, um nach Hause zu fahren und sich umzuziehen.
Aus Angst vor Gewittern (die dann aber ausgeblieben sind) haben sie nach dem letzten Treffen den Stecker des Kühlschranks im Gartenhäuschen gezogen, mit dem Resultat, dass sie vorläufig nur lauwarmes Bier trinken werden.
Das Mädchen ist lammfromm gewesen, nachdem sie es in ihren Wagen verfrachtet haben. Kreidebleich und viel zu verängstigt, um Fragen zu stellen. Schockstarre wahrscheinlich, oder aber eine Vorahnung dessen, was ihr gleich zustoßen würde.
Aber nicht das Opfer treibt ihn im Moment um, das ist tot und vergessen. Es sind zwei seiner Jungs, die ihm Sorge bereiten.
Der kleine Detlev hat keinen hochgekriegt, als er an der Reihe war, sich mit der kleinen Jüdin zu vergnügen. Das hat zwar beim Rest der Bande hämisches Gelächter hervorgerufen, bei ihm selbst aber haben die Alarmglocken geläutet.
Und später, als alles vorbei war, hat derselbe Detlev noch an Ort und Stelle unter einen Baum gekotzt. Er ist einem solchen Stress nicht gewachsen, und das ist beunruhigend. Er kann sich lebhaft vorstellen, was Richling dazu sagen wird und er überlegt, ob es nicht besser ist, es ihm zu verschweigen.
Wegen der Sache mit dem Ritzen der doppelten Acht könnte er sich selbst ohrfeigen. Er hätte Rocco, den sie wenig liebevoll auch „das Frettchen“ nennen, aufhalten müssen. Aber das hat er versäumt, weil es ihm im ersten Moment als richtig erschien, ihre Unterschrift unter den Mord zu setzen. Schließlich ist es nicht nur das Geld gewesen, das sie zu dieser Tat bewegt hat. Sie wollten der Welt zeigen, dass sie sich dem Kampf gegen das sich ausbreitende Judentum verschrieben haben, und zwar mit Taten anstelle der üblichen Stammtischparolen oder eilig hingeschmierten Graffitis an der Mauer eines jüdischen Friedhofs.
Wenn er Richling richtig verstanden hat, dann ist diese Sache ein persönlicher Rachefeldzug für etwas, das mindestens eine Generation zurückliegt. Ihm selbst ist das an sich egal, aber er weiß, dass Emotionen zu Fehlern führen können, und er kennt Richling noch nicht besonders gut.
Also, einer mit weichen Knien und ein anderer mit einer weichen Birne, Detlev und das Frettchen bereiten ihm umso größeren Kummer, je länger er über sie nachdenkt. Vielleicht sollte er beide in einen unbefristeten Urlaub schicken, sie irgendwo für eine Weile zwischenparken, bis der ärgste Rummel vorbei ist. Würde Detlev den Bullen in die Hände fallen würde er in kürzester Zeit umfallen und die ganze Truppe mit sich reißen.
Zu allem Überfluss sind sie allesamt polizeibekannt. Wenn also die Bullen zwei und zwei zusammenzählen, werden sie damit beginnen, ihre Neonazi-Kartei zu durchforsten, und dann herrscht Alarmstufe rot.
Draußen vor dem Grundstück hält ein Wagen, das wird wohl Richling sein. Und ja, er steht kurz darauf in der Tür und taxiert jeden Einzelnen in der Hütte.
Dann hält er auf Matthias zu, den einzigen aus der Truppe, den er von Angesicht zu Angesicht kennt. Die beiden haben die Tat gemeinsam geplant, Richling hat ihn mit Informationen über die Familien Silberschmied und Erdmann versehen, die er selbst durch eigene Recherche im Internet und durch Erkundigungen gesammelt hat.
In dem Raum, in dem eben noch eine aufgekratzte Stimmung geherrscht hat, ist es jetzt still geworden. Alle sind gespannt auf den Auftritt des Fettsacks, denn der hat das Geld mitgebracht, auf das sie warten. Und – Matthias hat es ihnen gegenüber beiläufig erwähnt – wo diese fünfzigtausend Piepen sind, gibt es noch mehr zu holen.
„War der Goldrauschengel dort drüben auch dabei?“ Richling hält sich nicht mit Smalltalk auf.
„Ja, und Sie müssen gar nichts sagen, ich werde ihn noch morgen für eine Zeitlang aus der Schusslinie nehmen. Es hat sich gezeigt, dass er einer solchen Sache noch nicht gewachsen ist. Er selbst weiß es noch nicht, aber er fliegt morgen nach Mallorca. Vorerst für vier Wochen, bis dahin sollte sich der Pulverdampf verzogen haben.“
„Gut so. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte?“
Matthias zieht seine Krawatte jetzt ganz aus, steckt sie in die Hosentasche und öffnet die obersten beiden Knöpfe seines Hemdes.
„Wir hatten noch ein bisschen Spaß mit dem Mädchen, ich hoffe, das ist okay.“
„Das geht mich nichts an, solange ihr Kondome übergezogen und keine Spuren hinterlassen habt. Was sonst noch?“
„Aber klar, Chef, wir sind keine Selbstmörder. Wollen Sie etwas trinken? Wir haben warmes Bier und warme Cola.“
„Nein, aber ich habe gefragt, ob ich sonst noch etwas über euren Auftritt wissen muss.“
„Ja, es ist etwas vorgefallen, das ich unbedingt hätte verhindern müssen - aber ich habe zu spät reagiert.“ Der Boss der Bande windet sich jetzt ein wenig. „Unser Frettchen, der Junge da hinten mit dem Jagdmesser, hat dem Flittchen noch einen speziellen Gruß in den Rücken geritzt, nachdem wir es erledigt hatten. Es ging alles sehr schnell. Sie wissen, was die Doppelacht bedeutet, nehme ich an.“
Richling blickt Matthias an, als hätte dieser einen gewaltigen Sprung in der Schüssel. „Was? Seid ihr denn komplett wahnsinnig geworden?“
„Tut mir leid, Mann.“ Natürlich tut es ihm leid, denn das, was seine Jungs ausfressen, wirft zwangsläufig auch ein schlechtes Licht auf ihn selbst; entweder ist er zu blöde, um einen solch kapitalen Bock zu erkennen, oder es fehlt ihm an Autorität gegenüber seiner kleinen Truppe. Würde man das Letztere von ihn annehmen, träfe es ihn tiefer in seiner Eitelkeit.
„Ich hatte dir doch ausdrücklich gesagt, dass es in dieser Sache noch weitere Jobs zu erledigen gibt. Lukrative Jobs, verdammt! Wie könnt Ihr da schon gleich zu Anfang die Bullen so durch und durch dämlich auf eure Spur bringen? Unglaublich!“
Richling registriert aus dem Augenwinkel, dass nun alle Augen auf ihn Matthias gerichtet sind. Niemand spricht mehr. Die Jungs wollen ihr Geld haben und sich und ihre Tat feiern, und nun wittern sie, dass Richling sich vielleicht weigern wird, sie auszuzahlen. Die Spannung in der drückenden Hitze der Gartenlaube steigt.
Also gibt sich Richling jovial und holt mit einem „Schwamm drüber!“ den Umschlag mit dem Geld aus einer abgewetzten Aktentasche hervor. „Kann ja jedem mal passieren“, schiebt er noch hinterher und übergibt Matthias als dem Ranghöchsten in dieser kleinen Guerillatruppe fünf Bündel mit Banknoten. „Zehntausend für jeden, wie vereinbart. Und bitte halte deinen Laden sauber, Mann. Du weißt hoffentlich, dass eine einzige faule Kartoffel die gesamte Ladung verderben kann. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind es bei dir gleich zwei.“
Richling stellt sich vor, wie diese fünf Kerle über ein fünfzehnjähriges Mädchen herfallen und sie nacheinander vergewaltigen. Es sind Tiere, denkt er, aber sie singen mein Lied.
Matthias nimmt das Geld und wirft jedem seiner Leute eines der Bündel zu, kreuz und quer segelt Richlings schönes Geld durch den Raum, und Detlev ist als Einziger wieder so neben der Spur, dass er seines fallen lässt. Der Junge muss schleunigst weg, das steht fest. Das Geld für einen langen Urlaub hat er jetzt.
Die Spannung hat sich wieder gelegt, alle bis auf Matthias zählen ihren Lohn, denn Kontrolle ist bekanntlich besser als Vertrauen.
5
„Entweder waren es tatsächlich Nazis, oder jemand versucht, es so aussehen zu lassen“, sagt Schimmelpfennig zur Begrüßung, „das kann man ja heutzutage nicht immer so genau sagen.“
„Wie ist sie gestorben?“ Schuchardt bemüht sich nach Kräften, an dem aufgebahrten Leichnam des Mädchens vorbei zu schauen. Auch nach fast dreißig Jahren bei der Kripo, stellt er fest, bist du noch immer nicht vorbereitet auf einen solchen Anblick.
„Langsam und qualvoll. Mehrfache Vergewaltigung, vermutlich durch verschiedene Täter, aber wir haben kein verwertbares Sperma. Das ‚mehrfach‘ schließe ich im Wesentlichen aus den unterschiedlichen Druckmalen an ihren Armen. Ich vermute, sie ist von verschiedenen Tätern auf verschiedene Arten festgehalten worden, während man sie vergewaltigte.
Dazu kommen noch Pfählung und Schädelbruch, letzterer mit Holzsplittern als Rückstand, die „88“ wurde ihr zwischen die Schulterblätter geritzt. Da war sie allerdings schon tot – die Wunden haben nicht mehr nennenswert geblutet.
Letzteres, diese Ritzungen, würde ich an Ihrer Stelle der Öffentlichkeit noch vorenthalten. Was nicht heißen soll, dass ich mich in Ihre Ermittlungen einmischen will. Ich denke nur an den allgemeinen Aufschrei, und dass dieser Ihnen sicher nicht bei der Arbeit weiterhelfen wird.“
Die „88“ ist eine bei Neonazis beliebte Art, den Hitlergruß zu gebrauchen, ohne sich strafbar zu machen. Sie steht für „HH“, den achten Buchstaben des Alphabets.
„Das Mädchen war jüdischen Glaubens“, sagt Schuchardt mehr zu sich selbst. Die Familie ist verwandt mit dem Besitzer einer großen Frankfurter Spedition. Der Vater des Mädchens hat einen guten Namen als Musikagent. Über die Mutter weiß er nichts.
„Was denken Sie, wann ist sie gestorben?“ – „So wie es für mich aussieht, vor etwa vier Tagen. Wann, sagen Sie, ist sie entführt worden?“
„Soweit wir das bisher feststellen konnten, am späten Donnerstagnachmittag.“ Wenn sie seit vier Tagen tot ist, dann haben ihre Mörder nicht viel Zeit verloren, bevor sie Rebecca Silberschmied all diese grauenhaften Dinge antaten.
Dass es mindestens zwei Täter sind, ist als gegeben anzusehen. Als der Wagen neben ihr gehalten hat, ist laut der Zeitungsfrau jemand ausgestiegen, der auf der Rückbank gesessen hat, also war er nicht der Fahrer.
Die „Signatur“, wenn man es denn so nennen will, ist entweder sehr clever gemacht, oder aber äußerst idiotisch; clever, wenn sie als Ablenkung gedacht ist, dämlich, wenn nicht.
Der Pathologe hat zweifelsfrei Recht mit seiner Warnung – andererseits ist Schuchardt lange genug dabei, um zu wissen, dass Verschweigen in aller Regel ein aussichtsloses Unterfangen ist. Irgendeiner quatscht immer.
„Schuchardt, ich würde Ihnen dringend empfehlen, die Eltern davon abzubringen, sich den kompletten Leichnam anzusehen. Zu den gerade beschriebenen Verletzungen kommt Tierfraß post mortem. Das Gesicht, den Kopf und die Schultern der jungen Frau können wir einigermaßen herrichten - was von ihr unter dem Laken übrig ist, sollte niemand sich anschauen müssen, am wenigsten die Angehörigen.“
„Jemand muss sie identifizieren. Wie wollen Sie ihn daran hindern, das Laken zurückzuziehen?“
„Ich kann den Leichnam bis zum Hals zugedeckt hinter einer großen Glasscheibe aufbahren, das Gesicht reicht für eine einwandfreie Bestätigung.“
Schuchardt wird mit der Familie des Opfers zusammenarbeiten müssen, um Aussicht auf Ergreifung der Täter zu haben; ob es dabei ratsam ist, einen möglicherweise politisch-rassistischen Hintergrund zu verschweigen, kann er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber es ist bestimmt eine gute Idee, sich in dieser Hinsicht mit dem Polizeipräsidenten zu verständigen. Wahrscheinlich wird aber binnen kurzer Zeit irgendein Neunmalkluger Mutmaßungen in dieser Richtung anstellen und sie öffentlich kundtun; und dann ist die Katze sowieso aus dem Sack.
Deshalb wird diese Ermittlung wohl zu einem üblen Höllenritt werden. Seine Vorgesetzten, die Politik, die Opferfamilie, die zahlreichen jüdischen Einrichtungen und Stiftungen der Stadt, die Presse, Social Media, Spinner jedweder Couleur – sie alle werden ihm auf die Finger sehen, jeden seiner Schritte kommentieren, aufs Tempo drücken, Kritik äußern, nicht immer angemessen, oft genug ignorant, vereinfachend oder plakativ, das alles liegt in der Natur der Dinge - und in der Natur des Menschen.
Sein Handy summt, es ist Kretschmar von der Spurensicherung. „Ich weiß nicht, ob es Ihnen etwas nutzt, Kommissar, aber uns schien es interessant zu sein.
Sie wissen ja, dass es in unmittelbarer Nähe des Fundortes der Leiche wegen der großen Trockenheit keine verwertbaren Fußspuren gibt. Etwa fünfzehn Meter entfernt von der Stelle sieht das ganz anders aus. Dort hat wohl kurz vor dem Mord die Stadt ein paar Büsche und ein Blumenbeet gewässert, und dort sind wir auf eine ganze Reihe von Stiefelspuren gestoßen. Verstehen Sie, was ich meine? Frische Stiefelspuren in einer Zeit, in der wir seit Wochen fünfunddreißig Grad im Schatten erleben und selbst die Königin von England im String-Tanga herumläuft.“
Schuchardt brummt seine Zustimmung und bedankt sich, bevor er das Gespräch beendet.
Das beweist nichts, sondern ist allenfalls ein Indiz. Aber der Gedanke allein ist zu verführerisch. Radikale Islamisten tragen keine Stiefel, auch nicht, wenn sie Anschläge verüben. Es können einfach ein paar Biker gewesen sein, die an der besagten Stelle ein Picknick veranstaltet haben. Das allerdings ist weit hergeholt, denn die Stelle ist mindestens vierhundert Meter von der nächsten asphaltierten Straße entfernt, wo sie ihre Öfen hätten abstellen dürfen; aber völlig undenkbar ist es nicht. Lachhaft, denkt Schuchardt, es sind Neonazis, auch wenn es dir nicht schmeckt. Und diese Leute wollen auch, dass ihre Tat publik wird.
Aber warum sind sie ausgerechnet auf eine 15-jährige Schülerin verfallen? Sie haben sich Rebecca schließlich vorab ausgesucht und müssen sie eine Zeitlang beobachtet haben.
Vielleicht weiß jemand aus der Familie etwas dazu. Hat es im Vorfeld Auseinandersetzung gegeben? Läuft hier eine private Vendetta? Dreht ein Konkurrent des alten Erdmann durch? Fragen, nichts als Fragen, aber so ist es immer bei seinen Fällen. Wenn es eng zugeht, ziehen sie ihn hinzu und nicht irgendeinen Anfänger.
„Wissen Sie was, Schuchardt…,“ Schimmelpfennig, der alte Haudegen der Pathologie mit fünfdreißig Jahren Berufserfahrung, nimmt seine Brille ab und reibt sich die Augen „… mir geht das immer noch unter die Haut, obwohl ich mindestens fünftausend Leichen auf dem Tisch hatte.“ Seine Stimme klingt brüchig. „Welche Tiere tun so etwas? Und warum tun sie es?“
Ja, warum, denkt Schuchardt. Er antwortet nicht, weil es schwer ist, eine Tat wie diese zu verstehen. Die Schule des Lebens hat ihn gelehrt, dass es solche Verbrechen einfach gibt. Manchmal kann er in die Köpfe seiner Mörder hineinsehen, denn größtenteils sind es Habgier, Rache oder verschmähte Liebe, die zu einer solch verhängnisvollen Tat führen. Eine so unnötige Grausamkeit wie die hier vorliegende ist schwerer zu entschlüsseln, und manchmal findet man auch gar keine Antwort und bleibt fassungslos zurück. Bis zu einem gewissen Grad hat er gelernt, es zu akzeptieren.
Es drängt ihn jetzt, den Auftritt bei den Angehörigen dieses armen Mädchens hinter sich zu bringen. Hier in diesem gekühlten Kellerraum der Uniklinik mit seinen in Weiß gekachelten Wänden und dem Geruch nach Paraffin und Putzmitteln warten keine Antworten mehr auf ihn; die gibt es nur draußen in der unbarmherzigen Hitze dieses Sommers, die die Leute nach und nach verrückt zu machen beginnt.
Als er wieder nach draußen kommt, bricht ihm sofort der Schweiß aus. Achtunddreißig Grad haben sie für den Nachmittag versprochen, und es ist kein Ende in Sicht. Auf dem Beifahrersitz seines Dienstwagens liegt eine halbvolle Flasche Wasser, und er trinkt gierig und in großen Schlucken, obwohl es inzwischen beinahe heiß geworden ist.
Bevor er den Motor anwirft, telefoniert er mit seiner Dienststelle und bestellt einen Polizeipsychologen zum Haus der Silberschmieds. Sicher ist sicher, er weiß nicht, ob er diesen trostlosen Job alleine hinkriegt. Der Mann soll vor dem Haus auf ihn warten.
Als die Zentrale ihm sagt, dass Posche, der Seelenklempner vom Dienst, erst in zwei Stunden vor Ort eintreffen kann, beschließt Schuchardt, bei einer Imbissstube zu halten und ein paar Kalorien zu sich zu nehmen. Das ist schwierig genug, aber es hilft ihm immerhin, die Zeit totzuschlagen.
6
Aaron Silberschmied sitzt regungslos in seinem Sessel und ringt um Fassung. Bis in den achtzehnten Stock des Hotels „Isrotel Tower“ dringt kein Lärm von der Straße, es ist mucksmäuschenstill, wenn man vom gelegentlichen Öffnen und Schließen der Aufzugtür auf seinem Flur absieht.
In Tel Aviv ist es ebenso heiß wie in Deutschland, nur spürt er dank der voll aufgedrehten Klimaanlage nichts davon. Und täte er es doch, dann wäre es ihm egal.
Rebecca ist tot. Er weiß es erst seit ein paar Minuten, und in ihm ist alles taub. Ich muss es Moshe sagen, betet er sich immer wieder vor, um dann doch sitzen zu bleiben und weiter vor sich hin zu starren.
Rebecca hat aufgehört zu leben, ihr kleiner Augapfel, ihre Nachzüglerin, ihr Nesthäkchen, denn sie kam erst zur Welt, als ihr Bruder Moshe schon zehn Jahre alt war und sie sich längst damit abgefunden hatten, dass er ein Einzelkind bleiben würde. Und jetzt ist sie tot, ermordet von unbekannten Tätern, die nicht wissen, was sie ihnen antun. Einfach so, aus heiterem Himmel.
Ich muss Moshe erreichen, sagte er sich wieder vor, bleibt aber wie angewurzelt dort sitzen, wo er gerade sitzt, zwei Schritte entfernt von dem Telefon auf seinem Nachttisch und dem Handy in seiner Jacke, die über der Rückenlehne des Stuhls vor dem kleinen Schreibtisch hängt.
Es ist Nachmittag, und sein Sohn kriecht wahrscheinlich gerade irgendwo auf den Golanhöhen im Staub herum und übt sich in „Häuserkampf“. So sieht es sein Lehrplan in dieser Woche vor, wenn Aaron sich richtig entsinnt. Sie telefonieren regelmäßig an den Wochenenden, und so sind seine Eltern zumeist darüber im Bilde, welche Fortschritte er in seiner Ausbildung macht.
Wenn es nach Aaron geht, soll es auch bei diesen Übungen bleiben; er hofft, dass sein Sohn irgendwann zur Vernunft kommt. Er ist smart, clever und er hat ein Einser-Abitur in der Tasche, weshalb ihm so viele friedfertigere Wege offenstehen als der, den er beschritten hat.
Eine Zeitlang hat bei Silberschmieds in Frankfurt der Haussegen ernsthaft schiefgehangen, nachdem Moshe sich dafür entschieden hatte, nach seiner zweieinhalbjährigen Militärzeit nicht zurück nach Deutschland zu kommen, um dort zu studieren. Nein, er will etwas für sein Land tun, sagte er damals im Brustton der Überzeugung, und dafür scheint ihm ausgerechnet die Arbeit beim israelischen Mossad am geeignetsten.
Rebecca, meine Kleine! Ist er bisher noch wie betäubt gewesen, so schüttelt ihn jetzt der Schmerz durch, ein trockenes Schluchzen bahnt sich seinen Weg nach draußen und sein Oberkörper schwingt unwillkürlich vor und zurück, so als habe er sein Baby im Arm und wolle es beruhigen.
Da Moshe aus Sicherheitsgründen kein Handy benutzen darf, ist Aaron auf seine Dienststelle angewiesen. Die gibt seinen Anruf weiter und sein Sohn kann ihn dann von einem Gemeinschaftstelefon aus zurückrufen.
*
Moshe weiß, dass sein Vater in Tel Aviv ist, und er hat schon auf dessen Anruf gewartet. Er will versuchen, bei seinen Ausbildern einen freien Tag herauszuholen, damit er sich mit ihm treffen kann. Das Hotel, in dem sein Vater abgestiegen ist, liegt direkt am Mittelmeerstrand von Tel Aviv, und es ist mehr als nur verlockend, nach der Schinderei der letzten Wochen einfach einmal einen Badetag einzulegen.
Aber wie er seinen Vorgesetzten kennt, ist das kaum zu erwarten. „Silberschmied, wie viele Urlaubstage stehen Ihnen jährlich zu?“ Das wird wahrscheinlich der einzige Kommentar zu seinem Anliegen sein, schließlich sind sie hier nicht im Kindergarten. Der Feind legt sich auch nicht an den Strand.
Als er unter der Dusche den Staub eines langen Tages losgeworden ist, hat er Hunger. Er kann zwischen der kleinen Kantine im Haus und dem Kühlschrank seines Zimmers wählen und entscheidet sich für Selbstverpflegung. Er hat Schwarzbrot und Dosenfleisch gebunkert, das soll für heute reichen.
Ein Junge aus seiner Brigade steckt den Kopf durch die Tür. „Du sollst beim Kommandanten antreten, und zwar sofort.“
Moshe lässt alles stehen und liegen und geht mit einem mulmigen Gefühl die paar Meter zum Büro seines Vorgesetzten. Hat er etwas angestellt? Eigentlich ist er mit sich im Reinen, und er gehört - abgesehen davon - zu den Jahrgangsbesten. Was soll’s, denkt er und klopft an die Tür.
„Setzen Sie sich“, sagt sein Boss und beendet kurz darauf das Telefonat, das er gerade noch geführt hat.
Jizchak Sharon schaut Moshe prüfend an, Moshe schaut bange zurück und fragt sich, was als nächstes kommen mag. Für eine Beförderung ist er noch nicht lange genug dabei, und degradieren können sie ihn auch nicht, weil er noch ganz unten auf der Karriereleiter steht.
„Bei Ihnen zuhause in Deutschland ist etwas geschehen, ein Unglück, wenn ich es recht verstanden habe. Sie sollen bitte Ihren Vater anrufen, er wartet auf Ihren Rückruf. Es ist dringend, also verlieren Sie besser keine Zeit.
Er hat gesagt, dass Sie wissen, wo er sich gerade aufhält, abgesehen davon können Sie ihn ja auf seinem Handy erreichen. Ich bin hier noch für zwei oder drei Stunden beschäftigt. Bitte kommen Sie nach dem Gespräch noch einmal her, wenn Ihnen danach ist.“
Mit diesen Worten entlässt ihn der Kommandant, und Moshe hat nun endgültig weiche Knie.
*
Obwohl Rebecca schon seit zwei Tagen vermisst wird, besteigt Aaron Silberschmied morgens eine Maschine der EL AL, die ihn von Frankfurt nach Tel Aviv bringt.
Er hat kaum eine Wahl, denn er hat in den letzten sechs Monaten einen Deal im exorbitanten Umfang von über zweiundsechzig Millionen Dollar auf den Weg gebracht, der jetzt unter großem Zeitdruck realisiert werden muss.
Er hätte seinen Partner nach Israel schicken können, aber der liegt mit einem Blinddarmdurchbruch im Krankenhaus und wird noch wochenlang ausfallen. Und einen anderen Mitarbeiter, der sich so kurzfristig in das komplizierte Vertragswerk einarbeiten könnte, haben sie nicht in ihrer Agentur.
Sicher hätte man sich die Unterlagen auch gegenseitig zufaxen können, aber das ist nur eine Seite der Medaille.
Er muss nach der Unterzeichnung des Kontraktes in einem zweitägigen Verhandlungsmarathon sämtliche Einzelheiten mit vier verschiedenen Veranstaltern klären, und wenn man die Rolling Stones, Lady Gaga, Elton John und noch sieben oder acht weitere Premium Acts auf die Bühne bringen will, dann gibt es ungefähr drei Milliarden Dinge zu organisieren, bevor der erste Akkord erklingt.
Er hat sich eingeredet, dass Rebecca schon wieder auftauchen wird. „Die Pubertät, Schatz“, hat er zu seiner Frau gesagt. „Da spinnen sie einfach manchmal.“
Aber eigentlich hat er damit nur sich selbst soweit beschwichtigt, dass er diese Reise antreten konnte. Und jetzt ist Rebecca tot, und er sitzt hier, während seine Frau in Frankfurt diesen furchtbaren Alptraum allein durchleben muss.
Der Klingelton seines Handys ist zu hören, mechanisch steht er auf, geht zu seiner Jacke, zieht es aus der Tasche.
Es ist Moshe. Er sagt ihm, was passiert ist. Moshe soll seinen Kommandeur darum bitten, dass er zur Beerdigung seiner Schwester fliegen darf. Moshe sagt ja, das will er gleich tun. Sein Vater wird für morgen Vormittag einen weiteren Flug nach Frankfurt buchen.
Moshe legt auf. Jetzt endlich kann Aaron Silberschmied weinen.
*
Moshe hängt den Hörer zurück auf die Gabel und steht sekundenlang nur da. Er will schreien, aber sein Kehlkopf scheint geschwollen zu sein. Er bringt keinen Ton heraus.
Ohne recht zu wissen, was er tut, geht er zum zweiten Mal binnen einer Viertelstunde zum Büro seines Vorgesetzten und klopft an.
„Sie haben eine Woche Sonderurlaub“, sagt dieser mit belegter Stimme. „Vielleicht ist es am besten, wenn einer unserer Fahrer Sie noch heute Abend zu ihrem Vater bringt. Der wird wissen, was als nächstes zu tun ist.“
Moshe hört sich selbst sagen, dass sein Vater versucht, für morgen einen Flug für sie beide zu organisieren. „Gut so“, sagt sein Boss. „Unser Glaube gebietet es, dass ein Verstorbener so schnell wie möglich beigesetzt werden soll, aber das wissen Sie ja. Fliegen Sie nach Frankfurt. Wenn Sie mehr als eine Woche brauchen sollten, lassen Sie es mich wissen.“
Er geht zu seinem Schreibtisch und greift nach dem Telefonhörer. Kurz darauf hat er jemanden gefunden, der Moshe nach Tel Aviv bringen wird.
Der Fahrer, ein Vertrauter des Kommandanten, wird am nächsten Tag berichten, dass Moshe Silberschmied auf der zweistündigen Fahrt von Haspin zur Mittelmeerküste kein einziges Wort gesprochen hat.
*
Als Moshe aus dem Dienstwagen steigt und die Lobby des „Isrotel“ betritt, wartet dort schon sein Vater auf ihn. Stumm umarmen sie sich, und Aaron zieht seinen Sohn zu einer Sitzecke, denn er hat plötzlich einen klaustrophobischen Anfall und will nicht in seinem kleinen Zimmer eingesperrt sein.
Abgehackt erzählt er das Wenige, das er aus Deutschland erfahren hat. Er hat sich so weit zusammengerissen, dass er den zusätzlichen Flug nach Frankfurt gebucht hat; sie fliegen zwar zusammen, sitzen aber ein paar Reihen voneinander entfernt. Vielleicht lässt sich morgen früh am Flughafen noch etwas daran korrigieren.
7
Schuchardt hat mit seinem Vorgesetzten telefoniert, während er vor dem Haus der Silberschmieds auf den Psychologen gewartet hat. Das Gespräch ist wie üblich in solchen Fällen verlaufen.
Immerhin hat er sich mit seinem Boss darauf einigen können, dass sie die verräterische Doppel-Acht der Öffentlichkeit aus polizeitaktischen Gründen vorläufig verschweigen wollen. Ermittlungstaktik vorzuschieben hat den Vorteil, dass ihnen niemand etwas Gegenteiliges nachweisen kann, und so gewinnt man Zeit, bevor irgendein Sturm losbrechen kann, der einen dann vor sich hertreibt.
„Aber eines noch, Schuchardt. Sie brauchen Unterstützung. Ich kann es nicht ewig decken, dass Sie als Einzelkämpfer in der Landschaft herumlaufen. Das fällt uns irgendwann auf die Füße. Ich kenne Ihre Argumente. Sie haben das Talent, Menschen zum Sprechen zu bringen und da stört ein junger Kollege bisweilen bei der Arbeit. Ist mir alles soweit geläufig. Trotzdem geht es nicht so weiter.“
"Ich hab's nacheinander mit Steinhaus versucht, mit Moskopf und mit Braun, Chef...“
„…wir haben uns verstanden, mein Guter.“ Schuchardt hasst es wie die Pest, mit „mein Guter“ angesprochen zu werden.
Der Rest des Gespräches: „Behandeln Sie die ganze Sache nach eigenem Ermessen, Schuchardt. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, Mann. Bei Ihrer Erfahrung…“
Und so weiter. Übersetzt heißt das: Du hast freie Hand; aber wenn du es vermasselst, kostet es deinen Kopf.
Schuchardt hat in achtundzwanzig Dienstjahren bereits vier Polizeipräsidenten kommen und gehen gesehen, und in dieser Beziehung sind alle gleich. Wenn es Erfolge zu feiern gibt, grinsen sie in jede Kamera und sabbern in jedes Mikrofon, das man ihnen hinhält. Wenn nicht, dann ist in aller Regel nur noch eine Staubwolke von ihnen zu sehen. So leicht ist das Leben da oben an der Spitze der Nahrungskette, denkt er, würde aber um nichts in der Welt mit dem obersten Polizisten der Stadt tauschen wollen. Da oben musst du dich so sehr nach allen Richtungen hin verbiegen, dass du am Ende nicht mehr weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist.
Endlich taucht der Psychologe auf, er ist mit der U-Bahn gekommen, weil es hier im Westend bekanntermaßen nicht einmal für den lieben Gott einen Parkplatz gibt. Schuchardt ist das egal, er parkt in zweiter Reihe. Er hat das mobile Blaulicht auf sein Autodach geschraubt und den Warnblinker eingeschaltet und steht so, dass der Verkehr gerade noch passieren kann. Das muss reichen.
Als sie bei den Silberschmieds läuten, dauert es eine Weile, bis die Mutter der Ermordeten an der Tür erscheint. Sie sieht die beiden Beamten hoffnungsvoll an, erkennt aber binnen eines Lidschlags, dass die Männer keine guten Nachrichten für sie haben. Ihr Blick wird leer und ihre Gesichtszüge fallen buchstäblich in sich zusammen.
Wenig später sitzen sie im Wohnzimmer der Familie. Rachel Silberschmied hat sich bemerkenswert schnell wieder gefasst, es stellt sich schnell heraus, dass sie vom ersten Moment an wenig Hoffnung gehabt hat, ihre Tochter unversehrt wiederzusehen. Und natürlich hatte sie einen guten Grund dafür – kein Lebenszeichen, keine Lösegeldforderung, da weiß man instinktiv, dass die Dinge nicht gut stehen. Sie hat aus den Umständen dasselbe geschlossen wie der in diesen Dingen erfahrene Kommissar.
Wann denn der Leichnam für die Beerdigung freigegeben wird, will sie wissen. Er sagt ihr, dass es von Seiten der Polizei keinen Grund gibt, den Leichnam nicht noch heute für den Bestatter freizugeben; der Pathologe ist mit seiner Arbeit fertig. „Wir warten nur noch auf den toxikologischen Bericht, aber der ist in diesem Fall kaum von Bedeutung. Und – es tut uns leid – Sie müssen den Leichnam Ihrer Tochter noch identifizieren.“
Sie will keine Einzelheiten über den Mord wissen, und das erleichtert dem Kommissar und dem Psychologen ihre Arbeit ganz erheblich.
Der Vater von Rebecca ist auf Geschäftsreise in Israel, eine Nachricht, die bei Schuchardt für kurzzeitiges Stirnrunzeln sorgt. Aber Frau Silberschmied erklärt ihnen den Hintergrund der Reise und sie können nun besser verstehen, warum der Mann in dieser schweren Stunde nicht für seine Frau da ist.
Jeder Jeck ist anders, denkt er. Aber ist nicht hier, um zu richten, und der Vater ist definitiv kein Verdächtiger. Abgesehen davon wird er morgen zurückerwartet, und er wird Rebeccas älteren Bruder mitbringen, der sich in Ausbildung beim israelischen Mossad befindet.
Was im Kopf Aaron Silberschmieds vorgeht, weiß der Kommissar nicht. Dieser hat sich zu Anfang hartnäckig geweigert, sein Telefon mit einer Fangschaltung versehen zu lassen. Das könne etwaige Entführer verärgern und sei deshalb zu riskant, soll er gesagt haben. Abgesehen davon werde seine Tochter sicher demnächst wieder auftauchen. Das ist sie nun tatsächlich, denkt Schuchardt, und ihm dreht sich beinahe der Magen um, wenn er sich an seinen vorherigen seinen Besuch in der Pathologie erinnert.
Rebeccas Mutter kann nur wenig Hilfreiches zur Sache beisteuern, alles, was sie weiß, hat sie den Kollegen erzählt, die zuletzt vorgestern wegen der Entführung mit ihr gesprochen haben. Schuchardt selbst hat sich natürlich schon heute Morgen die vorhandenen Protokolle auf seinen Laptop schicken lassen und weiß deshalb genug, um die arme Frau nicht weiter mit Fragen belästigen zu müssen.
„Ich fühle mich, als hätte man mir ein Körperteil entfernt, aber ich kann keinen Schmerz fühlen, weil man mich mit Betäubungsmitteln vollgepumpt.“
Sie sagt aber auch, dass sie ohne Hilfe zurechtkomme, außerdem sei eine Freundin aus Offenbach zu ihr unterwegs und müsse demnächst eintreffen. Also ziehen sich die nach ein paar weiteren Beileidsbekundungen zurück.
Sie verabschieden sich vor der Haustür voneinander. „Keine Mutter sollte ihr Kind beerdigen müssen, und kein Tier sollte so sterben wie dieses Kind“, sagt der Psychologe. Schuchardt nickt und weiß, dass es das nun einmal gibt.
Kaum sitzt er wieder in seinem Wagen, kommt ein Anruf herein. Es ist nochmal der Pathologe. „Schuchardt, sorry, das habe ich heute Vormittag vergessen: Das Erbrochene, das die Jungs von der Spurensicherung am Tatort eingesammelt haben, stammt mit Sicherheit nicht vom Opfer. Das hat zuletzt Pizza gegessen. Die bei mir eingegangenen Proben vom Tatort hat jemand anderes ausgekotzt. Ich dachte, das hilft Ihnen vielleicht weiter.“
Das tut es zunächst nicht. Pizza, das ist eine Information, die sich mit dem deckt, was die Freundin des Mädchens erzählt hat. Vielleicht hat ja einer der Täter einen schwachen Magen, oder - besser noch - vielleicht beruht dieser schwache Magen ja auf schwachen Nerven. Das kann dann von Nutzen sein, wenn man der Täter habhaft geworden ist und im Verhör nach einer Schwachstelle sucht. Es waren zwar mehrere Täter, aber eine Kette ist bekanntlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Schuchardt wird diese Information speichern, so wie er alles speichert, das ihm einmal bei seiner Arbeit helfen könnte.