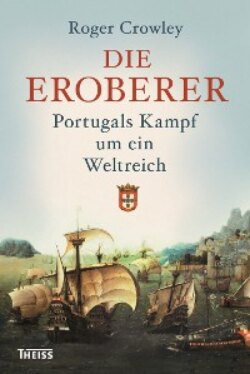Читать книгу Die Eroberer - Roger Crowley - Страница 18
|71|4 „Hol dich der Teufel!“ März – Mai 1498
ОглавлениеTausende von Meilen entfernt in den Mauern des Königspalastes der Georgsburg in Lissabon präsentierte die große, kreisförmige Karte von Fra Mauro ihr eigenes Weltbild. Afrika war extrem verzerrt dargestellt, Indien weniger ein klar definierter Subkontinent, der zerklüftete Rand eines riesigen und runden Asiens. Ein großer Teil der Kommentare und die Ortsnamen gingen auf die Reisen Niccolò de Contis zurück, des venezianischen Reisenden des 15. Jahrhunderts. Aber die Karte zeigte eindeutig einen Indischen Ozean, den man überqueren musste, und sie markierte die Küstenstadt Calicut, die Conti als den Umschlagplatz des indischen Handels bezeichnet hatte, mit der vielversprechenden Legende: „Hier wächst der Pfeffer.“ Der Spion Pêro da Covilhã behauptete ebenfalls, er habe in einem Brief, den er in Kairo übergeben hatte, ehe er im Hochland von Äthiopien untertauchte, Einzelheiten seiner Mission in Indien nach Portugal geschickt. Damit hätten die Portugiesen eigentlich viele Informationen über die Welt, in die sie gesegelt waren, haben müssen, aber bis heute ist unklar, ob Covilhãs Brief tatsächlich in Lissabon angekommen war oder jemals über König Johann II. hinaus weitergeleitet worden war. Und welche geheimen Instruktionen, Karten, Bestimmungsorte oder geographischen Kenntnisse Gama mitgebracht haben mochte, dürfte der anonyme Schreiber auf seiner Reise kaum gewusst haben. Offenbar war Gama mit einem Brief ausgestattet worden, der nur vage an den „christlichen König Indiens“ in Calicut adressiert war; dass er auf Arabisch geschrieben war, lässt darauf schließen, dass die Portugiesen zumindest von einer beträchtlichen muslimischen Präsenz im Indischen Ozean wussten. Abgesehen davon geht aus allen folgenden Geschehnissen hervor, |72|dass ihre Kenntnisse über diese Welt – die Klimaverhältnisse, ihre uralten Handelsnetze, die eng verschlungenen kulturellen Beziehungen zwischen dem Islam und dem Hinduismus, ihre Gepflogenheiten beim Abschluss von Geschäften und in der Politik – jämmerlich beschränkt waren. Eine Vielzahl von Fehlern und Missverständnissen sollte auftreten, die langfristige Konsequenzen hatten.
Der Indische Ozean, der 30-mal so groß wie das Mittelmeer ist, hat die Form eines riesigen M, wobei Indien das V in der Mitte bildet. Am Westrand ist er flankiert von den trockenen Küsten der arabischen Halbinsel und der langen Swahili-Küste Ostafrikas; im Osten trennen die Inseln Java und Sumatra sowie das stumpfe Ende Westaustraliens ihn vom Pazifik; im Süden verlaufen die kalten und wilden Gewässer der Antarktis. Die Zeitpläne und die Handelsrouten von allem, was sich im Zeitalter der Segelschiffe auf seiner Oberfläche bewegte, wurden von dem steten Rhythmus der Monsunwinde diktiert, einem der großen meteorologischen Schauspiele des Planeten, durch dessen jahreszeitlich bedingte Bewegungen und Gegenbewegungen Waren über große Entfernungen transportiert werden konnten. Das traditionelle Schiff, das die Gewässer des westlichen Indischen Ozeans befuhr, war die Dhau. Es ist der Gattungsname für eine große Familie langer, schmaler Gefährte mit dreieckigen Lateinsegeln unterschiedlicher Größe und regionalen Bauarten. Die Palette reichte vom Küstenschiff zwischen 5 und 15 Tonnen bis hin zu seetüchtigen Schiffen von mehreren hundert Tonnen, die Gamas Karacken an Größe durchaus übertreffen konnten. Historisch gesehen handelte es sich um gebundene Fahrzeuge, die ohne einen einzigen Nagel von Kokosbast, also Kokosfasern, zusammengehalten wurden.
Anders als Kolumbus waren die Portugiesen nicht in ruhige Meere vorgestoßen. Seit Tausenden von Jahren war der Indische Ozean ein Knoten des Welthandels gewesen, auf dem Waren über riesige Entfernungen von Kanton nach Kairo, von Birma nach Bagdad befördert wurden, und zwar mit Hilfe eines komplexen Geflechts von Handelssystemen, seefahrerischen Innovationen, Kulturen und Religionen und mehrerer Drehscheiben: Malakka auf der malaiischen Halbinsel, größer als Venedig, für Waren aus China und den Gewürzinseln; Calicut an der Westküste Indiens für Pfeffer; Hormus, das Tor zum |73|Persischen Golf und nach Bagdad; Aden an der Mündung zum Roten Meer und den Routen nach Kairo, der Schaltzentrale der islamischen Welt. Unzählige kleinere Städte säumten die ganze Küste. Über den Indischen Ozean wurden schwarze Sklaven, Gold und Mangrovenstämme aus Afrika verschickt, Weihrauch und Datteln aus Arabien, Goldbarren aus Europa, Pferde aus Persien, Opium aus Ägypten, Porzellan aus China, Kriegselefanten aus Ceylon, Reis aus Bengalen, Schwefel aus Sumatra, Muskatnuss von den Molukken, Diamanten vom Hochland von Dekkan, Baumwollstoffe aus Gujarat. Niemand hatte ein Monopol in diesem Gebiet – es war zu weitläufig und vielschichtig, und die großen Kontinentalmächte Asiens überließen das Meer den Kaufleuten. Es gab Piraterie in kleinem Stil, aber keine protektionistischen Kriegsflotten, keine Vorstellung von Territorialgewässern. Die Drachenflotte der Ming-Dynastie, die einstige Seesupermacht, war bis hierher vorgestoßen und hatte sich wieder zurückgezogen. Der Ozean bildete eine riesige und vergleichsweise friedliche Freihandelszone: Über die Hälfte der Schätze der Welt passierte seine Gewässer in einer wirtschaftlichen Gemeinschaft, die unter vielen Akteuren aufgeteilt war. Eine Redensart lautete: „Gott hat das Meer allen gemeinsam gegeben.“1
Das war die Welt Sindbads. Ihre wichtigsten Händlergruppen, die von den Palmenstränden Ostafrikas bis zu den Gewürzinseln dünn über die Küsten verstreut waren, waren überwiegend Muslime. Der Islam hatte sich hier nicht mit dem Schwert, sondern über Missionare und Kaufleute vom Deck einer Dhau ausgebreitet. Es war eine multiethnische Welt, in der sich der Handel auf gesellschaftlichen und kulturellen Austausch, Migration über lange Entfernungen und ein gewisses Maß an gegenseitiger Toleranz zwischen dem Islam, dem Hinduismus, dem Buddhismus, einheimischen Christen und Juden stützte. Diese Welt war reicher, vielschichtiger und komplexer, als die Portugiesen anfangs begriffen. Ihre Mentalität wurde von dem Erwerb von Handelsmonopolen geprägt, wie es an der Westküste Afrikas geschehen war, und vom Heiligen Krieg in Marokko. Die Existenz des Hinduismus war offenbar ausgeklammert worden, und ihre Grundhaltung, sobald sich ihnen jemand entgegenstellte, war aggressiv: Stets war die brennende Kerze am Zündloch einer Bombarde bereit. Sie drangen mit ihren schnell feuernden Schiffskanonen |74|in diese Gewässer ein – ein Akteur, der sich nicht an die geltenden Regeln hielt. Verhängnisvollerweise verfügten die Schiffe, denen sie im Indischen Ozean begegneten, über keine vergleichbaren Abwehrmechanismen.
Als Gamas Schiffe sich Moçambique näherten, wurde sofort deutlich, dass diese Stadt anders als das Afrika war, das sie kannten. Die strohgedeckten Häuser waren gut gebaut; sie erblickten Minarette und hölzerne Moscheen. Die Menschen, offenbar muslimische Kaufleute, die mit Seide gesäumte und mit Gold verbrämte Kaftane trugen, waren Arabisch sprechende Stadtbewohner, mit denen ihre Dolmetscher kommunizieren konnten. Die Begrüßung war ungewöhnlich freundlich. „Sie kamen sofort mit so viel Vertrauen an Bord, als ob sie seit langem bekannt wären, und begannen eine vertraute Unterhaltung.“2 Zum ersten Mal hörten die Portugiesen Neuigkeiten über die Welt, die sie gesucht hatten. Über die Dolmetscher erfuhren sie von dem Handel der „weißen Mauren“ – Kaufleute von der arabischen Halbinsel. Es lagen vier Schiffe von ihnen im Hafen, die mit „Gold, Silber, Gewürznelken, Pfeffer und Ingwer, silbernen Ringen, einer Menge Perlen, Edelsteinen und Rubinen“ beladen waren. „Weiter fort von hier, dort wohin wir auf dem Wege seien“, fügte der anonyme Schreiber mit einer verständlichen Ungläubigkeit hinzu, „gäbe es diese Sachen im Überfluss. Perlen, Edelsteine und Gewürze seien dort in solchen Mengen, dass man sie nicht zu kaufen brauche, sondern in Körben sammeln könne“.3 Diese berauschende Vision des Reichtums war schon vielversprechend genug; aber sie hörten auch von einer starken Anwesenheit von Christen entlang der Küste und davon, dass „der Priester Johannes nicht weit von hier wohne. Viele Städte an der Küste entlang habe er gegründet, deren Bewohner tüchtige Kaufleute seien und große Schiffe besäßen“.4 Was immer bei der Übersetzung verloren gegangen sein mochte, diese Nachricht machte die Portugiesen so glücklich, dass sie „vor Freude jubelten und Gott baten, er möge uns Gesundheit schenken, damit wir unser so heiß ersehntes Ziel erreichen könnten“.5
Nach und nach merkten die Portugiesen, dass sie selbst ebenfalls für muslimische Kaufleute gehalten wurden. Anfangs kam der Sultan im Geist der Freundschaft an Bord, und ungeachtet des Bemühens Gamas, ihn zu beeindrucken – was mit Blick auf das ramponierte |75|Äußere der Schiffe und Männer gewiss nicht einfach war –, zeigte er sich enttäuscht über die Qualität der angebotenen Geschenke. Die Portugiesen, die von dem Reichtum dieser neuen Welt offenbar keine Ahnung gehabt hatten, waren mit wertlosem Schmuck aus Lissabon abgereist, die einen westafrikanischen Stammeshäuptling erfreuen mochten: Glöckchen und Becken aus Messing, Korallen, Hüte und schlichte Kleidungsstücke. Nachdem es diesen seltsamen und ausgemergelten Seeleuten nicht gelungen war, ihre Glaubwürdigkeit als Händler oder bedeutende Männer unter Beweis zu stellen, kamen Fragen nach ihrer Identität und ihren Absichten auf. Zuerst hielt der Sultan sie für Türken und wollte unbedingt ihre berühmten Bogen und ihre Korane sehen. Gama war gezwungen, sich zu verstellen: Sie kämen aus einem Land in der Nähe der Türkei und hätten ihre heiligen Bücher nicht dem offenen Meer anvertrauen wollen. Aber er schob einen beeindruckenden Schuss mit der Armbrust nach und eine Präsentation der Rüstung, „über all dies er [der Sultan] sehr zufrieden und hoch erstaunt war“.6
Sie hatten bereits erfahren, wie tückisch die Küste sein konnte – die Bérrio war vor dem Hafen auf Grund gelaufen –, und wussten, dass es auf dem vor ihnen liegenden Weg von Untiefen wimmelte. Gama bat den Sultan, ihnen einen Lotsen zur Verfügung zu stellen. Der bot ihnen zwei an, die in Gold bezahlt werden sollten. Gama, der von Natur aus gegenüber Muslimen misstrauisch war, bestand darauf, dass einer immer an Bord bleiben sollte. Als die Zweifel ihrer Gastgeber stärker wurden, verdüsterte sich rasch die Stimmung. Am Samstag, dem 10. März, als die Schiffe aus der Stadt zu einer drei Meilen entfernten Insel verlegt wurden, um dort heimlich eine Messe zu feiern, setzte sich einer der Lotsen ab. Gama schickte zwei Boote zu seiner Verfolgung aus, aber sie wurden von sechs bewaffneten Fahrzeugen empfangen, die von der Insel mit dem Befehl zu ihnen kamen, in die Stadt Moçambique zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt glaubten die Christen womöglich, dass ihre Tarnung aufgeflogen sei. Der Lotse, der ihnen geblieben war, wurde gefesselt, damit er nicht floh, und die Bombarden jagten die Muslime in die Flucht. Es war höchste Zeit, wieder die Segel zu setzen.
Allerdings machte ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Der Wind drehte. Sie wurden zu der Insel zurückgetrieben. |76|Der Sultan versuchte es mit Friedensangeboten, wurde aber abgewiesen. Zehn nervenaufreibende Tage folgten. Das Wasser auf der Insel war brackig, und den Schiffen ging das Trinkwasser aus. Notgedrungen mussten die Portugiesen am 22. März in den Hafen von Moçambique zurückkehren. Um Mitternacht versuchten sie eine heimliche Landung, um Frischwasser zu finden, und nahmen den verbliebenen Lotsen mit sich. Entweder konnte oder wollte er die Quelle nicht finden. Noch bei Tageslicht versuchten sie es am nächsten Abend noch einmal und fanden die Quelle, allerdings von 20 Mann bewacht. Die Bombarden brüllten und jagten die Männer in die Flucht. Der Kampf ums Wasser ging weiter. Am nächsten Tag fanden sie die Quelle wiederum bewacht vor, und die Männer waren diesmal von einer Palisade geschützt. Die Portugiesen beschossen den Ort drei Stunden lang, bis die Einheimischen flohen. Am 25. März ließ die anhaltende Drohung eines Geschützfeuers alle Bewohner in ihren Häusern bleiben. Nachdem die Portugiesen erneut Wasser aufgenommen hatten, segelten sie weiter. Allerdings ergriffen sie zuvor noch aus einem Boot ein paar Geiseln und gaben zum Abschied ein paar Schüsse auf die Stadt ab.
Ein Muster der Frustration und aggressiven Reaktion kristallisierte sich heraus. Die Kapitäne waren immer reizbarer und misstrauischer und sehnten sich nach verlässlichem Proviant und dem freundlichen Empfang eines christlichen Hafens. Weder das eine noch das andere stellte sich ein. Sie kamen nur langsam nach Norden voran. Von widrigen Winden wurden sie zurückgetrieben. Sie loteten die Wasserwege sehr umsichtig nach Untiefen und Sandbänken aus, weil sie ihrem erbeuteten Lotsen nicht trauten. Sie fuhren an dem Hafen Kilwa vorbei, von dem sie meinten, dort würden viele Christen wohnen, peitschten den Mann aus, weil er sie offenbar hinterging, liefen mit der Rafael versehentlich auf Grund und erreichten endlich die Hafenstadt Mombasa. Es war Palmsonntag. „Wir waren hier sehr gern vor Anker gegangen“, erzählte der Tagebuchschreiber, „weil wir hofften, am nächsten Tag an Land gehen zu können, um mit den Christen, die, wie wir hörten, von den Mauren getrennt in einem Stadtteil für sich lebten, eine Messe zu hören.“7 Die angenehme Vorstellung, hier unter Mitchristen zu sein, fand ein jähes Ende.
|77|Die Landung in Mombasa folgte dem gleichen Muster. Als Erstes wurden sie von dem Scheich begrüßt. Zwei Männer, vermutlich Verurteilte, die man für die Rolle auserwählt hatte, gingen an Land und wurden gut empfangen. Zum ersten Mal trafen sie „Christen“, die „ihnen ein Bild, das sie anbeteten, zeigten. Der Heilige Geist war darauf dargestellt“.8 Es sollte sich als einer der gravierendsten, fast schon komischen, frühen Irrtümer der Portugiesen erweisen, dass sie Hindus, von deren Existenz sie offenbar überhaupt nichts wussten, mit den Bildern ihrer eigenen Gottheiten für Christen einer abweichenden Sekte hielten. Die Portugiesen waren mit der Erwartung in den Indischen Ozean gekommen, hier Christen in der Diaspora anzutreffen; diese Männer mit ihren fremdartigen, anthropomorphen Bildern passten hübsch zu ihrer fixen Vorstellung.
Der Scheich schickte ihnen zur Eröffnung des Handels einige Proben von Gewürzen, aber es kann durchaus sein, dass ihr Ruf ihnen bereits vorausgeeilt war. Von dieser Begrüßung in Sicherheit gewiegt, bereitete sich die kleine Flotte darauf vor, unter lokaler Führung in den Hafen einzulaufen, doch in dem Moment fing die Gabriel an abzutreiben und stieß gegen das nächste Schiff. In der Verwirrung gerieten die Lotsen an Bord in Panik. Da sie vermutlich vor neuen Strafen Angst hatten, sprangen sie ins Meer und wurden von einheimischen Booten aufgenommen. Jetzt waren die Portugiesen alarmiert. Am selben Abend folterten sie zwei ihrer Geiseln, indem sie kochendes Öl auf ihre Haut tropften, damit sie „gestanden“, dass der Befehl erteilt worden sei, die Schiffe aus Rache für das Bombardement von Moçambique zu erbeuten. „Als die Folter ein zweites Mal wiederholt werden sollte, warf sich der eine Maure, obwohl er an den Händen gefesselt war, ins Meer; der andere sprang während der Frühwache hinein.“9 Offenbar zogen sie die Gefahr des Ertrinkens der Folter vor.
Gegen Mitternacht entdeckten die Ausgucke auf den Schiffen etwas, das sie für einen Schwarm Thunfische hielten, der sich durch das vom Mond erhellte Meer bewegte. Die Fische entpuppten sich als Männer, die lautlos zu den Schiffen schwammen. Als sie die Bérrio erreicht hatten, fingen sie an, das Tau zu kappen; anderen gelang es, in die Takelage zu klettern, aber „als sie sich entdeckt sahen, ließen sie sich schweigend ins Meer gleiten und flohen“.10 Am |78|Morgen des 13. April setzte die Flottille erneut Segel nach Malindi, 70 Meilen die Küste aufwärts, um dort ihr Glück und einen zuverlässigen Lotsen zu suchen. Der anonyme Bericht erzählt, dass die Kranken Zeichen der Genesung gezeigt hätten, „denn das Klima ist in dieser Gegend sehr gut“.11 Der eigentliche Grund dafür war vermutlich das Vitamin C aus einem beträchtlichen Vorrat Orangen. Nichtsdestotrotz stand die Expedition auf der Kippe. Die Männer waren vom Ankerhieven so erschöpft, dass die Kräfte versagten. Notgedrungen mussten sie das Tau kappen und einen Anker am Meeresgrund zurücklassen. Während sie sich an der Küste entlangtasteten, stießen sie auf zwei Barken, „auf die wir sogleich Jagd machten. Wir wollten eine davon einfangen, um uns einen Piloten zu holen, der uns dahin führen sollte, wohin wir gern wollten“.12 Ein Boot entkam, aber das andere holten sie ein. Alle 17 Passagiere, auch ein ehrwürdiger alter Mann und seine Frau, warfen sich lieber über Bord, als in die Hände der Piraten zu geraten, aber sie wurden aus dem Wasser gefischt, sowie „Gold, Silber und eine Menge Hirse und andere Vorräte“ aus dem Boot.13 Mittlerweile war das Nehmen von Geiseln zur Standardstrategie in einer Welt geworden, die als feindselig wahrgenommen wurde.
Am Abend des 14. April hatten sie Malindi erreicht. Die hohen, weißgetünchten Häuser mit ihren vielen Fenstern vor fruchtbaren Feldern und einer üppigen Vegetation erinnerten den Tagebuchschreiber in einem Anflug von Heimweh an eine Stadt zuhause am Ufer des Tejo. Der nächste Tag war der Ostersonntag. Kein Mensch zeigte sich, um das seltsame Schiff aus der Nähe zu betrachten. Ihr Ruf war ihnen vorausgeeilt. Gama setzte den alten Mann auf einer Sandbank vor der Stadt als Vermittler aus und wartete, bis er gerettet wurde. Die anfängliche Reaktion des Scheichs glich der bei vorherigen Landungen. Der alte Mann kam mit der Nachricht zurück, dass der Herrscher „sehr erfreut sein würde, mit ihm Frieden zu schließen … Er würde gern [dem Oberbefehlshaber] alles zur Verfügung stellen, was sein Land hergeben könne, so Piloten und anderes mehr“.14 Gama verlegte die Schiffe näher an die Stadt, blieb jedoch auf Distanz und versuchte, die Zeichen zu deuten. Er lehnte alle Einladungen, an Land zu gehen, ab und erklärte, „ihm sei von seinem Herrn verboten worden, an Land zu gehen“.15 Die Verhandlungen |79|wurden von benachbarten Ruderbooten aus geführt, aber der Wortwechsel blieb freundlich. Der Scheich schickte Schafe und Gewürze. Er bat darum, den Namen ihres Königs aufzuschreiben, und äußerte den Wunsch, ihm einen Gesandten oder einen Brief zu schicken.
Als Vasco da Gama die Bedeutung dieser Worte erwog, änderte er seine Haltung und ließ zum Zeichen des guten Willens die Geiseln vom Boot frei. Unwillkürlich lernten die Portugiesen so ihre erste Lektion in der Diplomatie des Indischen Ozeans. Der Scheich suchte nach Bündnispartnern in einer Auseinandersetzung mit muslimischen Handelsrivalen entlang der Küste; die christlichen Eindringlinge sollten im Laufe der Zeit lernen, wie sie sich solche Bündnisse über die Trennlinien der Konfessionen hinweg zunutze machten, um den Widerstand zu spalten. Die beiden Parteien begannen höfliche und ehrerbietige Zeremonien, sicher durch einen Streifen Wasser getrennt. „Vergnügt fuhr der König dann um die Schiffe herum, auf denen zum Gruß Bombarden abgefeuert wurden.“16 Es kam zu einem Austausch von Besuchern – einmal mehr wurden die Verurteilten an Land geschickt –, und der Scheich, der auf einem Thron aus Bronze am Strand saß und dem Musiker ein Ständchen darbrachten, befahl seinen Reitern, auf dem Sand Schaukämpfe vorzuführen. Gama lehnte wiederholte Einladungen ab, an Land zu kommen und den alten Vater des Scheichs zu besuchen.
Unterdessen schöpften die Portugiesen neuen Mut, als sie hörten, dass vier Schiffe indischer Christen unlängst in Malindi eingetroffen seien, und zu gegebener Zeit kamen diese „Christen“ auch an Bord. Als man ihnen ein Bild von Christus am Kreuz und seiner Mutter zeigte, „warfen sie sich vor ihm nieder, und solange wir da waren, kamen sie, um vor ihm zu beten. Sie brachten ihm Geschenke dar, Gewürznelken, Pfeffer und anderes“.17 Ihre Schiffe verfügten offenbar über Kanonen und Schießpulver; sie erleuchteten den Nachthimmel mit einem spektakulären Feuerwerk aus Raketen und Bombarden zu Ehren ihrer Glaubensbrüder. Ihre „Christ! Christ!“-Rufe durchschnitten die Luft,18 und sie warnten Gama in einem Kauderwelsch aus gebrochenem Arabisch, niemals an Land zu gehen, geschweige denn, jemals Muslimen zu trauen. Sie waren anders als alle Christen, welche die Portugiesen bislang zu Gesicht bekommen hatten. „Diese Inder haben eine schwarzgelbe Hautfarbe“, notierte |80|der Schreiber in sein Tagebuch. „Sie sind sehr wenig bekleidet. Ihr Barthaar ist lang, und das lange Haupthaar flechten sie. Sie erzählten uns, dass sie kein Ochsenfleisch essen.“19 Mitten in dieser kulturellen Verwirrung ist es sehr wahrscheinlich, dass diese lang ersehnten Glaubensbrüder in Wirklichkeit „Krischna! Krischna!“ riefen.
Ihr Empfang in Malindi hatte fast schon die Stimmung eines Festes. „Wir blieben neun Tage vor der Stadt und die ganze Zeit wurden wir durch Feste, Scheinkämpfe und Trompetenkonzerte unterhalten.“20 Aber Gama wollte unbedingt endlich einen Lotsen haben. Eine weitere Geiselnahme war erforderlich, um einen zu bekommen. Der Scheich schickte ihnen einen „Christen“, der bereit war, ihre Expedition über den Ozean zu ihrem gewünschten Bestimmungsort zu führen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich um einen Muslim aus Gujarat, der im Besitz einer Karte der westindischen Küste und mit Quadranten vertraut war, um astronomische Beobachtungen durchzuführen. Noch 500 Jahre danach sollten arabische Kapitäne diesen muslimischen Lotsen verfluchen, der die Europäer, die sie Ferengi nannten, in die Geheimnisse der Navigation auf dem Indischen Ozean einweihte.
Am 24. April, als die Monsunwinde zu ihren Gunsten drehten, liefen sie aus, um „die Stadt Qualecut (Calicut) zu erreichen“.21 Dieser Satz lässt vermuten, dass zumindest der Tagebuchschreiber diesen Namen zum ersten Mal hörte – womöglich hatte die ganze Expedition, die blindlings in den Indischen Ozean eindrang, lediglich eine sehr vage Vorstellung von ihrem Bestimmungsort. Mit einem anhaltenden Rückenwind gelang die diagonale Überquerung dieses unbekannten Meeres erstaunlich rasch. Sie segelten nach Nordosten. Am 29. April wurden sie von der Rückkehr des Polarsterns am nächtlichen Himmel getröstet, den sie seit dem Betreten des Südatlantiks aus den Augen verloren hatten. Am Freitag, dem 18. Mai, nach nur 23 Tagen fern von jedem Land und 2300 Meilen offener See, erblickten sie hohe Berge. Am nächsten Tag prasselte ein heftiger Regen auf das Deck und nahm ihnen jede Sicht; Blitze zuckten über den Himmel. Sie waren auf das Vorspiel des Monsunregens gestoßen. Als der Sturm nachließ, war der Lotse imstande, die Küste zu identifizieren; da „erfuhren wir, dass wir uns auf der Höhe |82|von Calicut befänden, also glücklich an unserm nächsten Ziel angelangt waren“.22 Durch dichte Regenfälle erblickten sie Indien zum ersten Mal: hohe Berggipfel ragten drohend aus dem Dunkel auf. Das waren die Westghats, die lange Bergkette, die den Südwesten Indiens umfasste, die Küste von Malabar. Sie konnten dicht bewaldete Hänge, eine schmale Ebene und die Brandung am weißen Sand erkennen.
Gamas kleine Flottille. Das Versorgungsschiff wurde nach der Umrundung des Kaps verbrannt.
Es war mit Sicherheit ein sehr bewegender Anblick. Vor 309 Tagen hatten sie gesehen, wie ihre Geliebten bei Restelo ins Meer wateten. Sie waren 12.000 Meilen gesegelt und hatten viele Männer verloren. Eine viel längere Reise lag hinter ihnen, eine Reise, die bis zu den ersten Erkundungen Prinz Heinrichs Jahrzehnte zurückreichte, bis zu der mühseligen Schinderei entlang der afrikanischen Küste, den Erkundungen der Flüsse, den verlorenen Schiffen, den Generationen von Männern, die zur See gefahren und gestorben waren. Der erste diesige Anblick Indiens steht für einen bedeutsamen Augenblick in der Weltgeschichte. Gama hatte die Isolation Europas beendet. Der Atlantik war kein unüberwindliches Hindernis mehr; er war zu einer Verbindungsstraße zwischen den Hemisphären geworden. Es war ein Wendepunkt in dem langen Prozess der globalen Konvergenz, und doch findet sich in dem streng nüchternen anonymen Tagebuch kein Hinweis auf die Größe dieser Leistung, und selbst in kurz danach geschriebenen portugiesischen Darstellungen gibt es allenfalls versteckte Anspielungen. Vasco da Gama zahlte den Lotsen ordentlich aus, rief die Besatzung zum Gebet zusammen und dankte Gott, „der sie sicher zu dem lang ersehnten Bestimmungsort geleitet hatte“.23
Sie waren nicht jahreszeitgemäß mit dem ersten Blasen des Monsuns gekommen, sondern zu einer Zeit, als an dieser Küste keine Schiffe anliefen. Am Ufer herrschte sofort großes Interesse, sowohl wegen der Neuigkeit der Schiffe selbst, die so ganz anders aussahen als alles, was im Indischen Ozean segelte, als auch wegen des ungewöhnlichen Zeitpunkts. Vier Boote kamen heran, um die fremden Besucher zu betrachten, und zeigten nach Calicut in einiger Entfernung; am nächsten Tag waren die Boote wieder da. Gama schickte einen Verurteilten mit den Besuchern an Land, einen Mann namens João Nunes, ein konvertierter Jude, der dazu ausersehen war, die |83|wohl berühmteste Landung der portugiesischen Geschichte vorzunehmen.
Die Menge am Strand hielt ihn für einen Muslim und führte ihn zu zwei tunesischen Kaufleuten, die ein wenig Kastilisch und Genuesisch sprachen. Die Begegnung barg für beide Seiten Überraschungen. Nunes sah sich in einer Sprache seines eigenen Kontinents angesprochen: „Hol dich der Teufel! Wie kommst du hierher?“24
Das war fast schon enttäuschend, ein Augenblick, in dem die Welt offenbar geschrumpft war. Die Portugiesen hatten die Erde umsegelt, nur um in ihrer eigenen Sprache empfangen zu werden. Der Einflussbereich des islamischen Handels von der Straße von Gibraltar bis zum Chinesischen Meer reichte viel weiter, als die Portugiesen bislang erfasst hatten.
Sie seien gekommen, antwortete Nunes mit beachtlicher Geistesgegenwart, um „nach Christen und Gewürzen“ zu forschen.
Das war vermutlich eine einigermaßen zutreffende Beschreibung der Instruktionen König Manuels. Die Tunesier waren ebenso verblüfft. Sie konnten nicht begreifen, wie oder warum die lange Reise ausgerechnet von den Portugiesen gemacht worden war: „Warum schickt nicht der König von Kastilien, der König von Frankreich oder die Signoria von Venedig hierher?“25
Nunes erwiderte, indem er die Würde seiner auserwählten Heimat wahrte, dass der König von Portugal dies nicht gestatte. Die beiden Männer nahmen ihn mit in ihr Haus und gaben ihm Delikatessen zu essen: Weizenbrot und Honig. Anschließend begleiteten sie ihn begeistert zu den Schiffen. „Welches Glück! Welches Glück!“, rief einer von ihnen aus, kaum dass er an Bord geklettert war. „Eine Menge Rubinen, eine Menge Edelsteine! Dankt Gott, dass er euch in ein so reiches Land geführt hat!“26 „Wir waren äußerst erstaunt, als wir die Sprache hörten, denn wir hätten niemals erwartet“, schrieb der anonyme Chronist, „so weit von der Heimat Portugal entfernt unsere Muttersprache zu hören.“27
Die Begegnung mit den freundlichen Muslimen war vermutlich ebenso verwirrend wie alle folgenden Ereignisse. Es war, als würden sie durch das falsche Ende eines Teleskops einen Blick auf ihre eigene Welt werfen. Europa nämlich war unwissend und isoliert, |84|nicht das Meer, in das sie geraten waren. Außerdem hatten sie großes Glück. Einer der Tunesier, ein Mann namens Monçaide (möglicherweise Ibn Tayyib), wollte ihnen helfen, diese neue Welt zu begreifen. Er hatte eine Schwäche für die Portugiesen, deren Schiffe er während der Herrschaft Johanns II. an der nordafrikanischen Küste Handel treiben gesehen hatte. Er bot eine Einführung in die verworrenen Bräuche und Sitten Calicuts an, die sich als unbezahlbar erweisen sollte. Die Stadt werde, so erzählte er ihnen, von einem König, dem Samorin Raja, „dem Herrn des Meeres“ regiert, „der mit Freuden den General als Botschafter eines fremden Königs empfangen werde; insbesondere wenn es der Gegenstand seiner Reise sei, einen Handel mit Calicut in die Wege zu leiten, und wenn der General Handelsware mitgebracht habe, die sich für diesen Zweck eigne; denn die Vorteile, die der Samorin aus den Zöllen auf den Handel erziele, bildeten seine Haupteinnahmequelle“.28
Calicut hatte sich, obwohl es keinen günstigen natürlichen Hafen hatte, durch den Ruf seines Herrschers für seine geschickte Regierungstätigkeit und den fairen Umgang mit Händlern als Handelszentrum für Gewürze entlang der Küste von Malabar etabliert. „In Calicut behandelt man ein Schiff“, hatte ein Besucher im 15. Jahrhundert beobachtet, „ganz gleich, woher es kommt und wohin es fährt, wenn es dort anlegt, wie jedes andere Schiff und unterwirft es weder höheren noch geringeren Pflichten“.29 Die Stadt hatte eine beachtliche und tief verwurzelte muslimische Handelsgemeinde, die sogenannten Mappilas, welche die Nachkommen muslimischer Seeleute und Hindus aus einer niederen Kaste waren, sowie reisende Kaufleute von der arabischen Halbinsel, die „Mekka-Kaufleute“. Sie alle lebten harmonisch mit ihren Hindu-Herren einer hohen Kaste zum beiderseitigen Vorteil der religiösen Gruppen zusammen. Dieses wechselseitige Arrangement war bereits auf einer der großen chinesischen Expeditionen auf See bemerkt worden: „Früher“, schrieb der Chronist Ma Huan, „gab es einen König, der einen mit einem Schwur besiegelten Vertrag mit den Muslimen abschloss: Ihr esst keine Kühe; ich esse kein Schweinefleisch; wir werden gegenseitig das Tabu respektieren. [Dies] ist bis zum heutigen Tag geltendes Recht gewesen.“30 Die Portugiesen waren dazu ausersehen, diese harmonische Übereinkunft zu stören.
|85|Der Samorin lebte mit anderen hohen Hindus in einem außerhalb der Stadt liegenden Palast; er hatte in Calicut selbst eine weitere Residenz, die auf einem Aussichtspunkt lag, von dem aus er den Hafen und das Kommen und Gehen der Schiffe überblicken konnte – und entsprechend seine Abgaben einforderte. Hier empfing er für gewöhnlich ausländische Händler und Gesandte. Da er sich nicht in der Stadt aufhielt, schickte Gama zwei Verurteilte gemeinsam mit Monçaide als Gesandte aus, um sein Anliegen vorzubringen.
Die Antwort des Samorin kam prompt und war freundlich: Er überreichte den Gesandten Geschenke, erklärte sich bereit, die seltsamen Ankömmlinge zu treffen und sich mit seinem Gefolge in die Stadt zu begeben. Er stellte auch einen Lotsen zur Verfügung, um die Schiffe zu einem besseren Ankerplatz in einiger Entfernung zu führen, zu einem sicheren Hafen bei einer Siedlung, welche die Portugiesen Pandarane nannten. Gama willigte ein, seine Schiffe zu verlegen, aber nach seinen Erfahrungen an der afrikanischen Küste war er auf der Hut und wollte nicht in den Liegeplatz einlaufen, den der Lotse ihm zeigte. Misstrauen und die Tendenz, die Motive ihres Gegenübers falsch zu interpretieren, sollten die Taten der Portugiesen in dieser neuen Welt unablässig verfolgen.
An Bord entbrannte eine hitzige Debatte unter den Kapitänen, wie es weitergehen sollte. Von den islamischen Kaufleuten erwarteten sie bereits das Schlimmste. Das Urteil der Mehrheit lautete, dass es zu riskant für den Oberbefehlshaber sei, an Land zu gehen. Selbst wenn, wie sie annahmen, die Mehrheit der Bevölkerung Christen sei, werde die Feindseligkeit der muslimischen Händler in der Stadt jede Landung ihres Führers äußerst riskant machen. Gama hingegen bestand in einer Rede, die ihm vermutlich von den Chronisten später in den Mund gelegt wurde, darauf, dass es keine andere Möglichkeit gebe. Sie seien als Gesandte des Königs nach Indien gekommen, er müsse nunmehr auch unter Lebensgefahr persönlich die Verhandlung führen. Er werde ein paar Männer mitnehmen und nicht lange bleiben: „Ich habe nicht die Absicht, lange an Land zu bleiben, um den Muslimen eine Gelegenheit zu geben, eine Verschwörung gegen mich auszuhecken, weil ich vorschlage, nur mit dem König zu sprechen und in drei Tagen zurückzukehren.“31 Die übrigen Männer mussten unter dem Kommando seines Bruders auf |86|See bleiben; ein bewaffnetes Boot sollte jeden Tag in die Nähe des Ufers geschickt werden, um die Kommunikation nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten; falls ihm irgendetwas zustoßen sollte, so sollten sie abreisen.
Am Morgen des 28. Mai, ein Montag und eine Woche nach ihrer Ankunft, machte sich Gama mit 13 Männern auf den Weg. Zu der Gruppe gehörten Dolmetscher und der anonyme Schreiber, der somit einen authentischen Augenzeugenbericht liefern konnte. „Wir zogen die besten Kleider an“, dokumentiert er, „stellten Bombarden in den Booten auf und nahmen uns Trompeten und viele Flaggen mit“.32 Der äußeren Pracht sollte die Wehrhaftigkeit entsprechen. Die erschöpften Seeleute, die immer noch mit der Neigung der Schiffe schwankten, setzten, so gut sie konnten, unter dem Klang der Trompeten Fuß auf den „so lange verborgenen“ indischen Subkontinent – eine Szene, die von Malern des 19. Jahrhunderts so häufig romantisiert wurde.
Sie wurden von dem bale – dem Statthalter – des Samorin auf ganz andere Weise begrüßt. Für die angeschlagenen Seeleute war der Anblick des Empfangskomitees beängstigend: eine große Zahl Männer, teils mit dichten Bärten und langem Haar, die Ohren mit glitzerndem Gold durchbohrt. Diese Männer waren Nayare, Angehörige der Kriegerkaste der Hindu, die als Jugendliche geschworen hatten, ihren König bis zum Tod zu beschützen. Die Portugiesen hielten sie für Christen, und der Empfang schien freundlich. Ein Palankin, das Würdenträgern vorbehaltene Fortbewegungsmittel, das von einem Schirm beschattet wurde, wartete auf Gama. Er wurde in der Sänfte auf die Schultern von sechs Männern gehoben, die in Staffeln organisiert waren, und dann liefen sie los. Die übrigen Mitglieder der Gruppe mussten ihm folgen, so gut sie konnten. Calicut war eine Strecke entfernt, und sie lockten unterwegs immer mehr Neugierige an. Nach einiger Zeit wurden sie an einem Haus abgesetzt und bekamen Reis mit viel Butter und einem ausgezeichnet zubereiteten Fisch zu essen. Gama lehnte, da er auf der Hut oder bereits ungeduldig war, die Speisen ab; der bale und sein Gefolge zogen sich zum Essen in ein benachbartes Gebäude zurück. Möglicherweise war die Trennung wegen der Regeln des Kastenwesens notwendig.
|87|Dann wurden sie zu zwei zusammengebundenen Booten gebracht und paddelten unter Palmen den Fluss hinab, einen schwimmenden Zug anderer Boote im Schlepptau und Schaulustige an den Ufern. „Gar nicht zu zählen waren die Menschenmassen, die am Ufer entlang standen und die alle gekommen waren, um uns zu sehen“, beobachtete der Tagebuchschreiber. „Als wir uns wieder an Land begaben, stieg der Oberbefehlshaber in die Sänfte.“33 Sowie sie sich der Stadt näherten, wurde die Menschenmenge immer dichter; Frauen kamen aus den Häusern, trugen ihre Kinder und folgten ihnen auf der Straße. Ein Hauch Klaustrophobie und Verwirrung ist in der Erzählung zu spüren. Der Erzähler wusste gar nicht, wohin er schauen sollte, als er versuchte, alle die Eindrücke aufzunehmen: das ungewohnte Äußere der Menschen von einer „braunen“ Hautfarbe,34 die so gar nicht ihren Erfahrungen mit Afrikanern entsprach; die Männer, die entweder rasiert waren oder einen dichten Bart trugen; die Frauen, seiner Meinung nach „im allgemeinen hässlich und klein“,35 aber feierlich mit Goldketten und Armbändern geschmückt und mit Ringen an den Zehen, die mit Edelsteinen besetzt waren und offensichtlich den Reichtum Indiens bezeugten. Im Großen und Ganzen hielt er die Bevölkerung für „freundlich und offenbar gutmütig“,36 aber vor allem beeindruckte ihn die riesige Zahl.
Als sie die Stadt betraten, wurden sie „zu einer großen Kirche“ geführt, „von der Größe eines Klosters, aus gehauenem Stein aufgebaut und mit Ziegeln gedeckt“.37 In dieser Darstellung deutet nichts darauf hin, dass der Hindu-Tempel, in den sie geleitet wurden, keine Kirche einer abweichenden christlichen Sekte war. Davor standen zwei Säulen, einst vermutlich ein Lingam oder Symbol der Gottheit Shiva. Beim Betreten erblickten sie ein Heiligtum in der Mitte mit einer Tür aus Bronze: „In dem Heiligtum steht ein kleines Bild. Sie sagten, es stelle Unsere Liebe Frau dar.“38 Es lässt sich unmöglich sagen, was bei der Übersetzung verloren ging: vermutlich aus dem Arabischen der Portugiesen für einen Arabisch sprechenden Einheimischen, der wiederum in Malayalam übersetzte, die Sprache der Malabar-Küste. Gama kniete nieder und betete; die Priester versprengten „geweihtes Wasser“ und „gaben uns etwas weiße Erde, die die Christen hierzulande auf die Stirn, die Brust, den Nacken |88|und die Arme streichen“; Gama ließ seine Portion zur Aufbewahrung zur Seite legen.39 Der Tagebuchschreiber bemerkte, als sie gingen, die Heiligenbilder an den Wänden, die Kronen trugen und „sehr merkwürdig dargestellt [waren], die Zähne ragen einen Zoll breit aus dem Munde hervor oder sie hatten vier oder fünf Arme“.40
Als sie wieder auf die Straße traten, wuchs die Menge immer weiter an, bis es unmöglich wurde, sich zu bewegen, weil der Druck der Leute zu stark war. Sie mussten in ein Gebäude geführt werden, während einer Wache befohlen wurde, mit Trommeln, Trompeten, Sackpfeifen und dem Abfeuern von Musketen einen Weg durch das Gedränge zu bahnen. Die Menschen sammelten sich auf den Dächern, um sie vorübergehen zu sehen. Kurz vor Sonnenuntergang erreichten sie endlich den Palast. „Wir traten durch ein Gittertor … und mussten vier weitere Türen durchschreiten, bis wir zum König kamen. Wir mussten uns den Weg gewaltsam erkämpfen und teilten kräftige Rippenstöße aus.“41 Einige Männer wurden beim Betreten verwundet. Schließlich gelangten sie in das Audienzzimmer des Königs, „einen großen Saal, ringsum standen Holzstühle, in mehreren Reihen übereinander, wie unsere Theater, der Fußboden war von einem Teppich aus grünem Samt bedeckt, und die Wände mit verschiedenfarbiger Seide behängt“.42 Vor ihnen saß der Mann, den sie für den christlichen König hielten, für den sie eigens 12.000 Meilen gereist waren.