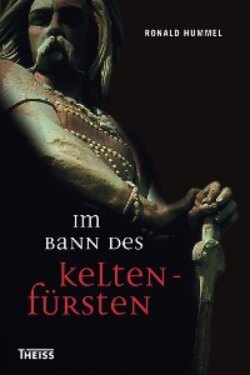Читать книгу Im Bann des Keltenfürsten - Ronald Hummel - Страница 6
2
ОглавлениеEIN UNGEWÖHNLICHER BOTE
Fürst Segomar musste nicht lange überlegen, wo er den Göttern lauschen wollte. Er ritt in das „Tal der Ahnen“, wie er es nannte. Es lag auf halber Strecke zwischen seinem Herrschaftssitz, dem Opios, und dem Sitz seiner Vorfahren, dem Muschelberg. Dieser schob sich als felsige Erhebung in die große Ebene5 hinein, gefolgt von der Hügellandschaft, in der auch das Tal der Ahnen lag. Dieses Stück Landschaft wirkte, als hätten es die Götter aus der flachen Ebene emporgehoben, um seine Bedeutung zu unterstreichen.
In den buckeligen, von Wiesenblumen übersäten Hügeln warf der Fürst die alltäglichen Sorgen ab und öffnete sich der ewigen Größe der Natur. Sollte er vielleicht zum Bach reiten?, überlegte er. Immerhin hatte Ritomar im Traum gesehen, dass ein Fisch ihm die Antwort brachte. Oder sollte er sich am Waldrand niederlassen, auf dass ihn einer der Waldgötter leichter entdeckte?
Schließlich setzte er sich mitten in eine Wiese im Talgrund und gab sich ganz diesem herrlichen Frühsommertag hin. Er aß einen der Äpfel aus der Packtasche, die ihm der Priester mitgegeben hatte – der
Apfel galt den Kelten als Frucht der Erkenntnis. Bald ließ er sich ins Gras sinken, und die Lider wurden ihm schwer.
Bevor er einschlief, bemerkte er, dass ein Schatten auf sein Gesicht fiel. Er blinzelte, sah nach oben und entdeckte einen Adler. Dieser segelte längs durch das Tal, kehrte dann um, sodass sein Schatten erneut den Fürsten streifte. Segomar schaute ihm nach. Der riesige Vogel zog seine Kreise über ihm, geduldig, immer und immer wieder. Sollte dies das Zeichen sein? Einerseits waren Adler über einem einsamen Tal nichts Ungewöhnliches. Andererseits galten sie als Himmelsboten der Götter. Sie konnten mit ihren scharfen Augen sogar in die Zukunft sehen, sagte man. Segomar hatte den Adler zu seinem Wahrzeichen gemacht, weil er ihm oben auf dem Opios näher war als sonst jemand.
Er beschloss abzuwarten, was passierte. Der Adler schien ein Stück herabzukommen, das Pferd wurde bereits unruhig. Schließlich glitt er majestätisch hinüber zum bewaldeten Hügelkamm und verschwand hinter den Bäumen. Also hatte er wohl doch keine Botschaft.
Da der Fürst nun seiner Entspannung beraubt war, wollte er sich auf den Rückweg machen. Er stieg auf sein Pferd und trieb es an. Plötzlich wieherte das Tier nervös – der Adler war wieder da. Er zog eine Kurve über dem Reiter und flog wieder über den Wald hinweg. Fast schien es dem Fürsten, als ob der riesige Vogel dabei den Kopf wandte, um zu sehen, wo er bliebe. Segomar ritt ihm nach, bis er bei undurchdringlichem Dornengestrüpp anlangte. Da war der Adler schon wieder über ihm und segelte ein Stück am Waldrand entlang.
Als Segomar an eine Stelle kam, wo das Gestrüpp lichter wurde, kreiste der Vogel über den Bäumen, die weiter innen im Wald lagen. Der Fürst ritt in den Wald hinein, den Blick immer durch die Baumwipfel nach oben gerichtet. Den Adler stets vor sich, kam Segomar schließlich auf der anderen Seite des Waldstreifens heraus. Von hier aus konnte er den Opios wieder sehen.
Abermals flog der Vogel am Waldrand entlang. Dann schien Segomar ihn verloren zu haben. Als das Pferd wieder nervös wieherte, wunderte er sich, denn er konnte den Adler nirgends am Himmel erkennen. Das Pferd begann sogar zu tänzeln, und da fand er die Erklärung: Der Raubvogel saß auf einer Eberesche am Waldrand und blickte herüber. Erwartete er den Reiter?
Segomar trieb das Pferd vorwärts. Hinter einer Waldbiegung kam Targurs Hof in sein Blickfeld. Der Adler schwang sich in die Lüfte und verschwand. Diesmal endgültig.
Bei der Eberesche entdeckte der Fürst Wagenspuren, die in den Wald führten. Er stieg ab, band das Reittier fest und folgte den Rillen im Waldboden ein Stück weit. Ein paar starke Äste waren abgehauen worden, um den Wagen Platz zu machen. Das konnte viel heißen, in der Regel waren es die Spuren von Holzfällern. Aber dass der Adler den Fürsten direkt hierher geführt hatte – Segomar beschloss, es dem Priester zu berichten. Sollte der herausfinden, was es bedeutete.
Itam wurde langsam missmutig, als er den Ochsen zum dritten Mal an diesem Tag vom Schutthaufen im Wald wegtrieb. Mit den verbrannten Holz- und Lehmresten hatte er die Hoffnung begraben, dass sich nach dieser Sklavenarbeit noch jemand für seine Sorgen interessierte. Er schuldete seinem Vater ein kleines Vermögen und seinen einzigen Besitz, den Wagen, würde er weggeben müssen.
Plötzlich erhob mitten auf dem Weg eine Gestalt gebieterisch die Hand. Itam erkannte sofort an dem markanten langen Kinnbart und dem völlig kahl geschorenen Kopf Ritomar, den Priester. Er konnte sich in jedes beliebige Tier verwandeln und durch seine Verwünschungen Menschen zu Stein erstarren lassen, erzählte man sich nachts an den Feuern. Und jetzt sah ihn dieser Mann mit einem Interesse an, das dem Köhlerjungen höchst unangenehm war.
Der Priester war schlicht gekleidet, mit brauner Hose und grauem langem Hemd. Der bis auf die Brust reichende, schmale Bart unterstrich die Wirkung des länglichen, hageren Gesichtes. Durch die kühn gebogene Nase und die hervorstehenden Wangenknochen hoben sich die Züge von denen gewöhnlicher Menschen ab – vergleichbar einer Felsformation, die nicht so recht in die Landschaft passt und in der man einen Zugang zur Anderwelt vermutet. Die blauen Augen wirkten tiefgründig wie Opferbrunnen.
„Wer bist du, und zu welchem Hof gehörst du?“, fragte der Priester unvermittelt.
„Ich bin Itam, Sohn von Barcha, dem Köhler. Wir gehören zum Hof von Birac, dem Zimmermann.“
„Und was tust du hier?“
„Ich fahre den Brandschutt in den Wald.“
Jetzt wusste Ritomar, dass der Fürst keiner Laune eines Vogels, sondern einem Wink der Götter gefolgt war.
„Ich muss mit dir sprechen, Itam. Lass mich auf deinen Wagen.“
Itam blieb der Mund offen stehen.
Ritomar dirigierte ihn zu einer Stelle, wo sie vor Blicken geschützt waren. „Ist dir irgendetwas an dem Schutt aufgefallen? Etwas, das womöglich nicht dort hingehört? Was mit dem Ausbruch des Feuers zu tun haben könnte? Amphoren, aus denen vielleicht Öl floss, um die Flammen zu nähren, ein Helm oder eine Waffe, wie man sie hier nicht trägt?“
Itam versuchte zu vergessen, wen er vor sich hatte und konzentrierte sich. „Ja, etwas ist mir aufgefallen.“ Er fühlte sich erleichtert, mit einer Beobachtung dienen zu können. „An einer Stelle, ganz hinten in der Schmiede, war der Boden unversehrt vom Feuer. Drumherum lag eine dicke Schicht von Eisen-Abbrand.“
Ritomar wurde hellhörig. „Der Abrieb von geschmiedetem Eisen, sagst du? Bist du sicher, dass es Eisen war?“
„Aber ja, es war ganz grau, wie ich es schon oft gesehen habe.“
„Und mittendrin ein unversehrter Fleck? Könnte dort ein Amboss gestanden haben?“
„Sehr wahrscheinlich. Man muss ihn nach dem Brand fortgeschafft haben.“
Ein zweiter Amboss ganz hinten in der Schmiede, wo sich die Hitze staut und die Arbeit erschwert, dachte Ritomar bei sich. Warum dieser ungünstige Standort? Der Amboss durfte wohl nicht gesehen werden. Hier wurde also offenbar heimlich Eisen geschmiedet. Er fragte weiter: „Wie dick war diese Schicht aus Abbrand?“
„Mehr als handbreit.“ Itam hielt seine Hand quer vor sich, um das Maß zu unterstreichen. Das deutete auf eine große Menge an Eisen hin. Mehrere Barren, möglicherweise ein Dutzend, mussten verarbeitet werden, damit solch eine Menge an Abbrand abfiel.
Der Priester wusste, dass Häuptling Targur zum letzten Vollmond Eisenwerkzeuge abgeliefert hatte, die er dem Fürsten regelmäßig als Tauschware anbieten musste. Und er wusste, dass Targur ständig gegen das Gebot verstieß, Eisen nur für den Fürsten, sich selbst und seine Sippe zu verarbeiten. Er handelte mehr oder weniger heimlich damit. Aber was der junge Mann da schilderte, lag jenseits aller erwarteten Ausmaße.
„Übertreibst du auch nicht?“, forschte Ritomar nach, da Kelten sehr zum Fabulieren neigten.
„Ich kann es beweisen“, erwiderte Itam. „Ich selbst habe dem Schmied, genauer gesagt seinem Gehilfen Atto, in den letzten zwanzig Tagen zehn Lieferungen Holzkohle gebracht. Die elfte wäre am Tag nach dem Brand fällig gewesen.“
„Jeden zweiten Tag diesen Wagen voll? Wozu brauchten sie so viel?“
„Das haben sie mir nicht gesagt.“
„Solche Unmengen Kohle zu brennen, dauert doch sehr lange. Wann haben sie dich damit beauftragt?“
„Atto schlug mir vor zwei Monden das Geschäft vor.“
Der Priester dachte einen Augenblick nach, dann fragte er: „Itam, musst du heute noch einige Fuhren erledigen?“
„Ich denke schon. Jedenfalls soll ich mich auf Targurs Hof melden“, wurde mir gesagt.
„Sobald sie dich entlassen, komm auf den Opios ins Herrenhaus. Sage den Wächtern dort, dass dich Ritomar, der Priester, herbefohlen hat. Ein paar Leute müssen vielleicht noch Genaueres wissen über das, was du gesehen hast.“
„Natürlich. Ich komme, sobald ich kann.“ Fast hätte Itam vor Aufregung gestottert. Dennoch siegte die Neugier: „Was für Leute werden das denn sein? Und was bedeutet das alles, mit den großen Mengen an Eisen?“
„Heute Nacht wird sich vieles klären“, versicherte Ritomar. „Aber überstürze nichts, Targurs Leuten darf nichts auffallen. Und verliere kein Wort zu ihnen. Am besten, du sprichst zu überhaupt niemandem.“ Damit war das Gespräch beendet, und sie trennten sich. „Was macht er denn da? Ich muss doch auf meiner Wachrunde dort vorbei“, fragte auf dem obersten Wall des Opios ein Wachtposten einen anderen.
„Störe ihn bloß nicht. Ich glaube, er versucht, aus dem Flug der Vögel zu lesen.“
„Was versucht er denn zu erkunden? Hat es etwas mit dem Brand zu tun?“
„Ich denke schon. Hast du es noch nicht gehört? Man munkelt, dass es ein Überfall war. Ritomar versucht wohl, die Spur der Räuber zu finden.“
„Da sollten sie lieber Fannac losschicken.“
„Der ist schon unterwegs.“
„Na, da bin ich gespannt, wer besser Spuren lesen kann, unser bester Jäger oder der Vogelbeobachter da.“
Während sich die Wachtposten trennten, stand der Priester weiterhin reglos in der Ecke des Wehrgangs, den Blick auf die beiden großen Grabhügel, Targurs Hof und das Wäldchen gerichtet. Ihr Götter habt euren geflügelten Boten zum Fürsten sprechen lassen – schickt doch auch welche zu mir, sandte er seine Gedanken zum wiederholten Mal in den Himmel. Ich bin euer Priester; zu mir müsst ihr mindestens so deutlich sprechen wie zu dem Fürsten. Ich bin euch doch viel mehr zugetan.
Eine Zeit lang kam keine Antwort von oben. Doch dann segelte eine Amsel heran – sie kam von rechts, der Seite des Guten. Auf Höhe von Ritomar drehte sie abrupt nach Osten ab, flog über die Ebene, fast genau über Häuptling Targurs Hof hinweg und verschmolz als kleiner Punkt mit den Bäumen des Waldes dahinter.
„Ich danke dir, Bote der Götter, Stimme aus dem Licht von Taranis“, murmelte Ritomar.
Fast im gleichen Augenblick bewegte sich etwas von links heran, der Seite von Unglück und Verderben. Es war auch noch ein Rabe, ein Wesen des Totenreichs. Der Priester beobachtete jeden Flügelschlag. Fast genau an der Stelle, wo die Amsel abgedreht war, wendete auch er scharf nach Osten und flog über Targurs Hof hinweg. Gerade stiegen Rauchschwaden eines Herdfeuers auf und schienen den Weg des schwarzen Vogels zu kreuzen.
Mehr zeigten ihm die Vögel nicht. Ritomar versuchte eine Deutung, als er die Treppe des Wehrganges hinabstieg: Die Götter hatten durch ihre Boten eindeutig nach Osten gezeigt – einmal mit freundlicher Miene, dann mit den Vorzeichen auf Tod, Feuer und Vernichtung. Die Richtung, aus der das Schicksal kommen sollte, stand fest. Aber nicht, was es mit sich bringen würde.
Ritomar hatte mehr erwartet. Doch vielleicht würde sich diese Botschaft ja zusammen mit Itams Erkenntnissen zu einem deutlichen Bild fügen.
Als Itam sich am Tor der großen Mauer meldete, die um den Fuß des Opios herum lief, schien der Wächter ihn schon erwartet zu haben. Er eilte zum Wachhaus und kam mit einem Mann zurück, der sofort als Anführer zu erkennen war: Den karierten Umhang hielten drei wertvolle Gewandfibeln aus Bronze, der Schwertgriff war mit roten Einlegearbeiten aus Korallen verziert. Er stellte sich als Hauptmann Garmo vor. Für den Soldatenführer des Fürsten erschien er Itam ziemlich jung; doch seine Züge waren bereits von jener Bestimmtheit geprägt, die bei anderen erst heranreifen musste. Er wirkte still und nüchtern, machte einen freundlichen, aber distanzierten Eindruck.
Der junge Hauptmann führte Itam in das Wachhaus; den Ochsenkarren musste er vor dem Tor stehen lassen. Im Haus lag schon ein Umhang bereit, den Itam sich überwerfen und über den Kopf ziehen musste. „Befehl des Priesters persönlich“, erklärte Garmo. „Auf dem Markt des Opios gibt es bekanntlich alles, auch neugierige Blicke.“
Itam fand, dass er an diesem lauen Frühsommerabend in solch einem Aufzug eher Neugier erwecken, als abwenden würde.
Eilig schritten sie den langen Weg hinauf entlang des Palisadenwalls, der sich vom Fuß des Berges direkt bis zum Gipfel zog. Er trennte die von Dornenranken überwucherte Wildnis an den Steilhängen vom flacheren, besiedelten Teil. Der bewohnte Bereich war durch drei Wälle unterteilt, die rechtwinklig vom langen Palisadenwall abgingen und sich jeweils entlang einer Höhenlinie an den Berg schmiegten. Die Mauern bestanden aus gewaltigen Balkengerüsten, aufgefüllt mit Quader- und Bruchsteinen. Die Vorderseiten der Wälle waren mit glatten Kalksteinen verkleidet und weiß getüncht, sodass ihre Wehrhaftigkeit und Pracht weit übers Land erstrahlten.
Die Fläche zwischen unterem und mittlerem Wall war nur mit Wirtschaftsgebäuden bebaut. Die Handwerkersiedlung und den großen Markt zwischen Mittelwall und oberer Wehranlage kannte Itam von früheren Besuchen mit seinem Vater. Hier herrschte das bunteste Leben im Land, Waren aus der ganzen Welt lagen aus: grellbunte Mosaike aus aufgerollten Säckchen mit fremdländischen Gewürzen, farbig bemalte teure Keramikware, mit schillernden Steinen besetzte und mit kunstvollen Mustern verzierte Schmuckstücke aus Bronze, Gold und Silber, Amphoren, Tiegel, Töpfe, Krüge, leuchtende Seidenstoffe. Viel Volk tummelte sich hier, um zu staunen und Dinge für den täglichen Bedarf wie Werkzeuge oder Felle sowie das eine oder andere erschwingliche Schmuckstück einzutauschen. Die wertvollen Waren blieben den Herren der größeren Höfe und ihren Familien sowie besser begüterten Handwerkern vorbehalten. Händler in ungewöhnlichen Gewändern hatten sich eingefunden, horteten in den ihnen zugewiesenen Hütten die eingetauschten Eisenbarren, Bronzewaren, Räucherschinken, Honigtöpfe, Salzsäcke, Felle und Bernsteine, die andere Händler oder Leute des Fürsten angeliefert hatten. Um diese Stunde saßen viele Händler schon vor den Gasthäusern, sahen zu, wie sich knusprig gebratene Schweine an den Bratspießen drehten, und tauschten bei Bier und Met Neuigkeiten aus.
Viel zu schnell für den Geschmack des neugierigen Itam eilten sie weiter zur Mauer der dritten und stärksten Bewehrung hinauf. Ein doppelter Wall schützte das Gipfelplateau mit dem Fürstensitz zur flachen Seite des Berges hin. Zu den Steilhängen lief der Doppelwall in einem einfachen Wehrgang aus, der den gesamten Gipfel umschloss. Der letzte Teil des Weges verlief in einer tiefen Gasse zwischen diesem Wall und der äußeren Palisade. Schließlich liefen Anfangs- und Endstück des Gipfelwalles parallel nebeneinander her, sodass sie eine Hohlgasse bildeten, die ihren Abschluss im obersten Tor fand. Feindliche Krieger wären in der Enge zwischen den Wällen dieses Zangentores erst einmal in einen Hagel aus Speeren, Pfeilen und Steinbrocken geraten. Itam hatte diesen Durchlass noch nie durchschritten. Er führte zum Gipfel, wo die Häuser der Krieger und Diener, Pferdeställe, Speicher und Gebäude für hochgestellte Gäste dicht an dicht standen. Sie eilten durch eine Gasse, die sich erst vor dem mächtigen Herrenhaus zu einem Platz weitete.
Itam musste vor der großen Tür stehen bleiben, durch die der Hauptmann eintrat. Sie war mit Eisen beschlagen und mit Schnitzereien verziert. Man wartete offenbar schon auf Itam, denn Garmo holte ihn sofort nach.
Die Halle wirkte überwältigend auf den Köhlersohn – mächtige Eichensäulen, überzogen mit Schnitzereien, geheimnisvolle, farbenprächtige Ornamente und Figuren auf einem breiten Stoffstreifen unterhalb der Decke. Das alles hätte er den ganzen Tag lang betrachten mögen. Doch er konnte die Pracht nur mit flüchtigen Blicken würdigen, während ihn der Hauptmann zu einer Tafel führte, an der eine Frau und vier Männer saßen und an der Garmo nun auch Platz nahm. Der Priester, dem er erst kurz zuvor begegnet war, trug jetzt keine gewöhnlichen Kleider mehr, sondern ein bodenlanges, schlichtes, hellgraues Gewand. Salmo, den Bronzeschmied, erkannte Itam an dem für Kelten ungewöhnlichen Vollbart. Damit wirkte er wie ein Grieche oder Etrusker – er wollte den Südländern offenbar nicht nur in ihrer Bronzekunst, sondern auch in der Mode nacheifern. Den dritten Mann, einen jungen Krieger, kannte er nicht.
Beim Anblick des vierten Mannes und der Frau erstarrte er vor Ehrfurcht – es waren der Fürst und die Fürstin.
Der Herr des Opios saß in der Mitte der Tafel. Er trug Kleider aus fein gewobenen Stoffen in den Farben, die am schwersten zu gewinnen waren, rot und blau. Die Metallbeschläge am Gürtel waren ebenso aus purem Gold wie die Armreife und der Torques, der massive, vorne offene Halsreif, der in zwei Kugeln endete und das Zeichen der Fürstenwürde darstellte. Vergeblich schielte Itam nach dem legendären goldenen Prunkdolch, denn den trug der Fürst nur an hohen Festen, bei wichtigen Opferungen oder dem Empfang vornehmer Personen.
Doch all das Beiwerk war gar nicht nötig, um Segomar als den Keltenfürsten auszuweisen. Auch brauchte er keinen herrischen Gesichtsausdruck oder machtvolle Gesten. Ihm wohnte eine Majestät inne, so natürlich wie die des Opios in seiner stillen, überwältigenden Erhabenheit, mit der er sich über das Land erhob.
Eine ähnliche Vornehmheit strahlte auch Fürstin Akiana aus – ihr unergründliches, selbstsicheres Lächeln bedurfte keiner weiteren Machtinsignien. Niemand hätte daran gezweifelt, seine Herrin vor sich zu haben. Sie war in Luxus gehüllt, der auf plumpen Prunk verzichtete: Das Kleid aus feinstem Leinen war mit der Schale einer fremdländischen Frucht leuchtend gelbgrün gefärbt und mit Borten verziert, wie sie nur eine besondere Künstlerin weben konnte. Ihr mit Essenzen aus fernen Ländern sorgfältig gepflegtes blondes Haar fiel seidig glänzend herab. Mit Schmuck musste sie nicht protzen, einige schmale Arm-, Hals- und Beinreife genügten ihr.
Der aufmerksame Blick des Fürsten ruhte auf dem immer nervöser werdenden Itam.
Ritomar, der Priester, schien das Wort zu führen: „Wir hoffen, in deinen Beobachtungen Einzelheiten zu finden, die das Geheimnis um den Brand vielleicht lösen“, begann er. „Salmo, der Schmied, hier ist fachkundig und weiß, wonach er fragen muss und Fannac“, damit deutete der Priester auf den für Itam bislang unbekannten Krieger, „kann noch aus der unscheinbarsten Spur Erstaunliches herauslesen.“
Itam wiederholte, was er dem Priester im Wald bereits erzählt hatte. Dann fragte Salmo, der Bronzeschmied: „Deutete irgendetwas darauf hin, wozu das viele Eisen verarbeitet wurde?“
„Vor einem gewöhnlichen Menschen wie mir bleiben die Geheimnisse der Eisenverarbeitung verborgen“, antwortete Itam. „Wie kann ich so etwas erkennen, zumal, wenn alles verbrannt ist?“
„Hast du keine Gegenstände aus Eisen gesehen?“
„Doch, die Krieger, die den Schutt aufluden, sonderten verkohlte Werkzeuge, Beschläge und anderes aus Eisen, das vielleicht noch von Wert ist, aus. Manches warfen sie auf einen Haufen, anderes wurde eilig weggebracht.“
„Konntest du einen Blick auf die Dinge werfen, die weggebracht wurden? Fiel dir etwas auf?“, fragte der Priester.
„Was mir auffiel, war eine sehr große Eisenstange, deren Zweck ich mir nicht erklären konnte.“ Itam formte mit Daumen und Zeigefinger einen Ring: „Etwa so dick.“ Anschließend breitete er die Arme aus und ließ sie dabei leicht angewinkelt: „Und so lang.“
„Stabeisen“, bemerkte Salmo verwundert.
Der Priester beugte sich zum Schmied hinüber: „Wo hat Häuptling Maban die her? Bei uns sind nur Spitzbarren üblich.“
„Es gibt zwei Möglichkeiten“, sagte Salmo. „Entweder hat er sie selbst schmieden lassen oder er hat sie auf einem fremden Markt eingetauscht.“
Fürst Segomar bemerkte, wie der Schmied immer nachdenklicher wurde. „Was meinst du, hat es mit diesen stabförmigen Barren auf sich?“, wollte er wissen.
„Erlaubt mir noch einige Fragen, dann kann ich es vielleicht erklären“, gab der Schmied zur Antwort.
Der Fürst ärgerte sich, dass ihm ein Bronzeschmied seine Vermutungen vorenthielt, doch er ließ ihn gewähren.
„War unter den Werkzeugen auch ein Schabeisen?“
Jetzt horchten alle außer der Fürstin auf. Itam spürte die Anspannung und war verwirrt – er kannte dieses Werkzeug nicht und wusste folglich auch nicht, dass man es zur Glättung frisch geschmiedeter Schwertklingen benutzte. Fragend sah er den Schmied an.
„Es ist eine breite Klinge mit zwei aufragenden Griffen links und rechts. Ganz ähnlich der Hobelklinge eines Schreiners.“
Für diese Erklärung fing sich der Schmied einen bösen Blick des Priesters ein. Ritomar gefiel es ganz und gar nicht, dass die Geheimnisse der Schwertschmiedekunst vor einem kleinen Köhler ausgebreitet wurden.
„Ja, ein Krieger zog so etwas aus dem Schutt und brachte es weg“, bestätigte Itam.
„Wie breit war die Klinge?“
„Nicht sehr breit. Etwa so.“ Itam hielt Daumen und Zeigefinger ein kleines Stück auseinander.
„Eisenschwerter!“ Dieses Wort erklang so mächtig aus dem Mund des Schmiedes, dass selbst der Fürst zusammenfuhr. „Das Schabeisen beweist es. Und es bestätigt meine Vermutung zu den langen Eisenbarren – sie lassen sich leichter zu Schwertern schmieden als unsere Spitzbarren, die in der Mitte viel zu klobig sind. Und es muss eine stattliche Anzahl gewesen sein. Die Klinge eines neuen Schabeisens ist etwa dreimal so breit. Bei solch einer starken Abnutzung wurden gut und gerne sieben Schwerter damit geglättet. Vielleicht auch zehn.“
„Zehn Eisenschwerter!“ Hauptmann Garmo wirkte mit einem Mal gar nicht mehr gelassen.
„Weiter, Salmo“, ließ der Fürst die Befragung fortsetzen. „Ich will alle Beweise.“
„Hast du auch Steine im Schutt gefunden?“, fragte Salmo.
„Was genau meinst du?“ Itam wusste nicht, worauf der Schmied hinauswollte. „Da waren verkohlte Lehmbrocken vom Mauerwerk und der steinerne Amboss, der vorne stand, wo schon immer sein Platz war.“
Der Kupferschmied winkte ab. „Nein, nein, ich meine Feldsteine. Länglich und so groß, dass man sie gerade noch in die Hand nehmen kann.“
Itam musste nachdenken. „Ja, da waren auch ein oder zwei solche Steine. Ich maß ihnen keine weitere Bedeutung bei.“
„Überlege genau“, mahnte Salmo. „Waren sie oben rau und uneben, wie man sie am Wegrand findet, unten aber glatt mit abgerundeten Kanten?“
Jetzt, da der Schmied das Bild so klar vorzeichnete, hatte Itam es wieder vor Augen: „Ja, da war zumindest ein Stein in dieser Form. Unten ganz glatt, als wäre er geschliffen worden.“
„Das wurde er auch“, sagte Salmo, zum Fürsten hingewandt. „Vielmehr war das der Schleifstein, um die Klingen zu schärfen. Ebenfalls stark abgenutzt von der Bearbeitung mehrerer Klingen. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, mein Fürst.“
„Beherrschte Targurs Schmied denn diese Kunst?“, wagte Fannac, das Schweigen, das eingesetzt hatte, zu brechen.
„Ja, er hat sie erlernt, als ich ihn beauftragte, Prunkwaffen aus purem Eisen anzufertigen, einen Dolch und ein Schwert“, gab der Fürst selbst die Antwort. „Er reiste dazu lange umher und lernte die Kunst des Eisenschmiedens im Osten der Alpen.“
Der Gesichtsausdruck von Salmo, dem Bronzeschmied des Fürsten, verfinsterte sich. Es war für ihn ein Schlag ins Gesicht gewesen, dass Fürst Segomar diesen Auftrag dem Schmied seines Widersachers gegeben hatte und nicht ihm, seinem stets treu ergebenen Gefolgsmann.
„Und jetzt ließ dein Feind Targur Eisenschwerter fertigen.“ Salmo hielt mit diesen Worten dem Fürsten vor, was dabei herauskam, wenn man Talent vor Gefolgstreue setzte. „Zehn an der Zahl, wenn es nach dem geht, was Itam gesehen hat. Das ist Hochverrat!“
„Immer mit der Ruhe!“, beschwichtigte ihn der Priester. „Wir wissen nicht, wozu sie bestimmt waren. Aber wir können davon ausgehen, dass sie geraubt wurden – warum sonst hätte jemand den Schmied und die Soldaten erschlagen sollen?“
Itam konnte einen erstaunten Schrei nicht unterdrücken. Alle sahen ihn an. Ihnen wurde bewusst, dass er erst in diesem Moment von der Gewalttat erfuhr.
„Fannac, hast du noch Fragen an unseren jungen Freund?“, fuhr der Priester ungerührt fort.
„Ich müsste mir die Überreste des Brandes selbst ansehen“, erklärte der Fährtenleser. „Du weißt ja, wo sie liegen, nicht wahr?“, wandte er sich an Itam.
„Ja, aber sie bewachen den Schutthaufen Tag und Nacht.“
„Der Schutt läuft uns nicht weg“, warf Hauptmann Garmo ein. „Wohl aber die Männer, die den Überfall begingen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie nahezu unbemerkt entkommen konnten. Ich habe zwölf Trupps ausschwärmen und jeden einzelnen Bauern befragen lassen – keiner hat etwas gehört in dieser Nacht. Dass sie unbemerkt einzeln gekommen sind und sich direkt bei Targurs Hof getroffen haben, kann ich mir ja vorstellen. Aber dass niemand hörte, wie sie davongaloppierten …“
„Führt mein Sohn immer noch den Trupp an, der am weitesten ausschwärmt?“, fragte der Fürst beiläufig.
„Natürlich, mein Fürst, es ist ja dein Befehl.“
Cintugen, der einmal Nachfolger seines Vaters werden sollte, war im vergangenen Winter fünfzehn Jahre alt geworden. Nicht nur im Volk, auch in der eigenen Familie fragte man sich, wann ihm die Götter wohl die erste Bewährungsprobe zuteilwerden lassen würden, die eines Fürstensohnes würdig wäre. Segomar erkannte die Chance, ihn bei der Jagd nach den Schwerträubern an die Spitze zu setzen. Seine Soldaten wussten, was zu tun war – wo immer eine Spur auftauchen würde, überließe man sie natürlich ihm.
„Die Räuber sind direkt in den Wald beim Hof geritten und dann weiter in die südlichen Wälder“, überlegte der Fürst. „Ich jedenfalls hätte es so gemacht. Dort gibt es gute Wege und kaum Gehöfte. So konnten sie unbemerkt verschwinden.“ Er wandte sich an den Priester: „Ritomar, konntest du nicht im Zwiegespräch mit den Göttern oder durch irgendeine andere Magie die Räuber aufspüren? Oder die Schwerter? Von ihnen muss doch eine gewaltige Macht ausgehen.“
Itam spürte, wie daraufhin ein betretenes Schweigen in der Luft lag. Niemandem, auch dem Fürsten nicht, standen Zweifel an den Fähigkeiten des Priesters zu.
Alle ließen ihre Blicke verstohlen zu Ritomar wandern und nahmen verwundert wahr, wie der mächtige Priester für einen schwachen Moment betroffen das Haupt senkte, bevor er erklärte: „Die Götter haben mir heute bei der Vogelschau einen Hinweis gegeben – wir müssen im Osten suchen.“
„Im Osten, aha.“ Der Fürst gab zu verstehen, dass er diese Erkenntnis für etwas mager hielt.
„Nun ja, das ist doch schon etwas“, warf die Fürstin beschwichtigend ein. „Targur hält schließlich Kontakte in alle Richtungen – zu den Fürsten und den fremden Stämmen im Norden, zu den Norikern im Süden, zu Pyrene und Canecoduno6 im Westen und zu den Handelsstationen an der Danubia7 im Osten.“
Fast nur zu sich selbst sagte der Fürst: „Wir dürfen den Räubern nicht nachlaufen, sondern müssen ihnen in Gedanken vorauseilen. Wohin wollen sie mit den Schwertern? Für wen sind die bestimmt?“
„Es gibt zwei Möglichkeiten“, überlegte Hauptmann Garmo. „Entweder, es sind Krieger, die diese Schwerter im Kampf selbst einsetzen. Dann kann ich nur hoffen, sie wollen uns nicht damit angreifen. Eine Armee mit zehn Eisenschwertern an der Spitze hält niemand auf. Oder sie verkaufen sie. Dann muss jemand ein Vermögen dafür eintauschen. Was sage ich, einen ganzen Tempelschatz!“
„Aber so ein Geschäft kann doch nicht unbemerkt vonstattengehen“, warf Fürstin Akiana ein. „Solch einen Schatz zusammenraffen, fortschaffen, bewachen, eintauschen – das muss doch auffallen. Egal, wo das passiert, das Wissen darum wird sich unter Kaufleuten wie ein Lauffeuer verbreiten, oder?“
„Du hast recht, meine Liebe – ein Kaufmann, der in letzter Zeit im Osten herumgekommen ist, könnte von so etwas erfahren haben“, stimmte der Fürst zu. „Garmo, suche den Verwalter und sieh dich mit ihm um, ob solche Händler auf dem Opios einquartiert sind. Bring sie her!“
Nach erstaunlich kurzer Zeit war Garmo mit zwei Männern zurück. Den Verwalter Medugen kannte Itam. Der andere war ein Mann, den er im ersten Augenblick als viel älter einschätzte, als er war. Als Itam später sein wahres Alter erfuhr, fragte er sich, welche Last oder sonstige Anstrengung ihn so vorzeitig hatte altern lassen.
Der Fürst jedenfalls kannte den Mann – es war Namant, ein Händler aus dem Osten. Der erschrak zutiefst, als ihm der Fürst darlegte, worum es ging. Aber er hatte eine Vorstellung, die in das Bild passte, das Fürstin Akiana von dem aufsehenerregenden Handel gezeichnet hatte. „Bei den Skythen geht es seit einiger Zeit sehr unruhig zu“, erklärte er. „Man hört von Überfällen auf Bernsteinhändler einerseits, von großen Geschäften, bei denen Berge von Gold die Besitzer wechseln, andererseits. Ich selbst meide die Gegend wohlweislich seit etwa anderthalb Jahren und tausche die Waren von dort lieber teurer, aber sicherer bei Handelsposten an der Danubia ein. Weit im Osten verschachern manche Skythenstämme angeblich alles günstig, was sie von Wert besitzen – Seide, Teppiche, Felle, Gold- und Silberschmuck, Sklaven. Andererseits bezahlen sie wohl jeden Preis für gute Pferde, Zaumzeug, Rüstungen und Waffen. Händler, die Abenteuer und großes Risiko nicht scheuen, sollen dort riesige Vermögen machen. Allerdings sei auch schon so mancher Kaufmann, kurz nachdem er reich geworden war, umgekommen auf den unsicheren Wegen in die Heimat.“
„Ich habe schon von diesen Umtrieben gehört“, erklärte der Fürst. „Aber man muss aufpassen – von je weiter die Geschichten kommen, umso mehr wird fabuliert. Insgesamt hört es sich nach Stammesfehden oder einem bevorstehenden großen Krieg an.“
„Ihr schätzt die Lage ganz richtig ein“, bestätigte Medugen, der Verwalter. „Nach allem, was ich von den Händlern aus dem Osten gehört habe, trifft wohl beides zu. Stämme verbünden und bekriegen sich. Die Skythen insgesamt stoßen weit im Osten zwischen ihren beiden Meeren, aber auch entlang der östlichen Alpenränder nach Süden vor8.“
„Es passt alles hervorragend ins Bild“, sagte Fürstin Akiana. „Zehn Eisenschwerter kann man dort ohne großes Aufheben schnell in ein Vermögen verwandeln, denke ich.“
„Zweifellos“, stimmte der Fürst zu. „Ist dir von solch einem Geschäft etwas zu Ohren gekommen, Namant?“
Der Händler schüttelte bedauernd den Kopf. „Wie gesagt, in der Ferne tut sich viel. Und sobald wertvolle Waren die Danubia erreichen, fallen sie als einzelne Lieferung kaum noch auf.“
„Ich hatte mir einen klareren und eingegrenzten Hinweis gewünscht“, erklärte der Fürst betrübt. „Die gesamte Skythenwelt als mögliches Ziel der Schwerträuber nützt uns nichts.“
Salmo, der Schmied, lenkte die Gedanken in eine neue Richtung: „Da müsste es noch einen Beteiligten geben, der Bescheid weiß – Gobat konnte zwar Klinge und Griffkern schmieden, aber so etwas Wertvolles wie ein Eisenschwert wird gewöhnlich reich verziert. Und in dieser Kunst war er nicht geübt, soviel ich weiß.“
„Nein, die prachtvollen Griffe meines Schwertes und Dolches aus Eisen sowie die Scheiden dazu hat mir damals ein etruskischer Künstler verziert, den ich eigens dafür kommen ließ“, erklärte der Fürst nachdenklich.
„Könnte der nun auch für Targur gearbeitet haben?“
„Das glaube ich nicht. Das ist ja schon über zehn Jahre her, und es war ein Wanderhandwerker. Den hat seither niemand mehr gesehen.
Aber du hast recht – ein Kunstschmied hat bestimmt schon an den Scheiden und Schwertgriffen gearbeitet. Ich nehme an, ein fahrender Handwerker. Wer solch hochwertige Kunst zustande bringt, muss von einem reichen Kunden zum anderen reisen.“
Bei den letzten Worten erinnerte Itam sich an den Fremden in den feinen Kleidern, der bei den Brandruinen mit Maban, dem dicken Hauptmann, gestritten hatte. Dieser Mann hatte angekündigt, zum nächsten reichen Kunden weiterzuziehen. Und er hatte von seiner kunstfertigen Arbeit gesprochen, für die er Gold, Silber, Bernstein und Korallen benötigte. Diese Arbeit sei wohl in den Flammen zerstört worden, hatte er geklagt. Natürlich – da er von einem Raub nichts ahnte, dachte er, die Schwerter und vielleicht auch die Scheiden, die er verziert hatte, wurden in den Flammen vernichtet.
„Ich habe diesen Kunstschmied gesehen“, meldete sich Itam sichtlich aufgeregt.
Alle Blicke waren schlagartig auf ihn gerichtet.
Wort für Wort berichtete Itam von dem Gespräch zwischen Hauptmann Maban und dem Mann namens Guar, der angekündigt hatte, nach Pyrene weiterzureiten.
„Das muss unser Mann sein!“, fiel ihm Salmo, der Schmied, begeistert ins Wort. „Wie heißt er, sagst du – Guar? Kennt ihn jemand?“
Die Männer der Runde sahen einander kopfschüttelnd an.
„Garmo, finde heraus, ob er jemandem auf dem Opios bekannt ist. Und wenn ja, dann bring denjenigen augenblicklich hierher“, befahl der Fürst.
Sofort eilte Hauptmann Garmo hinaus.
Diesmal kam er nicht so schnell zurück, denn er hatte keinen Erfolg. „Niemand kennt einen Kunstschmied namens Guar“, erklärte Garmo, als er schließlich wieder erschienen war.
Segomar dachte lange nach. Dann richtete er seinen Blick auf Itam: „Wie es scheint, bist du der Einzige von uns, der ihn gesehen hat.“
Itam, vom Blick des Fürsten höchst beunruhigt, begriff nicht.
„Außer dem Kunstschmied, von dem wir wissen, wo er sich aufhält, haben wir im Augenblick keine konkrete Spur“, fuhr der Fürst fort. „Du wirst dich meinem Handelszug anschließen, der ohnehin nach Pyrene aufbricht und noch Verschiedenes für die Totenfeier besorgt. Garmo, könnt ihr morgen schon losziehen?“
„Natürlich, in drei Tagen wäre es sowieso losgegangen. Es ist fast alles vorbereitet. Aber ich sollte doch den Zug zum Fürsten von Canecoduno begleiten?“
„Das muss einer deiner Unterführer tun. Ich brauche dich jetzt, damit du dich um diesen Guar kümmerst.“ Der Fürst wandte sich wieder Itam zu: „Also, wie gesagt – du musst den Kunstschmied in Pyrene finden und ihn Hauptmann Garmo zeigen. Dein Teil ist dann erledigt. Und du, Garmo“, sprach er jetzt wieder zum Hauptmann, „du wirst aus dem Mann herausbekommen, was er über die Schwerter weiß, oder?“
„Er wird es mir sagen“, erwiderte Garmo mit einem maliziösen Lächeln. „Wenn er erfährt, dass du, mein Fürst, sein Geheimnis kennst, wird er es ganz bestimmt nicht wagen, auch nur ein Wort für sich zu behalten.“
„Aber was kann der Kunstschmied denn über die Schwerträuber wissen?“, warf Namant, der Händler, ein.
„Aufwändiger Schmuck wie auf dem Griff oder der Scheide eines Schwertes verrät sehr viel“, erläuterte nun wieder die Fürstin. „Es stecken Symbole darin, die Rückschlüsse auf den Besitzer zulassen – eine Gruppe von Gottheiten, wie sie von einem bestimmten Stamm verehrt wird, das Wahrzeichen eines Feldherrn. Und ist es nicht üblich, einen persönlichen Talisman in eine wichtige Waffe einzufügen?“, fragte sie mit einem Blick zu den Kriegern.
Die Krieger nickten zustimmend.
„Seht ihr, solche Talismane muss der Künstler bekommen haben, und er weiß vielleicht auch, woher sie stammen. Es gibt viele Möglichkeiten. Jedenfalls sitzt er an der Nahtstelle zwischen den Waffen und den Menschen, für die sie bestimmt waren.“
„Aber sie waren doch gar nicht für die Räuber bestimmt“, äußerte Namant seine Zweifel.
„Einen Zusammenhang gibt es trotzdem“, entgegnete die Fürstin. „Woher wussten denn die Räuber von dem Geheimnis? Sie mussten doch irgendwie auf den bevorstehenden Handel gekommen sein, irgendjemanden ausspioniert haben. Oder die Auftraggeber der Schwerter haben es sich leicht gemacht und die Ware einfach gestohlen, statt einen Schatz dafür zu bezahlen. Einen Zusammenhang gibt es auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.“
„Wie auch immer, unser Plan ist gefasst“, verkündete der Fürst, erhob sein Trinkhorn und beendete damit das Treffen.
Einige der Männer wunderten sich, warum der Fürst trotz der Erkenntnisse, auf die man wunderbarerweise gestoßen war, so missmutig wirkte.
Segomars schlechte Laune rührte daher, dass der gerade gefasste Plan bedeutete, dass er das Abenteuer aufgeben musste, mit einem großen Handelszug nach Bragniac zu ziehen, der Stadt am Zusammenfluss der fernen Flüsse Saône und Doubs. Insgeheim hatte er gehofft, bei einem guten Verlauf der Reise sogar noch weiter bis zur legendären griechischen Handelsniederlassung Massalia9 zu gelangen. Doch was er an Tauschware für diesen Zug angesammelt hatte, musste er jetzt zum großen Teil für das prunkvolle Ausrichten der Totenfeier einsetzen.
Als die Versammlung im Auflösen begriffen war, betrachtete Ritomar, der Priester, Itam genauer. Der Köhlerjunge war etwas kleiner als der Durchschnitt und von Statur auch nicht so massig wie die Kelten, die in reiferen Jahren oft zum Fettwerden neigten. Trotzdem wirkte er nicht schwach, sondern sehnig und wendig. Übertrug Ritomar die körperliche Erscheinung auf die Beschaffenheit des Geistes, so war der Junge, der an der Schwelle zum Mann stand, wahrscheinlich kein plumper, prahlerischer Haudrauf wie so viele der Bauern und Krieger. Er schien beseelt von einem wachen Geist, der sich seinen Weg nicht mit Gewalt bahnt, sondern klug beobachtend die Pfade erkennt, die ihm das Schicksal vorgezeichnet hat.
Auch Itams Gesichtszüge passten zu dem Bild, das der Priester sich gerade von ihm machte. Die schmalen Augen schienen sich ständig anzustrengen, ein fernes Ziel zu erfassen. Die Wangen waren etwas stärker ausgeprägt als bei anderen Kelten, der Kiefer dafür etwas weniger – dadurch wirkten die Züge eher von überlegter List als von wildem Tatendrang geprägt. Itams Mund war, wenn er schwieg, immer leicht geöffnet; wie bei Lernenden, die begierig Erkenntnisse einsogen.
Als Itam die Halle verließ, tauchte der Priester ganz unvermittelt neben ihm auf und zog ihn in den Schatten eines angrenzenden Gebäudes. „Du bist dir im Klaren, dass niemals ein Wort von dem, was du dort drinnen erfahren hast, über deine Lippen kommen darf?“ Der eisige Blick Ritomars durchbohrte Itam förmlich.
Dieser wagte sich nicht im Entferntesten vorzustellen, was der Priester mit ihm anstellen würde, wenn er von den unglaublichen Dingen, die er gerade erfahren hatte, eine Silbe weitergäbe. Er starrte den Magier nur an und nickte heftig.
Der Schreck ließ nicht nach, als er dem Bannkreis des Priesters entkommen war. Im Gegenteil – Itam wurde auf dem finsteren Weg den Opios hinunter klar, dass es den mächtigen Männern in der Halle dort oben nicht viel bedeuten würde, sein Leben zu opfern, um die Geheimnisse zu schützen, die er nun kannte.
In der Nacht, in der die Versammlung auf dem Opios stattfand, gab es anderswo ein weiteres Treffen – heimlich, verschwörerisch, in einem finsteren Winkel des Waldes. Kein Geringerer als Häuptling Targur saß dort mit seinem Hauptmann Maban auf einem halb verrotteten Baumstamm.
„Es gibt keinen Zweifel – die Schwerter sind weg“, versicherte Maban. „Ich weiß, wo sie der Schmied aufbewahrt hatte, dort habe ich jedes Steinchen selbst umgedreht. Und auch, falls er sie irgendwo anders versteckt hätte, ich hätte sie gefunden. Sie wurden geraubt, davon müssen wir ausgehen.“
„Aber von wem? Die Fellgesichter können es nicht gewesen sein“, entgegnete der Häuptling. „Von denen war seit Monaten keiner hier, der ein Kundschafter sein könnte.“
„Als Kundschafter kann jeder dienen, das muss keiner von denen selbst sein“, gab Maban zu bedenken.
„Die Räuber wären sehr wahrscheinlich Skythen gewesen. Doch es hat niemand einen kommen oder gehen sehen. Nirgendwo.“ Der Häuptling schüttelte den Kopf. „Nein, das habe ich im Gefühl. Die waren das nicht. Und wenn – Luguwal wird bald zurück sein. Ihm ist bestimmt etwas aufgefallen, falls sie es waren. Außerdem lässt er zwei Männer zurück, die sich umhorchen, dafür habe ich gesorgt. Aber die werden nichts zu berichten wissen, da bin ich mir sicher. Maban, es ist viel einfacher – Segomar selbst war es.“
Der dicke Hauptmann nickte bedächtig. „Ja, die einzigen Reiter, die man in der Brandnacht gesehen hat, waren Krieger des Fürsten. Und etliche von den Bauern, die meine Leute befragten, schwören, dass Reiter des Fürsten von der Burg heruntergekommen waren, noch bevor sich das Feuer ausgebreitet hatte.“
„Das kann täuschen. Niemand kann beurteilen, ab wann genau der Brand zu sehen war“, warf der Häuptling ein, gab seinem Hauptmann aber recht: „Trotzdem – sie waren da und sonst niemand. Das ganze Durcheinander mit den angeblichen Nachforschungen und der angebotenen Hilfe diente nur zur Ablenkung.“
„Achtung!“ Maban hob den Kopf und deutete ins Dunkel des Waldes. „Er kommt.“
Es raschelte im Unterholz – der Spion vom Opios erschien und kam sofort zur Sache: „Der Fürst redet von nichts anderem als von den Schwertern.“
„Was sagt er?“, fragte Maban.
„Er will alles tun, um die Schwerträuber zu entlarven. Aber jede Spur führt ins Leere.“
„Was genau tut er?“
„Er hat Krieger ausschwärmen lassen, die Räuber zu suchen.“
„Das haben wir auch“, winkte Hauptmann Maban ab. „Die werden nichts finden.“
„Was noch?“, hakte der Häuptling nach.
„Er lässt den Kunstschmied verfolgen, der die Griffe anfertigte.“
„Was soll der denn über die Schwerträuber wissen?“, grunzte Maban verächtlich. „Hat ihm der Fürst Reiter nach Pyrene nachgeschickt?“
„Nein, er will ihn durch die Bewacher eines Handelszuges aushorchen lassen.“
„Ein Handelszug?“ Der Häuptling wurde hellhörig.
„Ja, sie sollen morgen losziehen. Ein paar Tage früher als geplant.“
„Gibt es noch andere Handelszüge?“
„Einen zum Fürsten von Canecoduno.“
„Siehst du, Maban, es ist genau so, wie ich es dir gesagt habe“, triumphierte Häuptling Targur, der sonst selten Gefühlsregungen erkennen ließ. „Er will die Schwerter schnell verschachern, bevor wir sie finden, ihn des Frevels überführen und stürzen. Die Nachforschungen sind nur Tarnung für die Eingeweihten unter seinen eigenen Leuten. Ein vorgeschobener Grund, die Handelszüge so schnell wie möglich loszuschicken. Das sieht dem Fürsten ähnlich: Er benutzt unbesiegbare Schwerter nicht zum Kämpfen, sondern tauscht sie ein gegen hellenische Vasen, feine Stoffe, Duftöle und Salben für den wund gerittenen Arsch seines Sohnes!“
„Fragt sich, ob der Arsch wirklich von einem Pferd so wund geritten wurde!“, meinte der Hauptmann lachend und die beiden anderen stimmten ein.
Dann wurde der Häuptling wieder ernst: „Zieht der Handelszug mit dem Boot los?“
Der Spion nickte.
„Maban, du schickst sofort Leute zur Warantia10. Unser Boot muss morgen früh fertig sein und sich dem des Fürsten anschließen. Die Bootsleute sollen die Augen offen halten nach Eisenschwertern in der Ladung. Morgen sendest du jeweils zwei Reiter nach Pyrene und Canecoduno. Sie müssen die Schwerter finden. Um jeden Preis.“
„Und was ist mit diesem Kunstschmied?“, fragte Maban. „Es gefällt mir gar nicht, dass er weit von hier mit Leuten des Fürsten zusammentrifft. Am Ende hat er doch etwas mit dem Schwertraub zu tun. Woher kennen die den Kunstschmied überhaupt?“
„Das weiß ich nicht“, log der Spion. Er wollte Itam noch nicht auffliegen lassen, sondern ihn als Trumpf in der Hinterhand behalten. Womöglich fand er selbst ja in Pyrene Dinge heraus, die ihm nützlich waren. Es schadete nichts, wenn er sich immer wieder mit neuen Erkenntnissen unentbehrlich machte.
„Vielleicht war der Kunstschmied ja Segomars Kundschafter. Er verriet ihm den richtigen Augenblick, in dem die Schwerter fast fertig, aber noch nicht fortgeschafft waren“, überlegte Maban.
„Das könnte durchaus sein“, stimmte Häuptling Targur zu.
Itam verabschiedete sich am Abend von Vater, Schwester und Großmutter. Er erzählte ihnen nur einen Teil der Wahrheit, nämlich, dass er als Gehilfe mit Kaufleuten des Fürsten loszog. Doch bereits das war Barcha, seinem Vater, zu viel. „Gestern hast du noch für Häuptling Targur gearbeitet und morgen arbeitest du für den Fürsten“, sorgte er sich. „Du kannst dich als kleiner Mann doch nicht so zwischen die großen Herren stellen!“
Er ahnte nicht, wie recht er hatte.
Itam sagte nichts dazu. Auch seine jüngere Schwester Magula, die außer Itam als einziges der Geschwister noch zum Vater hielt, schwieg. Es war längst sinnlos geworden, gegen dessen ewige Vorsicht anzureden. Die älteren Brüder und Schwestern, allesamt schon aus dem tristen Haus geflüchtet, hatten an ihm zeitlebens die ungestüme Kraft eines echten Kelten vermisst, verlachten seine Vorsicht gar als Verzagtheit. Sie rührte jedoch daher, dass der Vater etwa in Itams Alter erlebt hatte, wie sein eigener Vater als stolzer Krieger dem Hofherren beistand, den Angriff eines feindlichen Stammes abzuwehren. Versprengte Plünderer stießen jedoch auf das Haus der Familie, und nur mit letzter Not retteten sich Mutter und Kinder in die Wälder. Der Vater konnte sie nicht beschützen, weil er für andere kämpfte. Barcha hatte seitdem allem Kriegertum, aller Abenteuerlust und aller Gewalt eine Absage erteilt und war immer als einfacher Mann bei seiner Familie geblieben.
Senobena, Itams Großmutter, nahm sich an diesem Abend besonders viel Zeit, um das Essen zuzubereiten. Kochen war ein den Göttern geweihtes Ritual. „Erdmutter Ana, nimm diese Gabe entgegen“, murmelte sie, als sie den Weizen für den Brei ins siedende Fett schüttete. „Spende uns dafür nicht nur Leben und Nahrung aus dem Kessel, in dessen Gestalt wir dich verehren, sondern lasse dich auch bitten, für Itam dein Reich, die Erde, über die er schreiten muss, frei von Gefahr zu halten.“ Als sie kurz darauf Wasser aufgoss, um den Brei zu verdünnen, sprach sie dazu: „Quellgöttin Danu, auch dir opfere ich und bitte dich, lass Itam keinen Schaden nehmen, wenn er auf deinen Wassern fährt.“
Nach dem Essen wandte sich Senobena ihrer Webarbeit zu, und Itam begutachtete den Stoff, der da entstand. Seine Großmutter war eine gute Weberin – trotz ihres einfachen Webstuhls, in dem die herabhängenden Kettfäden durch gewöhnliche Kieselsteine gestrafft wurden, nicht durch die teureren Scheibengewichte aus Ton. Ihre Stoffe gerieten so fein, dass zwanzig bis fünfundzwanzig Fäden auf die Breite eines kleinen Fingers kamen. Itam fiel erst jetzt auf, dass sie ihren „Schatz“ endlich preisgab, die blaue Wolle.
Es war schon zwei Jahre her, als er miterlebt hatte, wie sie die Wolle färbte, die der Vater vom Schaf geschoren, und die Magula dann abgelaugt und mit der Fallspindel gesponnen hatte. Die Großmutter war mit riesigen Büscheln von Färberwaid angekommen, das sie an geheim gehaltenen Orten gesammelt hatte, und hatte die Pflanzen mit dem Messer zerkleinert. Während der folgenden Tage, an denen sie trockneten, musste die ganze Familie in den Schweinetrog urinieren; die Sau fraß derweilen aus einer Erdkuhle. Das getrocknete Gehäcksel kam in den Holztrog mit der mittlerweile äußerst übel riechenden Flüssigkeit und blieb eine Zeit lang in der prallen Sonne stehen. Alle versuchten mit wenig Erfolg, ihren Ekel zu verbergen, als Senobena schließlich hineinstieg und die Masse mit den Füßen stampfte – Itams Vater ließ sie erst wieder ins Haus, nachdem sie sich in der Agira11 gewaschen hatte. Noch größer wurde der Ekel, als sie diesen Brei tagelang unter grässlichem Gestank immer wieder aufkochte. Endlich füllte sie die Wolle hinein, ließ sie dann trocknen und gab sie danach abermals hinein. Heraus kam grüne Wolle, die an Licht und Luft jedoch bald ein intensives Blau annahm. Senobena war daraufhin alles verziehen, denn blaue Wolle war wertvoll.
Leuchtend gelbe Wolle hatte sie in einem Sud aus Birkenlaub und Kamille gefärbt und braune Wolle mithilfe von Eichenrinde. Gelbe und braune Quadrate wurden nun von schmalen blauen Streifen durchkreuzt. Die Großmutter hatte sich geweigert, die blaue Wolle vor der Zeit für einen Stoff zu verarbeiten, den sie vielleicht nicht teuer genug eintauschen konnte. Doch zum Totenfest würden unzählige Händler, vornehme Männer und Frauen kommen, die Qualität hoch schätzten – die Feinheit und die raffinierten, farbenfrohen Muster keltischer Stoffe waren sogar bei den Hellenen begehrt. Unter Senobenas geschickten und erfahrenen Händen entstand ein Tuch, das einem anspruchsvollen Gast des Häuptlings oder des Fürsten mehr Tauschware entlocken konnte als einem durchreisenden Händler. Bald würde Senobena ihre Ware vor dem Tor zur Siedlung des Opios feilbieten.