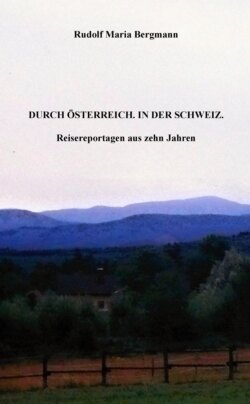Читать книгу DURCH ÖSTERREICH. IN DER SCHWEIZ. - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 7
TRAUNVIERTEL Reich und geistreich. Im Benediktinerkloster Kremsmünster
ОглавлениеDie Einöde wurde nach Kremsmünster eingemeindet, heißt aber noch immer „Baum mitten in der Welt“. Sie scheint hier endlos und einsam, die Welt, nichts als eine Hochfläche, die im flockig dicht fallenden Schnee noch einsamer, noch endloser erscheint. Bei schönem Wetter, heißt es, stehen die Berge des Salzkammerguts wie eine Bordüre über dem Biergarten und im Norden soll dann der Böhmerwald als blasses blaues Band schimmern. Den Ursprung des melancholischen Namens kennt niemand. Das einsame Haus, ein Gasthof, heißt auch „Baum mitten in der Welt“. Die mächtige Linde daneben wurde im Jahr 1929 gepflanzt. Neuere Verunstaltungen sind die hässliche Sendestation auf der anderen Straßenseite und eine so genannte Aussichtswarte. Das rostige Ungetüm soll daran erinnern, dass von diesem Ort aus Kaiser Franz I. sein Riesenreich zwischen Böhmen, Adria und Russlands Grenze neu vermessen ließ, insgesamt 698.700 Quadratkilometer mit 21 Millionen Untertanen. Als im Jahr 1823 die k.k. Vermessungsingenieure zum Theodoliten griffen, stand ihnen vielleicht der Studiosus Adalbert Stifter neugierig im Visier. Er besuchte damals, von 1818 bis 1826, das berühmte Gymnasium im Kloster der Benediktiner. Die Patres eröffneten dem Bauernbuben aus dem Böhmerwald die Wunderwelten der Wissenschaften, Kunst und Literatur. Besonders der Lateinlehrer Pater Placidus Hall förderte ihn und wurde zum väterlichen Freund. Der Zeichenlehrer Georg Riezlmayer erkannte Stifters enormes malerisches Talent. Die Landschaftsmalerei hatte es ihm angetan. Mit hungrigen Augen, Zeichenblock und Stift durchstreifte er die Umgebung des Klosters. Auf seinen Aquarellen herrscht das Benediktinerstift mit dem alles überragenden "mathematischen Turm" auf der Bergterrasse wie ein rurales Escorial über dem bäuerlichen Dorf. Die spröde Siedlung fließt vom Kloster den Hang hinunter; man sieht ihr an, dass sie aus einer Ansiedlung weltlicher Dienstleute hervorging.
Der Gegend setzte er später auch ein literarisches Denkmal, in seinem 1857 erschienen großen Bildungsroman "Der Nachsommer" mit peinlich genauen Schilderungen der Natur. Obwohl im Roman, der in den letzten Regierungsjahren von Kaiser Franz I. spielt, direkte topografische Bezüge fehlen, wird diese Vorgebirgslandschaft so treffend charakterisiert, dass der „Nachsommer“ das schönste literarische Itinerar in das „Land ob der Enns“ ist.
An der Stelle des heutigen Landgasthofs stand in Stifters Tagen ein Gutshof, ein mächtiger Vierkanter wohl, wie er für die Gegend typisch ist, schmucklos, wuchtig, uralt. In so einem Gutshof ersucht der Ich-Erzähler Heinrich um Obdach; der Hausherr führt ihn in den Garten: „Endlich hatten wir die höchste Stelle erreicht, und mit ihr auch das Ende des Gartens. Jenseits senkte sich der Boden wieder sanft abwärts. - Auf diesem Platze stand ein sehr großer Kirschbaum, der größte Baum des Gartens vielleicht der größte Obstbaum der Gegend. Um den Stamm des Baumes lief eine Holzbank, die vier Tischchen nach den vier Weltgegenden vor sich hatte, dass man hier ausruhen, die Gegend besehen, oder lesen und schreiben konnte. Man sah an dieser Stelle fast nach allen Richtungen des Himmels ... Man mußte an heißen Tagen von hier aus die ganze Gebirgskette im Süden sehen ... Gegen Mitternacht erschien ein freundlicher Höhenzug“.
Alles ist noch so, wie Stifter es festhielt und nichts ist mehr so. Der Ort rinnt planlos durch den Flussgrund, kriecht alle Hänge empor, quillt über eiszeitliche Schotterterrassen bergan. Die Gemeindepolitiker verschandeln mit ihrer katastrophale Baupolitik seit Jahrzehnten den landwirtschaftlich geprägten Ort. Kremsmünster ist zum Industrierevier ausgefranst, ein heilloses Konglomerat, in dem mittelständische Betriebe zwischen Wohngebiete getrieben und Gewerbeparzellen mit Wohnhausriegeln aufgeforstet wurden. Wuchernde Neubausiedlungen und betonierte Feldwege nehmen der schönen, eigentümlich stillen Hügellandschaft vor dem Gebirge viel von ihrem Reiz. Sichtachsen, die einmal vom Stift zum Schloss Kremsegg und bis ins weit entfernte Zisterzienserkloster Schlierbach ausstrahlten, wurden gedankenlos gekappt.
Nur die Erscheinung des Stifts ist noch immer imposant: Rund 300 Meter zieht es in vier mächtigen Baublöcken an der Hangkante entlang. Die Doppeltürme der Kirche setzen im Westen einen Akzent, darauf antwortet im Osten der mächtige Turm. Diesem magischen Point de vue konnte sich noch kaum jemand entziehen. Franz Schubert, der das Kloster besuchte, als sich Stifter auf die Matura vorbereitete, schrieb an den Bruder: „Man übersieht...ein sehr liebliches Thal, von einigen kleinen Hügeln unterbrochen, auf dessen Gipfel das weitläufige Stift schon von der Fahrstraße, die über einen entgegengesetzten Bach herabführt, den prächtigsten Anblick gewährt, der besonders durch den mathematischen Thurm sehr erhöht wird.“
Als man den Turm vor 250 Jahren hochzog, war das Kloster schon tausend Jahre alt. Es gehört zu den ältesten bestehenden Abteien und kann natürlich eine solide Gründungslegende vorweisen: Während einer Jagd soll Gunther, ein Sohn des baierischen Herzogs Tassilo III. von einem Eber tödlich verletzt worden sein. Wo er starb, stiftete der Herzog im Jahr 777 das Kloster Kremsmünster und stattete es großzügig aus. Die Leitung übertrug er seinem Hofkaplan: Vertrauen in Gott ist gut, Kontrolle noch besser.
Unter den vielen Klostergründungen Tassilos war Kremsmünster am weitesten nach Osten vorgeschoben, in eine von Slawen bewohnte Grenzregion. Als politisches und religiöses Machtzentrum sollte es die Gegend zwischen Traun und Enns ans baierische Kernland binden und Einfluss auf die Awarengebiete im Osten nehmen.
Wie viele Klöster leistete es Bedeutendes für Urbarmachung, Besiedlung und Landwirtschaft, aber wohl doch nicht in dem Umfang wie das die Propaganda der Gegenreformation behauptete. Als soziales und kulturelles Zentrum ist es dagegen kaum zu überschätzen. Unklar ist, welche Rolle es spielte, nachdem Tassilo, gescheitert mit dem Versuch, Baiern von der Vorherrschaft Karls des Großen loszueisen, vom Frankenkönig angeblicher Geheimverbindungen zu den Awaren bezichtigt, samt seiner Familie 788 zunächst zum Tod verurteilt, zu lebenslanger Klosterhaft begnadigt worden war.
Bevor es zum Bruch mit Karl kam, soll Tassilo dem Kloster heimlich sein Zepter übergeben haben. Angeblich hätten es die Patres zerlegt und zu Kerzenleuchter umarbeitetet. Diese „Tassiloleuchter“ gehören zwar unter den Kunstschätzen der Abtei zu den spektakulärsten Stücken, gelten aber mittlerweile als Arbeiten angelsächsischer Provenienz aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Fest steht allerdings, dass der „Tassilokelch“, das kostbarste Stück der Schatzkammer, tatsächlich ein Geschenk des herzoglichen Paares war. Mehr als drei Kilogramm schwer und beinahe zwei Liter fassend, wird dieses Hauptwerk karolingischer Goldschmiedekunst noch immer an hohen Festtagen verwendet. Darin drückt sich eine Maxime des Klosters aus: Man versteht sich als eine der Gegenwart verpflichtete Gemeinschaft, nicht als Museum, obwohl zwei Museen den Besuchern offen stehen.
Nach Tassilos Sturz entfaltete Kremsmünster, zur Reichsabtei erhoben, intensive missionarische und wirtschaftliche Aktivitäten, die Anfang des 10. Jahrhunderts mit der Zerstörung durch die Ungarn abrupt endeten. Weil Kaiser Heinrich II. das Kloster wieder herstellte, wacht seine Skulptur mit jenen Tassilos und Karls des Großen, der das Kloster bestätigte, über dem Haupttor.
Goldene Zeiten erlebte das Stift, als es im Namen Habsburgs die „Rekatholisierung“ des protestantischen Oberösterreich dirigierte. Dabei fielen reichlich Späne vom katholischen Hobel: Familien, die sich weigerten zu konvertieren, mussten das Land verlassen. Erst 1847 konnte sich wieder eine protestantische Familie in Kremsmünster ansiedeln. Die vollständige bauliche Erneuerung des Klosters im 17. und 18. Jahrhundert kann man im Rahmen dieser rabiaten Aktion sehen: Das Kloster wusste mit dergleichen ABM-Maßnahmen die Bevölkerung für sich einzunehmen.
Obwohl sich die Umbauten unter der Leitung internationaler Künstler durchaus auf europäischem Niveau bewegten, hielt man mehr als anderswo an tradierten lokalen Formen fest, verpackte sie nur ins neue barocke Gewand. Trotzdem sind zwei außerordentliche Hauptwerke darunter. Der Fischkalter, eine Abfolge von fünf arkadengesäumten Wasserbecken mit filigranen schmiedeeisernen Gittern und Wasser sprühenden Brunnenfiguren lässt eher von heißen Nächten in spanischen Gärten träumen als an – weiland allerdings äußerst lukrative - Fischzucht denken. Der „mathematische Turm“, erbaut von 1748 bis 1759, ist tatsächlich das erste Hochhaus Europas und ein Solitär barocker Klosterarchitektur. Vor allem ist er ein bauliches Dokument klösterlicher Forschung, wie sie im 18. Jahrhundert vielerorts üblich war.
Um die Lebensqualität ihrer zumeist bettelarmen bäuerlichen Untertanen zu verbessern, befassten sich die Mönche mit Meteorologie und Ackerbau. Sie studierten, was keine hundert Jahre früher noch als Gotteslästerung gegolten hätte und unterhielten „naturwissenschaftliche Kabinette“, ausgestattet mit Instrumenten und allerlei kuriosen Sammlungen. Während die Säkularisation davon andernorts meist nichts übrig ließ, wurden die Bestände in Kremsmünster seit 250 Jahren nicht angetastet. Deshalb ist der Turm mit seinen Sammlungen im Kontext des Klosters ein einzigartiges Dokument des allumspannenden barocken Weltbilds, das Universalmuseum einer universalen Epoche. Der intensiven Beschäftigung mit der Astronomie verdankt der Turm seine Umbenennung zur „Sternwarte“. Die Patres beobachteten die Planeten, staunten nicht schlecht über den neu entdeckten Uranus und forschten über die Sonnenflecken, wie das vor ihnen nur Galilei getan hatte. Bei der Vermessung der Kronländer ließ Kaiser Franz I. vom Baum mitten in der Welt zuerst die Sternwarte anvisieren, vielleicht als kleine Referenz an ihren überragenden Ruf. Seit 1762 fertigten die Brüder in ununterbrochener Folge Wetteraufzeichnungen an; heute gehört die Wetterstation zum österreichischen Datennetz. Auch die Sammlungen werden laufend ergänzt und der Turm dient den Benediktinern nach wie vor als naturwissenschaftliche Arbeitsstätte.
Der geistige Vater dieses Gebäudes ist Anselm Desing, ein Benediktiner aus dem oberpfälzer Kloster Ensdorf, der zu seiner Zeit als Universalgelehrter in Europa berühmt war. Abt Alexander Fixlmillner fand in ihm einen kongenialen Partner zur Umsetzung seiner Reformideen, die in der Überzeugung gründeten, dass ohne Wissenschaften die Religiosität keinen Halt mehr habe. Deshalb errichtete das Kloster eine Ritterakademie als universitäre Studienanstalt für den adeligen Nachwuchs, wobei auch Bürgerliche Zutritt hatten. Neben allerlei romantischem Ritterkokolores standen Mathematik und Naturwissenschaften, Geschichte und Geografie auf dem Lehrplan und die Philosophie eines Leibniz und Wolff. Desing schrieb die Lehrbücher selbst oder verwies auf französische Werke, herrsche in ihnen doch – so seine Überzeugung - unter dem Einfluss Descartes ein sehr fortschrittlicher Geist. Der Lehrplan war praxisorientiert, ausgerichtet auf die Berufsmöglichkeiten der Studenten. Aus diesem Ansatz heraus entwickelte Desing dann die Idee der Sternwarte und lieferte auch gleich den architektonischen Entwurf.
So ein Gedanken-Gebäude hatte die Welt noch nicht gesehen: Ein steiler Mittelrisalit mit Dachaufbauten, eingeschoben in einen niedrigeren nichtsdestoweniger mächtigen Kubus. Fünfzig Meter steigt das Gebäude vom Portal empor; 399 Stufen führen auf die oberste Plattform. Die strenge Ordnung der sieben spröde dekorierten Geschosse verweist auf die hierarchische Ordnung der Dinge im göttlichen Universum, das in der Siebenzahl präsent ist. Hierarchisch steigen die Wissenschaften in Gestalt der Sammlungen empor, über Geologie und Paläontologie, Mineralogie und Physik, Zoologie und Kultur und kulminieren in Astronomie und Theologie in Gestalt der Sternwarte und einer Kapelle obenauf. Alles wird mit Jedem in Beziehung gesetzt und alles in dem Einem gezeigt. Man verstand das Studium der Wissenschaften als Lob der Schöpfung und des Schöpfers, und machte alles doch nur einer propagandistischen Aufgabe dienstbar, der Wiedererrichtung und Bewahrung des katholischen Glaubens.
In Kremsmünster übte sich der Barock in der Kunst des Weglassens. Strenge Ordnung täuscht hier freie Improvisation nicht vor und zeigt, dass ein neuer Geist herrscht. Nirgends sonst wurde das so konsequent in architektonische Form gegossen und noch die Kirchenausstattung ist davon getragen. An Stelle illusionistischer Bühnenaltäre präsentieren skulpierte Engel große Leinwandbilder. Sie weisen so darauf hin, dass sie nur das Bild eines Bildes zeigen.
Wie steht es heute um Kremsmünster? Zum Kloster gehören momentan 51 Brüder – im Jahr 1999 waren es noch 68 -, die hier oder in Pfarreien der Umgebung Dienst tun. Dazu kommen hundert weltliche Mitarbeiter, die der Wirtschaftsbetrieb Kloster beschäftigt, der damit zu den wichtigsten lokalen Arbeitgebern gehört. Umfangreicher Waldbesitz, ein Gärtnereibetrieb und die berühmte Weinkellerei liefern den Großteil der Einnahmen. Dazu kommen noch die Schulgeldeinnahmen aus dem sehr renommierten Gymnasium. Dem stehen schon allein erhebliche laufende Kosten für die Klostergebäude und für Unterhalt und Ausbau der Sammlungen entgegen.
Zur wissenschaftlichen Reputation des Klosters gesellt sich der weltliche Ruf seiner Weinkellerei. Seit der Gründung im Jahr 777 wird ununterbrochen Weinbau betrieben, gehörten Weingärten doch zur herzoglichen Dotation. Um 900 kamen Rebflächen in der Wachau dazu, später weitere Besitzungen im Kremstal. Rund zwanzig Hektar Rebfläche stehen im Ertrag, darunter berühmte Lagen wie der „Steinerne Hund“ in Krems oder „Dürnsteiner Schütt“. Seit dem 18. Jahrhundert wird hauptsächlich Grüner Veltliner angebaut, schon viel früher allerdings Riesling, daneben nun im Burgenland auch Blauburgunder, Zweigelt und andere Rote. Neben traditionell ausgebauten Spitzenweinen platziert man seit einigen Jahren erfolgreich modische Kreszenzen auf dem Markt wie Chardonnay und im Holzfass gereiften Cabernet-Sauvignon.
Wie viele Klöster hat sich auch das Stift den Tourismus als Einnahmequelle und zur Werbung in eigener Sache erschlossen. Allerdings sucht man die Balance zwischen Tradition und Innovation, wehrt sich gegen eine Totalvermarktung, die andere Klöster an den Rand eines monastischen Disneylands gebracht hat, möchte sich andererseits von der profitablen Entwicklung nicht abkoppeln. Die Abtei wirbt mit Kunstwerken von Weltrang, bindet aber den Museumsbesuch an Gruppenführungen. Und die Sternwarte bleibt im Winterhalbjahr geschlossen. Ein Angebot zur inneren Einkehr ist das "Kloster auf Zeit". Zur weltlichen Einkehr gibt es den "Stiftsschank", wo sich zu bodenständiger Küche die Stiftsweine verkosten lassen. Das passt dann doch noch zum Motto, das seit Jahrhunderten das Stiftstor ziert: „Dies Tor soll jedem offenstehn, der ehrbar will durch selbes gehen“.