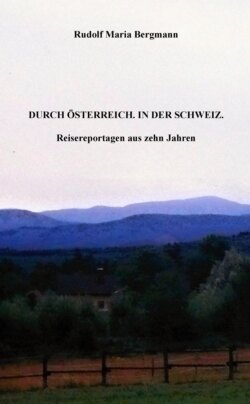Читать книгу DURCH ÖSTERREICH. IN DER SCHWEIZ. - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 8
KÄRNTEN Kärnten verhüllt sich. Unterwegs zu den berühmten Fastentüchern
ОглавлениеDie Feier im Dom von Gurk beginnt in einem Märchenwald aus hundert schlanken Säulen von weißem Kärntner Marmor. Die dämmrige Krypta ist ein heimlich unheimlicher Ort, erfüllt von Kerzenlicht und Modergeruch. Gebete werden gesprochen, dann zieht der Priester mit den Gläubigen in einer Prozession hinauf ins Kirchenschiff. Die stille Hochräumigkeit überrascht; das bedeutendstes Bauwerk der Romanik in Österreich streckt sich schon der schlanken Gotik entgegen. Auf dem Steinboden vor dem raumgreifenden barocken Hochaltar liegt eine gleich breite, geheimnisvolle Rolle von Stoff, voluminös wie ein kolossaler Teppich. Zum Höhepunkt des Ritus wird sie nun an zwei Seilen von oberhalb des Gewölbes feierlich emporgezogen. Ein ungeheures mittelalterliches Bilderbuch, mehr als fünfhundert Jahre alt, fast neun Meter breit und ebenso hoch, entfaltet sich vor dem staunenden Publikum. Das ist das berühmte Gurker Fastentuch. Bis zum Ostersamstag verhüllt es Hochaltar. Nur während dieser sechsundvierzig Tage ist stattdessen das erstaunliche Kunstwerk zu betrachten: hundert biblische Darstellungen in zehn Reihen zu zehn rechteckigen Feldern; die Geschichte der Welt auf achtzig Quadratmetern, vom Anfang bis zum Ende der Zeit. Charakteristisch ist das typologische Bildprogramm, das zwischen Vorgängen des Alten und Neuen Testaments Analogien im Sinn von Verheißung oder Vorbild und Erfüllung behauptet. Man ist erstaunt, wie stark der sakrale Bildteppich den Raumeindruck dämpft und dabei eine archaisch innige Atmosphäre schafft. Das monumentale Fastentuch des Malers Konrad von Friesach aus dem Jahr 1458 ist heute das älteste derartige Kunstwerk im Alpenraum.
Der Ursprung solcher Fasten- oder Hungertücher genannten volkstümlichen Kunstwerke liegt im Dunkeln. Um das Jahr Tausend waren sie jedenfalls in Deutschland und Italien, Frankreich und England gebräuchlich, zur Reformationszeit in ganz Europa. Von Anfang an dienten sie zur Verhüllung liturgischer Gegenstände oder ganzer Raumteile in den Kirchen. Schließlich passte der Glanz kostbaren Altargeräts so wenig zur ernsten Passionszeit wie die romanischen Triumphkreuze, weil sie den Gekreuzigten nicht leidend, sondern als triumphierenden König zeigen. Gewiss stand im Hintergrund auch der Gedanke eines symbolischen Ausschlusses vom Kultgeschehen als Buße für die Sünder. Vielleicht war das einmal so wirksam wie heutzutage ein Fernsehverbot für ungehorsame Kinder.
Dreiundzwanzig historische Fastentücher aus dem 15. bis 18. Jahrhundert gibt es noch in Kärnten. Das ist der umfangreichste Altbestand weltweit. Alle befinden sich noch am ursprünglichen Ort und sind in Gebrauch. Doch nicht minder interessant sind Kärntens moderne Fastentücher, gestaltet von Künstlern, mit denen die Tradition in die Zukunft fortgeschrieben wird. Denn nach wie vor kommt in Österreichs südlichstem Bundesland der Passionszeit und dem Osterfest eine ganz besondere Bedeutung im Jahreslauf zu. Beinahe jeder Ort pflegt sein eigenes Brauchtum, manches davon geht auf vorchristliche Zeiten zurück. Fremd und archaisch anmutende Rituale, aber auch Althergebrachtes, das Erinnerungen an die eigene Kindheit Wachzurufen vermag, schaffen in den Wochen vor Ostern eine eigentümlich erwartungsvolle Stimmung.
In Millstatt, am Nordufer des gleichnamigen Sees, liegt Ostern förmlich in der Luft. Unter der schmeichelnd milden Märzsonne füllen sich die Straßencafés vor der Kulisse der verschneiten Berge. Am Vorplatz der ehemaligen Benediktinerabtei tanzen schon Mücken in der Luft. Das Kloster wurde im 17. Jahrhundert aufgelöst; wegen „Sittenverfall“ heißt es. Offenbar hatte das romanische Portal, reich geschmückt mit steinernen Menschengesichtern und Tierfratzen, die das Böse fernhalten sollen, seine Zauberkraft eingebüßt. Im Innern klingen Stilepochen aufgeregt durcheinander, verstummen aber vor dem Farben sprühenden Fastentuch, das vor dem Hochaltar zu schweben scheint. Nächst dem Gurker Exemplar ist es das kunstgeschichtlich bedeutendste und größte. Ende des 19. Jahrhunderts wäre das Meisterwerk des Malers Oswalt Kreusel aus dem Jahr 1593 ums Haar verloren gegangen. Erst 1984 fand es an seinen Bestimmungsort zurück. Auf der neun Meter hohen Leinwand sind 41 Bildfelder in sieben Reihen untergebracht. Die Wasserfarben entfalten eine äußerst malerische Wirkung, ausgerichtet mehr auf ein dekoratives Gesamtbild als auf die theologische Botschaft.
Fastentücher wie jene in Millstatt und Gurk gehören bereits in die Hochphase der Gattung, denn die bilderreiche, schaufreudige Gestaltung scheint ein Widerspruch zum Verhüllungszweck. Doch die Bemalung thematisiert, was dahinter verdeckt auf dem Altar geschieht. Mit der Verhüllung soll das Verborgene des Verhüllten verdeutlicht werden. Parallelen zur Gegenwart tun sich auf, man denkt an temporäre Aktionen wie den verschnürten Pont Neuf und den verpackten Reichstag. Aber auch die Übermalungen eines Arnulf Rainer, seine geschwärzten Kruzifixe, die in den 1950er Jahren für saftige Skandale sorgten, erscheinen vor diesem Hintergrund in anderem Licht. Tatsächlich studierte er Ende der 1940er Jahre an der Staatsgewerbeschule in Villach.
Dass man heute besonders viele Fastentücher in den Orten an den Ufern der Gurk findet, ist nur Zufall. Allerdings eröffnet das die Möglichkeit für eine faszinierende Rundreise, denn die Gurk strömt in weitem Bogen durch das Land, vom Nockgebiet im Hochgebirge bis zum Zusammenfluss mit der Drau im Klagenfurter Hügelland.
Wir verlassen deshalb Millstatt in Richtung Osten und treffen hinter Kleinkirchheim auf den Fluss. Um ihm zu folgen, biegen wir bei Gnesau von der Fernstraße ab und nehmen linker Hand einen verwachsenen Fahrweg, der so steil bergan zieht, dass die Gurk in ihrer Schlucht bald nicht einmal mehr zu hören ist. Dafür öffnet sich nach fünf Kilometern und einer halsbrecherischen Fahrt der Wald und gibt den Blick frei auf das uralte Alpenbad St. Leonhard. In 1100 Metern Höhe liegt es im März noch verschneit. Seit dem 12. Jahrhundert zogen die Menschen hier herauf, wegen des heilenden Wassers, vielleicht auch wegen der lockeren Sitten beim gemeinsamen Bad. Für die Kirche heiligte neben Sankt Leonhard vor allem der Zweck das Wasser. Sie hielt eine Hand segnend darüber und die andere offen drunter und drückte beide Augen zu. Doch vor Jahrzehnten entzog der Heilige dem Wasser seine Gunst und alles verfällt nun. Wo in den zwanziger Jahren noch Kutschen vorfuhren, ist mit dem Auto kaum mehr ein Durchkommen möglich.
Irgendwie gelangen wir dennoch wieder hinunter zur Straße und zur Gurk und machen Station in Deutsch-Griffen, wo die Wehrkirche innerhalb der hohen Friedhofsmauer wie eine Festung über dem Dorf wacht. Hinauf führt eine hölzerne Stiege mit mehr als hundert Stufen. Für die prachtvolle Aussicht, die sich oben bietet, werden die Frauen und Mädchen keinen Blick übrig haben, wenn sie am Ostersamstag volle Weidenkörbe zur Fleischweihe hinaufschleppen. Die enthalten das Osterfrühstück, zu dem nur Geweihtes auf den Tisch kommt. Natürlich scheiden sich am korrekten Inhalt des Weihkorbes die Geister: Obligat sind Schinken, gekochte Räucherwürste, Rindszunge und der Reindling, ein Kuchen mit Rosinen, Nüssen und Zimt. Die Zugabe von gekochten, gefärbten Eiern und einer Meerrettichwurzel bleibt umstritten. Die Weihkorbdecke bedeckt die Speisen; sie ist mit religiösen Motiven bestickt, in mühevoller Handarbeit. Der Brauch erinnert an das Opferlamm, das erst geweiht, dann geschlachtet und schließlich gemeinsam verspeist wurde. Seit dem siebten Jahrhundert soll die Fleischweihe bekannt sein; dagegen ist die gotische Kirche mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert beinahe jung. Das spätbarocke Fastentuch vor dem Hochaltar verbirgt bloß dessen Aufbau und zeigt nur eine Szene, die Beweinung des toten Christus durch seine Mutter. Das bescheidene Format ist so typisch für jüngere Tücher wie die Konzentration auf ein Bild. Als dieser Behang entstand, wurden andernorts im Zeichen der Aufklärung unersetzliche Exemplare als Gemäldeleinwand verscherbelt.
Hinter Deutsch-Griffen weitet sich das Gurktal zu einer flachen Terrassenlandschaft, Nadelwälder säumen die Flanken. Es ist eine abgelegene Gegend, beinahe ganz ohne Industrie. Schon von weitem sind die Zwillingstürme des Gurker Doms im flachen Wiesengrund zu sehen. An Zweinitz sollte man aber nicht vorbeifahren. Mit der Freskierung der schönen romanischen Dorfkirche haben sich Generationen von Künstlern ein Zubrot verdient, die eigentlich im Dom von Gurk beschäftigt waren. Überhaupt ist Kärnten besonders reich an mittelalterlichen Wandmalereien, Skulpturen und Bauten: Die Blütezeit des Landes war mit der Annexion durch die Habsburger im Jahr 1335 vorbei; am Ausgang des 16. Jahrhunderts hielt mit dem Ende des Bergbaus die Armut Einzug. Für barocke Modernisierungen fehlte das Geld.
So bewahrte auch Gurk den Charakter einer mittelalterlichen Siedlung im Schatten des Domes. Ein paar Neubauten halten respektvoll Abstand, und von der Terrasse des Domcafés geht der Blick nach wie vor ungehindert zu den schneebedeckten Zweitausendern im Osten. Davor lauert die Strassburg über dem Tal, nur einen Steinwurf entfernt. Dort residierten über Jahrhunderte die Bischöfe. Größer als ihr Gottvertrauen war offenbar nur das Misstrauen gegen ihre Schäflein. Viel malerischer als das martialische Gemäuer ist ein Ensemble auf dem sonnigen Plateau des vorgelagerten steilen Hügels: Die Kirche von Lieding, der gotische Karner, die Friedhofsmauer und der Pfarrhof fügen sich zum Postkartenmotiv. In der Kirche sind drei graziöse Rokokoaltäre mit Fastentüchern verhangen. Gewiss entstanden Altäre und Fastentücher gleichzeitig. Denn die Figur der Maria als strahlende Himmelskönigin auf dem Hauptaltar passt nicht in die Fastenzeit, zumal ihr eine dezent erotische Ausstrahlung nicht abzusprechen ist. Diskret verdeckt das Kunstwerk ein Behang mit der Darstellung des Gekreuzigten. Was mögen die Nebenbehänge mit Geißelung und Dornenkrönung verbergen? Die drei Tücher zeigen jedenfalls die charakteristische Bildfolge des 18. Jahrhunderts. Es heißt allerdings, die Liedinger Fastentücher seien das schönste Ensemble.
Von Straßburg windet sich eine schmale Straße hinauf nach Kraßnitz und endet im Dorf hinter der Kirche. Im Gurktal war es schon fast frühsommerlich warm, hier oben fegt noch ein eisiger Wind über schmutzig graue Schneewehen. Das weitläufige, hügelige Hochland ist so dünn besiedelt, dass man sich einsam fühlt. Die Abgeschiedenheit spiegelt sogar das örtliche Fastentuch wieder, denn obwohl in der Barockzeit entstanden, hält es an der mittelalterlichen Rasterung in rechteckige Einzelfelder fest, wenngleich sich die Erzählung nun auf die Passion und Ostern beschränkt. Nur durch die Aufmerksamkeit des Kastellans der Strassburg entging diese prachtvolle Temperamalerei noch in den 1960er Jahren nur knapp der Zerstörung.
Wo die Metnitz von Norden in die Gurk mündet, öffnet sich das Tal gegen Süden in die weite Ebene des Krappfelds. Seit Urzeiten war der melancholische Landstrich eine wichtige Verkehrsachse; insofern hat der höllische Verkehrslärm einen historischen Bezug. Das tut dem Reiz der alten Kirche St. Stephan kaum Abbruch, die am gewölbten Rand der Ebene auf einem Vorsprung über der Straße lagert. Das Fastentuch aus dem Jahr 1612 wirkt in der Ausführung spröde, ist aber doch ein wichtiges Exemplar hinsichtlich von Veränderungen im Verständnis und der Funktion der Altarbehänge im Frühbarock. An die Stelle der gleichmäßigen rechteckigen Felderung ist ein großformatiges Hauptbild getreten, eine Kreuzigungsgruppe, die acht Bildmedaillons flankieren. Analogien zwischen Altem und Neuem Testament fehlen. Entsprechend klein ist das Tuch mit gerade drei Metern Kantenlänge. Es verhüllt nur den Altaraufbau, nicht den Chorraum und den liturgischen Vollzug. An die Stelle des ausschweifenden didaktischen Bilderzyklus ist hier ein stimmungsvolles Andachtsbild getreten.
Am Südrand des Zollfeldes steht die Kirche von Taggenbrunn abseits der Fernstraße in ruhigerer Umgebung. Eine bäuerlich geprägte Buckellandschaft präsentiert sich von ihrer besten Seite: Der Kirchhügel steigt fast unmittelbar aus dem Längsee empor, der für eine Uferverbauung mit Spekulationsobjekten wohl einfach zu klein und zu unspektakulär ist. Am Ufer liegt ein mittelalterliches Benediktinerinnenkloster, oder vielmehr was Türken und Klosteraufhebung davon übrig ließen. Der weiße Riegel der Seetaler Alpen markiert am Horizont im Nordosten die Grenze zur Steiermark, im Süden stehen die schroffen Karawanken auf der Grenze zu Italien und Slowenien. Zum Dorf gehören so wenig Häuser, dass ein fremdes Auto Aufsehen erregt. Alte Frauen machen auf dem Friedhof in der warmen Nachmittagssonne die Familiengräber für das Osterfest zurecht und schauen sich dabei neugierig um. Ein Junge kommt schon mit dem Schlüssel der Kirche gerannt, noch ehe wir überhaupt feststellen können, dass sie verschlossen ist. Die drei Fastentücher sind gefällige Arbeiten des 18. Jahrhunderts. Man könnte sie als etwas langweilig abtun, aber wir zeigen höflich Interesse.
Ein paar Kilometer noch folgen wir der Gurk flussabwärts. Der Bergkegel zur Rechten ist steil wie der Zuckerhut. Ihm wurde im 16. Jahrhundert die Burg Hochosterwitz übergestülpt. In einer bizarren Doppelspirale, die wie eine manieristische Skulptur verdreht ist, schraubt sich der Burgweg mit vierzehn Torbauten bergan. Für Angreifer wäre es ein blutiger Kreuzweg geworden, der nicht zufällig ebenso viele Stationen hat. Selbst die Türken zogen daran vorbei. Trotzdem war beim Bau nicht nur militärisches Zweckdenken im Spiel. Hochosterwitz ist mehr pittoresk als militant und erinnert von fern an Pieter Bruegels Bild des Turmbaus zu Babel.
Wir verzichten auf einen Besuch, um in Haimburg ein ganz bedeutendes Fastentuch anzuschauen, das älteste nächst dem von Gurk. Die Ortschaft schmiegt sich in einen breiten Talboden, die schöne spätgotische Kirche steht abseits. Sie ist mit einem jener kernigen Steinplattendächer gedeckt, wie sie früher in der Gegend üblich waren. Die rüde Betonhalle gegenüber wirkt dagegen bereits baufällig. Der Kaufladen darin ist von einer Atmosphäre, die man so im sozialistischen Jugoslawien erlebte. Sonnengegerbte Männer stehen an der Wursttheke und prosten uns mit Aprikosenschnaps zu. Ihrer freundlichen Einladung auf ein Gläschen entgehen wir nur mit geduldiger Diplomatie. Mitleid erregende Geschöpfe, die morgens um neun Uhr Hochprozentiges nicht vertragen, kannten sie bislang nur vom Hörensagen.. Verschämt ziehen wir uns in die Pfarrkirche zurück. Der festliche Innenraum erscheint wie aus einem Guss. Der Fastenbehang entstand, so die Inschrift, „nach christ gepurt 1504 iar“. In 36 Bildfelder ist das Leinen unterteilt, jedes Feld 70 Zentimeter hoch und wenig breiter. Aufbau und Gliederung sind so klar, dass die Einzelszenen noch vom Gemeinderaum aus deutlich abzulesen sind. Die Geschlossenheit der Komposition macht das Tuch zu einem herausragenden Kunstwerk. Geschickt werden über die Bildreihen Bewegung und Dramatik von links nach rechts gesteigert; die durchgehende Landschaft schafft eine gemeinsame Raumbühne.
An der Ortschaft St. Paul scheint die Zeit vorübergegangen zu sein. Die Abtei, die ihr den Namen lieh, beherrscht sie wie ein kleiner Escorial. Offene zweigeschossige Arkadengänge vor der Kirchenfassade geben dem Platz etwas Heiteres. Die Mönche führen ein Gymnasium; das sorgt für frischen Wind im Kloster. Die romanische Basilika hält auch gleich eine Überraschung bereit. Ein riesiges weißes Leintuch fällt vom Gewölbe der Vierung zum Boden hinab und riegelt den Blick vor dem Chor ab. Davor schwebt das moderne Kruzifix des Kärntner Künstlers Johanes Zechner. Die Form ähnelt mittelalterlichen Kreuzen Italiens, aber Christus ist nur über Zitate aus der Schrift präsent. Durch die romanischen Rundbogenfenster strömt Licht schräg ein. Es wandert im Tageslauf über das gewellte, grobe Leinen, inszeniert darauf immer neue Sichtweisen und verändert die Atmosphäre im Raum.
Anders liegen die Dinge im ehemaligen Dom von Maria Saal. Das ist die älteste bestehende Kirche Kärntens; im 8. Jahrhundert ging von der hoch gelegenen Gottesburg die Missionierung des Landes aus. Das Innere der gotischen Kirche lebt vom Kontrast zwischen einer dunklen, gedrungenen Halle und dem hellen, schlanken Chor. Zur Verhüllung des barocken Hochaltars hat der Künstler Karl Wolschner ein großes Fastentuch mit dem überlebensgroßen Haupt Christ geschaffen. Die dominierenden Brauntöne beziehen sich auf die Fassung des Altars; die Komposition fügt sich seiner Bewegung ein. Alles ist so gewaltig und so bewegt, dass die Kunst vor dem Kitsch kapitulieren muss.
In der Umgebung von Maria Saal findet seit Jahrhunderten am zweiten Freitag nach Ostern ein merkwürdiges christlich-heidnisches Spektakel statt, das Vierbergelauf heißt. Binnen vierundzwanzig Stunden rennen die Teilnehmer der Prozession für ihr Seelenheil vier tausend Meter hohe Berge hinauf und hinunter, dem Lauf der Sonnen hinterher, insgesamt etwa fünfzig Kilometer weit. Einer der vier heiligen Berge ist seit Jahrzehnten noch das Ziel einer etwas anderen Wallfahrt. Dubiose Veteranenverbände aus allen möglichen Ländern, Frontkämpfer und Angehörige der Waffen-SS, auch schlagende Burschenschaften - ultrarechte bis rechtsextreme Gruppierungen nach Einschätzung des Verfassungsschutzes - treffen sich auf dem Ulrichsberg alljährlich zum alkoholisierten Tschingterassabum. Zwar schauten österreichische Landes- und Bundespolitiker schon immer gern vorbei, aber internationale Beachtung fand das Mekka der Neonazis spätestens, als dort Jörg Haider die Waffen-SS und Adolf Hitler hochleben ließ.
Unberührt von schwarzbraunen Umtrieben ist der Sternberg bei Villach, der ebenfalls eine Wallfahrtskirche trägt. Der unbefestigte Weg endet oben vor dem Wallfahrer-Wirtshaus. Die Kirche liegt frei auf einem Felsplateau, umrahmt vom Friedhof. Hier geht der Blick hinüber zu den Karawanken. St. Georg auf dem Sternberg gehört zu den schönsten ländlichen Ensembles des Landes. Alles wirkt bäuerlich, aber nicht naiv und kitschig. Der Innenraum glänzt in schlichter Feierlichkeit. Zwischen Kirchenschiff und Chorraum ist das Fastentuch so exakt in den Durchgang eingepasst wie eine abschließende Bilderwand. Als einziges Tuch bewahrt es so den ursprünglichen Charakter der fastenzeitlichen Inszenierung. Obwohl 1629 ausgeführt, breitete der Maler Jacob Katzner auf der derben Leinwand in vierundzwanzig Szenen noch einmal den ganzen erzählerischen Reichtum mittelalterlicher Bilderzyklen aus.
Am Karsamstag werden die Fastentücher wieder eingerollt. Im Dom von Gurk geschieht das am späten Nachmittag nach der zeremoniellen Fleischweihe. Früher war die Niederlegung des Tuches mit einem herzzerreißenden Spektakel verbunden, in Erinnerung an das Erdbeben und das Zerreißen des Tempelvorhangs in Jerusalem beim Tod Christi. Heute verschwindet das Fastentuch sang- und klanglos im Depot.