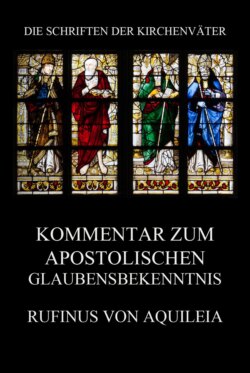Читать книгу Kommentar zum apostolischen Glaubensbekenntnis - Rufinus von Aquileia - Страница 5
Einleitung: Rufin’s Leben und Schriften. 1
ОглавлениеTyrannius (Toranus) Rufinus von Aquileja verdankt seine Berühmtheit in der christlichen Literaturgeschichte zum großen Theile seiner Übersetzungsthätigkeit aus dem Gebiete der griech. kirchl. Literatur, wie seinen bekannten Zerwürfnissen mit dem hl. Hieronymus. Er ward nicht, wie vielfach fälschlich angenommen worden ist, zu Aquileja selbst, sondern in der benachbarten kleinen italischen Stadt Julia Concordia um das Jahr 346 geboren. Obgleich frühzeitig in der christlichen Religion unterrichtet, verschob er doch, einem in seiner Zeit häufigen Zuge folgend, den Empfang der hl. Taufe in die spätern Jünglingsjahre. Die schönen Wissenschaften und die Rhetorik bildeten das Lieblingsstudium Rufin’s und führten ihn nach dem reichen, blühenden Aquileja, dem ,„zweiten Rom“ der damaligen Welt. Nachdem er hier seinen wissenschaftlichen Durst an den Quellen der profanen Literatur hinlänglich gestillt, ergriff ihn das Verlangen, auch die Wissenschaft der Heiligen kennen zu lernen. So zog er sich, etwa 25 Jahre alt, in ein uns näher nicht bekanntes aquilejensisches Kloster zurück, woselbst er von der Hand des hl. Chromatius unter Assistenz des Archidiakon Euseb und des Diakon Jovin die hl. Taufe empfing. Die hl. Schrift und die Werke der Kirchenväter lateinischer und griechischer Zunge bildeten nun den Gegenstand der wissenschaftlichen Studien Rufin’s in seiner klösterlichen Zurückgezogenheit. Die Griechen las er, bis jetzt allein der lateinischen Sprache mächtig, vorab noch in lateinischen Versionen. Um diese Zeit geschah es, daß der hl. Hieronymus auf seiner Rückkehr von Rom Concordia berührte, woselbst er über Rufin, seine Studien und seine Fortschritte in christlicher Tugend und Wissenschaft Kunde erhielt. Der Heilige entschloß sich, den vielversprechenden jungen Mann in Aquileja aufzusuchen. Nach einem mehrtägigen Zusammenleben in demselben Kloster schieden die Beiden unter dem Versprechen einer ewigen Freundschaft. Hieronymus ging zu wissenschaftlichen Zwecken nach Gallien, um dann nach Aquileja zurückzukehren und dort im Verein mit Rufin seine Tage in ungestörter, ruhiger Thätigkeit zu verleben. Kostbare Manuscripte, die Hieronymus auf der Reise in seinen Besitz brachte, waren die gemeinschaftliche Freude der beiden Freunde. Den Rufin interessirten vornehmlich die Werke des hl. Hilarius, die ihm der Freund auf seinen Wunsch in Trier zum Theile abgeschrieben hatte.
Das Zusammenleben der beiden Freunde zu Aquileja sollte jedoch nicht lange dauern: unvorhergesehene, uns näher nicht bekannte Umstände veranlaßten den Hieronymus, Ende 372 oder Anfangs 373 in den Orient zu reisen. Untröstlich über die Trennung beschloß Rufin im folgenden Jahre seinen Freund im Orient aufzusuchen und landete Frühjahr 374 in Ägypten. Lehrreich und fesselnd waren für ihn die Einblicke, die ihm in das Leben und Thun der Einsiedler der Wüste zu werfen verstattet war: er sah den damals 75 jährigen hl. Makarius von Alexandrien, und ein gemeinsames Interesse an den Vorträgen des blinden Didymus, der als das Orakel seines Jahrhunderts verehrt wurde, führte ihn demnächst zu einem innigen Verhältniß mit der hl. Melania der Ältern, die, eine aufrichtige Bewunderin seiner Tugend, dem Rufin ihr Vertrauen schenkte und durch einen Zeitraum von 30 Jahren unverändert bewahrte.
Hier in Ägypten war es, wo Rufin eine glänzende Probe seiner Festigkeit im Glauben ablegen und den Ruhm eines Bekenners sich begründen sollte. Die Arianer hatten sich damals nach dem Tode des hl. Athanasius des bischöflichen Stuhles von Alexandrien unter den Auspicien des Kaisers Valens bemächtigt und wütheten gegen die Vertreter des omoousioj. (xxx) Auch Rufin ward ein Opfer dieser Verfolgung: er verkostete Kerker und Mißhandlung. Die Wiedererlangung seiner Freiheit verdankte er der edlen Melania, die ihr Vermögen ganz zur Unterstützung vertriebener Bischöfe und verfolgter Bekenner der Gottheit Christi verwendete. Mit Melania und andern Verfolgten ging dann Rufin nach Palästina, woselbst eine höchst schmeichelhafte Ankündigung des Hieronymus in einem Briefe an einen gewissen Horatius in Jerusalem ihm die ehrenvollste Aufnahme sicherte. Erst gegen 377 jedoch kamen Rufin und Melania nach Jerusalem; die Letztere gründete hier ein Frauenkloster, dem sie 27 Jahre vorstand, der Erstere machte sich um die Errichtung eines Männerklosters am Ölberge verdient, dem er in kurzer Zeit eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern zuführte. Die zu Grunde gelegte Regel war wahrscheinlich die des hl. Basilius. Mit der priesterlichen Weihe ausgerüstet entfaltete sodann Rufin eine eifrige und erfolgreiche Thätigkeit in der Seelsorge, die namentlich auch durch zahlreiche Conversionen von Anhängern des antiochenischen Schisma’s wie der macedonianischen und arianischen Häresie gekrönt wurde. Auch wandte sich jetzt Rufin, der den fünfjährigen Aufenthalt in Ägypten zum Studium der griechischen Sprache benutzt hatte, der Übersetzung griechischer Werke in’s Lateinische zu. Den Anfang machte er mit den Alterthümern und dem jüdischen Krieg des Flavius Josephus. Inzwischen bot sich dem hl. Hieronymus Anlaß, seinen längst gehegten Plan eines Besuchs der hl. Stätte auszuführen. 2 Bei seinem Aufenthalte in Jerusalem hatte er die Freude, nach langer Trennung den Rufin wieder zu sehen. Von Dieses wie der Melania Tugend und gesegneter Thätigkeit war er so entzückt, daß er in seinem zu Konstantinopel, wohin er sich bald darauf begab, verfaßten Chronikon ad a. 378 seiner Bewunderung beredten Ausdruck lieh. Rufin unterbrach seinen klösterlichen Aufenthalt am Ölberge durch verschiedene Reisen in eigenem oder kirchlichem Interesse. Wir wissen von ihm selbst, daß er unter Anderm Mesopotamien besuchte, wie auch daß er in Alexandrien seine alten Lehrer, vornehmlich den blinden Didymus, wieder sah und consultirte. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß gerade dieser alexandrinische Aufenthalt ihm die Anregung zur Fortsetzung seiner Übersetzungen griechischer Schriftsteller bot. In dieser Thätigkeit bereitete er sich durch so fleissige und umfassende Studien vor, daß Hieronymus sich zu dem Geständniß veranlaßt sah, daß nur Wenige den Rufin an Kenntniß der alten Autoren, namentlich der Griechen übertreffen dürften. Eine der ersten Übersetzungen, die derselbe demnächst in Angriff nahm, waren die Sprüche des Pythagoräers Sixtus, die er, durch ihren trefflichen moralischen Inhalt verleitet, irrthümlich dem gleichnamigen Papst und Märtyrer zuschrieb. Auch übersetzte er die Werke des Evagrius von Pontus. In dieselbe Zeit fällt wohl auch der Anfang des Rufin’schen Briefwechsels mit einer vornehmen römischen Wittwe Proba, der für uns verloren ist. Gennadius, der diese Briefe in Händen hatte, rühmt sie wegen der Reinheit des Stiles und der Vortrefflichkeit ihres Inhaltes.
Unterdessen hatte Hieronymus, nachdem er 382 Constantinopel verlassen, drei Jahre in Rom an der Seite des Papstes Damasus verweilt, dessen unbegrenztes Vertrauen er besaß, und dem er in allen wichtigen Dingen ein hochangesehener Rathgeber war. Gegen Ende 384 aber starb Papst Damasus, und so stand Hieronymus, der neben den rasch vorübergehenden Anfeindungen wegen seiner neuen biblischen Textesgestaltung besonders heftige Nachstellungen aus Anlaß seiner schonungslosen Rüge des damaligen römischen Klerus zu erdulden hatte, in Rom nahezu ganz isolirt. Da entschloß er sich denn, für immer in den Orient zurückzukehren. Nach einem längern Aufenthalte in Alexandrien, wo ihn Didymus fesselte, und nach einem Besuche bei den Mönchen der nitrischen Wüste 385 kam er wieder in’s hl. Land. Zu seiner bleibenden Wohnstätte wählte er aber nicht das Kloster des Rufin zu Jerusalem, sondern Bethlehem, die Stätte, wo die Krippe des Herrn gestanden. Mit Rufin aber blieb er in der innigsten Freundschaft verbunden, die besonders durch das gemeinsame wissenschaftliche Interesse getragen wurde. Der Eine suchte den Andern im Eifer des Studiums der hl. Schrift und der kirchlichen Autoren zu überbieten. Rufin warf sich jetzt vor Allem auf die Werke des Origenes und nahm zunächst die exegetischen Schriften dieses großen, von ihm so sehr bewunderten Autors, zum Pentateuch, den Büchern Josue, Richter, Könige, den Psalmen und dem hohen Lied in Angriff.
Mehr als 25 Jahre bereits hatte Rufin und Hieronymus das Band innigster Freundschaft umschlungen, als ein unvorhergesehenes Ereigniß die ersten Samenkörner eines feindlichen Zerwürfnisses zwischen die Freunde streute, das nach und nach wachsend sie zeitlebens trennen sollte. Ein gewisser Aterbius, vielleicht aus der Schaar der anthropomorphistischen Mönche, kam nach Jerusalem und erlaubte es sich beim öffentlichen Gottesdienste vor versammelter Gemeinde den Bischof Johannes von Jerusalem, wie auch den Hieronymus und Rufin laut und unumwunden als Anhänger der origenistischen Häresieen anzuklagen und dieselben zur öffentlichen Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses zu provociren. Während nun Hieronymus es für opportun erachtete, der Aufforderung des Aterbius am nächstfolgenden Sonntage nachzukommen und seinerseits die Irrthümer des Origenes öffentlich in der Kirche zu verdammen, waren der Bischof Johannes und Rufin anderer Ansicht und rechneten die Condescendenz des Hieronymus der unbefugten Aufforderung des Aterbius gegenüber Jenem als eine unwürdige Schwäche an. Es war Dieß im Jahre 392, und von diesem Zeitpunkte an trat eine gewisse Kälte in dem frühern Freundschaftsverhältniß zwischen Hieronymus und Rufin ein, von der uns die in demselben Jahre erschienene Schrift des Hieronymus de viris illustribus deutliche Spuren zeigt. Hätte Hieronymus diese seine literarhistorische Arbeit früher verfaßt, so würde ohne Zweifel Rufin unter den kirchlichen Autoren eine ehrenvolle Stelle und eine rühmliche Kritik in derselben erhalten haben: nun ward er ganz und gar ignorirt. Noch immer aber war das Zerwürfniß nicht bis zum Grade vollständiger und feindseliger Trennung gestiegen; vielmehr sollte das Jahr 394 noch ein Mal eine förmliche Aussöhnung herbeiführen. Um diese Zeit kam der hl. Epiphanius nach Jerusalem und predigte in Gegenwart des Bischofs Johannes und des Rufin gegen Origenes; dazu kam noch, daß er den Bruder des Hieronymus, Paulinian, unbefugt zum Priester weihte. In dem zwischen den beiden Bischöfen durch diese Vorgänge entstehenden Streite stand Hieronymus zu Epiphanius, während Rufin die Partei des Johannes vertrat. Hier war es die hl. Melania, welche die letzte friedliche Ausgleichung zwischen den alten Freunden vermittelte. Zum Zeichen der Versöhnung reichten sich Rufin und Hieronymus in der Grabeskirche von Jerusalem die Hand und besiegelten die neue Vereinigung durch Darbringung des hl. Opfers.
Das Jahr 397 gab dem Rufin Behufs Begleitung der hl. Melania Veranlassung nach Italien zu gehen. In Rom lernte er einen gewissen Makarius kennen, einen Mann, der von größerem Interesse für die kirchliche Literatur erfüllt war, als ihm seine persönliche Bildung dieselbe zu fördern oder auch nur zu beherrschen verstattete. In verschiedenen Schwierigkeiten wandte er sich an Rufin, der ihn seinerseits auf die Apologie des Origenes von Pamphilus verwies. Makarius, des Griechischen unkundig, ersuchte den Rufin um eine lateinische Übersetzung dieses Werkes, ein Wunsch, dem Letzterer nach einigem Widerstreben entsprach. Diese Übersetzung begleitete Rufin mit einem Briefe und einer Vorrede an Makarius, worin er einestheils constatirt, daß die Werke des Origenes vielfachen Fälschungen durch die Häretiker ausgesetzt gewesen seien, anderntheils die in ihrem Zielpunkt leicht kennbare Vermuthung ausspricht, es möge wohl die Übersetzung eines dem Origenes günstigen Werkes gewissen Personen ungelegen kommen. Selbstverständlich machte die Übersetzung der Apologie Aufsehen. Makarius jedoch ließ sich nicht abhalten, den Rufin weiterhin zu bestimmen, auch die Übersetzung des Hauptwerkes des Origenes, (xxx), in Angriff zu nehmen. Zu Ostern 398 konnten die beiden ersten Bücher dieser immerhin delikaten Arbeit bereits erscheinen. In der an Makarius adressirten Vorrede unterläßt Rufin es nicht, an die früher von Hieronymus selbst gefertigten Übersetzungen aus den Werken des Origenes und das überaus günstige Urtheil zu erinnern, welches Dieser über den großen Mann gefällt. Im Übrigen gibt Rufin selbst zu verstehen, daß er bei der Übersetzung des Periarchon mit ziemlicher Willkür verfuhr, indem er Einzelnes wegließ, Anderes modificirte. Nach Vollendung seiner Übersetzung zog sich Rufin nach Aquileja zurück, im Besitze eines Briefes des hl. Papstes Siricius, der seine volle kirchliche Gemeinschaft constatirte. Unterdeß war Hieronymus auf das Werk Rufin’s aufmerksam gemacht und von befreundeter Seite in den Besitz desselben gesetzt worden. Da Papst Siricius bereits am 26. November des Jahres 398 gestorben war, so ward die Sache von Seite des Hieronymus und seines Freundes an den mittlerweile auf den Stuhl Petri erhobenen Papst Anastasius gebracht. Dieser nun lud den Übersetzer des Origenes in verschiedenen Briefen zur persönlichen Verantwortung nach Rom: Rufin jedoch entschuldigte sich durch Hinweis auf Familienverhältnisse und Überanstrengung von seinen Reisen; er hielt es für ausreichend, zu erklären, daß sein Glaube niemals ein anderer gewesen, als wie er zu Rom und Jerusalem und allweg in der katholischen Kirche gepredigt werde. Seinem Briefe fügte er eine besondere professio fidei bei, von welcher er erwartet, daß durch dieselbe seine Gegner zur Ruhe gebracht würden; „sei doch dieser sein Glaube persönlich erprobt durch Exil, Gefängniß und Dasjenige, was er zu Alexandrien für den Namen Jesu erduldet.“ In der professio fidei verbreitet sich Rufin in durchaus rechtgläubigem Sinne über Trinität, Incarnation, Auferstehung des Fleisches, Gericht, Ewigkeit der Höllenstrafen, Ursprung der Seele. Was den Origenes betrifft, so erklärt er, weder sein Vertheidiger noch sein Approbator, sondern lediglich sein Übersetzer zu sein. Finde sich in seiner Übersetzung etwas Gutes, so sei Dieß nicht ihm zuzumessen; finde sich Schlechtes, so sei Dieß gleicher Weise nicht auf seine Rechnung zu schreiben.
Diese Erklärungen indeß befriedigten weder den Hieronymus noch den Papst Anastasius: Ersterer erklärte die Rechtfertigung Rufin’s für zweideutig und gekünstelt, Letzterer verurtheilte in einem an den Bischof Johannes von Jerusalem gerichteten Briefe vom Jahre 401 den Rufin zwar nicht geradezu und officiell, spricht sich indeß durchaus zu seinen Ungunsten aus und legt seinen Unmuth über denselben offen an den Tag. Rufin selbst erhielt von diesem Briefe spät erst Kunde, als ihm Hieronymus denselben zum Beweise vorhielt, daß er in Rom gegen ihn gewonnen habe. Rufin, der sonst mit dem Bischof Johannes in intimer Correspondenz stand, durfte sich so zu der Vermuthung veranlaßt sehen, der Brief selbst sei eine Fälschung. Um jedoch endgiltig den vereinigten Anstrengungen der Gegner, ihn zum Häretiker zu stempeln, zu begegnen, glaubte es nunmehr Rufin seiner Ehre und seinem Gewissen schuldig zu sein, sich öffentlich in einer besondern Schrift zu rechtfertigen. Er verfaßte diese in 2 Büchern, die er Apologie betitelte, und die hernach mit dem Namen „Invectiven“ benannt worden sind. Er widmete diese Schrift seinem Freunde Apronianus, der ihm den gegen seine Person und alle Origenisten gerichteten Brief des Hieronymus an Pammachius überschickt hatte. 3 Diese Schrift gibt Zeugniß von der tiefen Indignation, die den Rufin aus Anlaß seiner Verdächtigungen erfüllte, und ist nicht ohne Schärfe und Bitterkeit gegen Hieronymus abgefaßt. Rufin appellirt an die großen Männer, denen er seine Unterweisung im Glauben und seine Aufnahme in die Kirche verdankt, einen Chromatius, Jovin und Eusebius, an deren rechtem Glauben unveränderlich festzuhalten er sich bewußt ist. In sarkastisch-ironischer Weise rechtfertigt er sich im Besondern über seine Auffassung des Auferstehungsdogma und beruft sich bezüglich seines Verhältnisses zu Origenes auf die eigenen Übersetzungen des Hieronymus aus den Werken dieses Schriftstellers und die unverhohlenen Lobsprüche, die Hieronymus selbst ehedem dem Origenes habe angedeihen lassen. Die frühere Beziehung des Hieronymus zu Origenes erscheint dem Rufin eine solche, „daß Beide mit einander entweder freigesprochen, oder aber verdammt werden müßten.“ Kaum war die Rufin’sche Apologie in Rom bekannt geworden, als sich die Freunde des Hieronymus sofort beeilten, Diesem davon Kenntniß zu geben; sein Bruder Paulinian überbrachte ihm selbst längere Auszüge aus derselben. Unverweilt griff Hieronymus zur Feder, um der Rufin’schen Apologie eine eigene entgegenzustellen, welcher er noch eine besondere Schrift beifügte, in der er die professio fidei Rufin’s an den Papst Anastasius angriff. Schon bald bot sich dem Rufin die Gelegenheit, von der Apologie des Hieronymus Einsicht zu nehmen; sie veranlaßte ihn zunächst in einem längeren Briefe, der uns verloren gegangen, und dessen Inhalt wir nur aus der Antwort des Hieronymus 4 kennen, aus Besorgniß vor fernerm Ärgerniß privatim dem frühern Freunde sein Herz zu öffnen und seine innerste Meinung über dessen ganzes Verhalten zu offenbaren. Hieronymus konnte sich gleicher Weise nicht dazu entschließen, den Weg der Öffentlichkeit zu vermeiden: er verfaßte zu den beiden Büchern seiner Apologie ein drittes, welches jedoch wesentlich nur den Inhalt der beiden ersten reproducirt. In der irrigen Meinung, von Rufin in der afrikanischen Kirche verschrieen zu sein, schickte Hieronymus dieses Buch an den hl. Augustin, dessen herrliche versöhnende Antwort uns so recht den Maßstab einer richtigen Beurtheilung der von dem großen Manne aufs Tiefste bedauerten Fehde zwischen Hieronymus und Rufin an die Hand gibt. 5 Sei es, daß dieser Brief wirklich den beabsichtigten Eindruck auf das Gemüth des Hieronymus nicht verfehlte, sei es. daß Dieser aus eigenem Dafürhalten zu dem deßfallsigen Entschuß gelangte, für die Folge ergriff Hieronymus nie wieder die Feder gegen Rufin.
Letzterer hatte inzwischen zu Aquileja auf Wunsch des hl. Chromatius an einer Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius gearbeitet und dieses Werk in weniger als zwei Jahren vollendet. Das 9. und 10. Buch hatte er in verkürzter Gestalt reproduzirt und zu einem Buche vereinigt. Dazu gestattete er sich im 7. und 9. Buche Zusätze über die Wunder des Gregorius Thaumaturgus resp. über den Martyrer Lucian und im 6. und 7. Buche eine eigene Kapitelordnung. Dem Euseb fügte er als selbstständige Composition ein 10. und 11. Buch bei, worin er die Kirchengeschichte vom 20. J. Constantin’s des Großen bis zum Tode Theodosius I. (395) fortführte. Noch war Rufin mit diesen Arbeiten beschäftigt, als die Nachricht von dem gegen Ende April des Jahres 402 erfolgten Tode des Papstes Anastasius in Aquileja eintraf. Rufin entschloß sich nun um so eher, die Stadt wieder zu besuchen, in welcher seine Gegner die Meinung ausgestreut, er scheue sich überhaupt dorthin zu kommen, als auch die ältere Melania dort anwesend war. Um diese Zeit trat Rufin auch in Correspondenz mit dem hl. Paulin von Nola, dessen Einladung zu seinem Bischofssitze er entsprach, und auf dessen Wunsch er einen Commentar des Segens Jakob’s an Juda und demnächst auch des an die übrigen Söhne gerichteten verfaßte. Jm Jahre 410, einige Zeit vor der Belagerung der Stadt, hatten Melania, ihre Nichte Marcella und deren Gemahl Pinian Rom verlassen. Rufin begleitete dieselben nach Sizilien. Rom war unterdeß gefallen und die Stadt Rhegium von den Horden Alarichs verbrannt. Im Angesichte dieser Verwüstungen und in der Trennung von seiner Heimath suchte Rufin Trost in der ihm so lieb gewordenen wissenschaftlichen Thätigkeit: er sammelte die Scholien und Homilien des Origenes zum Buch Numeri, um sie in einen Band zu vereinigen und zu 6 übersetzen. Noch in demselben Jahre 410 jedoch ereilte ihn in Sizilien der Tod.
Hieronymus hat es nicht unterlassen, in seiner Vorrede zum Propheten Ezechiel seine Kenntnißnahme vom Tode Rufin’s in bittern Worten zu vermerken; andere kirchliche Schriftsteller, auch desselben Jahrhunderts, haben dem Rufin ein besseres Denkmal gesetzt: Palladius, Cassianus, Gennadius, Sidonius, P. Gelasius und Paulin von Nola 7 sind des unbedingten Preises voll und gehen, wie wohl Hieronymus im Tadel, so vielleicht im Lobe über die Grenze des thatsächlich Begründeten hinaus. Gegen die Verdächtigung des Rufin als Häretiker hat später vor Allem Kardinal Noris in seiner pelagianischeu Geschichte Protest erhoben.
Der größere Theil der literarischen Arbeiten wurde bereits im Verlaufe der kurzen Darstellung seines Lebensganges namhaft gemacht. Von seinen Übersetzungen sind hier noch zu erwähnen die pseudo-clementinischen Recognitionen, wahre Reden des hl. Gregor von Nazianz und des hl. Basilius, sowie verschiedene Mönchsregeln. Ob die Schrift historia monachorum oder liber de vitis patrum, welche in 33 Kapiteln das Leben ebenso vieler heiliger Asceten der nitrischen Wüste behandelt, ebenfalls den Übersetzungswerken zuzuweisen oder als selbstständige Schrift anzusehen ist, soll hier nicht entschieden werden; jedenfalls gehört das Werk dem Rufin an und nicht, wie Einige vermuthet haben, dem Evagrius von Pontus.
Wenn die Echtheit der den Werken des Rufinus gewöhnlich beigedruckten Commentare zu den Propheten Hoseas, Joel, Amos und zu den ersten Psalmen, wie einiger anderer Schriften mit vollstem Rechte bezweifelt wird, 8 so ist von den eignen Werken Rufin’s nur eines noch zu nennen, und zwar das bedeutendste und werthvollste von allen. Es ist Sein Commentar zum apostolischen Symbolum, dessen deutsche Übersetzung unseres Wissens hier zum ersten Male versucht wird. Zu welcher Zeit seines Lebens Rufin dieses Werk geschrieben, ist uns nicht bekannt: am wahrscheinlichsten aber mag es der ruhigsten und gereiftesten Periode seines Lebens zuzuweisen sein, der Zeit, wo die Fehde mit Hieronymus schwieg, und wo ihm der ungestörte Aufenthalt in seiner Heimath Aquileja die nöthige Ruhe zu einer objectiven, von Persönlichkeiten freien Erläuterung der wichtigsten Lehren des christlichen Glaubens bot. Die Schrift ist zunächst auf den Wunsch eines uns näher nicht bekannten Bischofs Laurentius verfaßt und ward von diesem vornehmlich zur Unterweisung der Katechumenen bestimmt. Rufin wollte um so lieber der Einladung zu einem derartigen Werke entsprechen, als er dadurch die Gelegenheit einer indirekten, aber umfassenden Apologie seiner Rechtgläubigkeit fand, die seinen summarisch gehaltenen, ex professo geschriebenen Apologien wirksam zur Seite trat. Im christlichen Alterthum wurde der Rufin’sche Commentar außerordentlich hoch geschätzt, vielleicht überschätzt; daß ihm immerhin eine wesentliche Bedeutung für die Dogmengeschichte zukomme, ist auch heute noch unbezweifelt. Sollen wir diese Bedeutung hier in zwei Worten charakterisiren. so möchten wir sagen, daß der Rufin’sche Commentar am Anfang des 5. Jahrhunderts die Summe der wesentlichen Bestandtheile der dogmengeschichtlichen Entwicklung der vorhergegangenen Jahrhunderte zieht. Dazu bot eine zunächst für katechetische Zwecke verfaßte Auslegung des apostolischen Symbolums um so mehr Veranlassung, als hier flüssige Meinungen der Schulen wie subtilere Detailfragen ausgeschlossen bleiben mußten, während vor Allem der wesentliche und gesicherte Bestand des christlichen Gemeinglaubens zu berücksichtigen und festzustellen war. Ein derartiges Werk aber zu liefern befähigten den Rufin neben seiner allgemeinen Bildung die vielen Reisen und der längere Aufenthalt in den verschiedenen Hauptkirchen des Morgen- und Abendlandes, wie seine vertraute und umfassende Bekanntschaft mit der kirchlichen Literatur. Einer besondern Inhaltsübersicht unserer Schrift dürfen wir uns hier enthalten und auf die Übersetzung selbst verweisen: hält sich ja Rufin strenge an die Reihenfolge der einzelnen Artikel des Glaubensbekenntnisses, um sie nach Inhalt und Bedeutung kurz und durchgehend treffend zu würdigen. - Die besten Ausgaben des lateinischen Urtextes sind die im Anhang der Maurinerausgabe des hl. Cyprian und die von Vallarsi in der Ausgabe von Rufin’s Werken (Venet. 1745). Von großem Werthe ist Rufin’s Erklärung des Symbolums für die in neuester Zeit viel (von Hahn, Caspari, Zezschwitz u. s. w.) bearbeitete Geschichte der Glaubenssymbole überhaupt, des apostolischen insbesondere.