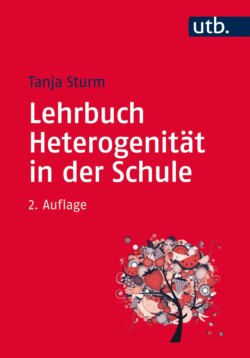Читать книгу Lehrbuch Heterogenität in der Schule - Tanja Sturm - Страница 8
Оглавление2 Differenzen in Schule und Unterricht
„Heterogenität“ ist etwa seit dem Jahr 2000 zu einem zentralen Begriff geworden, wenn es um die Beschreibung schulischer und unterrichtlicher Realität geht (Budde 2012). Dieser Abschnitt möchte in das Verständnis von Heterogenität und Homogenität respektive von Differenz und Gleichheit einführen. Ziel dieser einleitenden Überlegung ist es, eine Analysefolie bereitzustellen für pädagogische, v. a. für unterrichtliche Zusammenhänge, zu denen Bildungs-, Lern-, Erziehungs- und Sozialisationsprozesse zählen. Die aufzuführenden theoretischen Konzepte sollen dabei helfen, den Blick für Heterogenität in Schule und Unterricht zu schärfen.
Im ersten Abschnitt wird eine allgemeine Definition von Heterogenität vorgenommen. Diese Perspektive wird im darauffolgenden Abschnitt um eine sozialkonstruktivistische und wissenschaftssoziologische Perspektive, die wesentlich auf der Konzeption der „Pädagogik kollektiver Zugehörigkeiten“ Arnd-Michael Nohls (2010, 145) aufbaut, differenziert und anhand der Überlegungen zu Milieus als Felder im sozialen Raum erweitert.
2.1 Heterogenität in der Schule – eine Definition
Heterogenität hat sich etwa seit der Jahrtausendwende zu einem zentralen Bezugs- und Erklärungspunkt in (schul-)pädagogischen Zusammenhängen entwickelt (Budde 2012; Schroeder 2007, 33). In diesem Abschnitt soll Heterogenität als Beschreibungsansatz im schulischen und unterrichtlichen Kontext in allgemeiner Hinsicht erklärt werden. Die Definition orientiert sich an einem sozial-konstruktivistischen Verständnis und unterscheidet sich folglich von Perspektiven, die aus anderen theoretischen Positionen heraus Heterogenität definieren. So verweist diese Definition, im Gegensatz zu kognitionspsychologischen Überlegungen darauf, dass Differenzen nicht aufgrund von Dispositionen bestehen, die sich in verschiedenen Merkmalen verdichten, sondern in sozialen Interaktionen hergestellt und bearbeitet werden (Trautmann / Wischer 2011, 42 f).
Sozial-konstruktivistische Überlegungen definieren Heterogenität mehrheitlich, z. T. auch mithilfe anderer Begriffe, anhand der folgenden vier Punkte: relativ, sozial-kulturell eingebunden, sozial konstruiert und partial (Lang et al. 2010, 315 f; Prengel 2006, 30 ff; Wenning 2007). Sie werden nachfolgend für die Definition herangezogen. Die Kriterien werden hier zwar analytisch voneinander getrennt, sind jedoch aufeinander bezogen und erlangen im Zusammenspiel einen definitorischen Charakter.
relativ
„Heterogenität“ kommt aus dem Griechischen, bedeutet übersetzt „Ungleichartigkeit“ und bezeichnet somit Unterschiede oder Differenzen. Diese können dann erkannt und beschrieben werden, wenn mindestens zwei Aspekte oder Eigenschaften miteinander in Beziehung gesetzt, also verglichen werden. Dies erfolgt mithilfe eines Maßstabs, der an die zu vergleichenden Aspekte angelegt wird und so ihre Relation zueinander beschreibbar macht. Das Ergebnis dieses Vergleiches lautet dann gleich oder ungleich respektive homogen oder heterogen.
Eine Differenz beschreibt also die Relation von mindestens zwei zueinander in Beziehung gesetzten Eigenschaften oder von anderen verglichenen Aspekten. Das Resultat des Vergleiches ist eine Relation (Lang et al. 2010, 315).
der Vergleichsmaßstab
Ein Aspekt wie die schulisch erbrachte Leistung kann folglich nicht per se heterogen sein. Erst der Vergleich konkretisiert, auf welchen Aspekt schulischer Leistung genau Bezug genommen wird und worin die Verschiedenartigkeit besteht. In der Schule wird die Relation häufig zwischen den Leistungen eines Schülers zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmt, gegenüber der Klasse oder Lerngruppe (soziale Bezugsnorm), oder gegenüber einer formalen, objektiven Bezugsnorm (Schuck 2004, 353 f). Letzteres wird in Bildungsstandards und / oder Klassenzielen festgeschrieben. Je nachdem, wie verglichen wird, kann die Relation anders ausfallen.
Der Grundschüler Paul verfügt zu Beginn des dritten Schuljahres über keinerlei Englischkenntnisse. In der dritten Klasse beginnt der Englischunterricht. Zu den Herbstferien, also etwa zwei Monate später, kann Paul einige Obstsorten und die Farben auf Englisch bezeichnen. Ein Vergleich seiner Englischkenntnisse zu den zwei Zeitpunkten zeigt, dass diese different sind.
Seine Lehrerin, Frau Ackermann, vergleicht Pauls englischsprachliche Leistungen im Herbst mit denen seiner Mitschüler / -innen – sie nimmt seine Lerngruppe als Vergleichsgruppe (soziale Bezugsnorm). Dabei erkennt sie, dass einige Schüler / -innen zwar die Obstsorten, nicht aber die Farben im Englischen benennen können; zudem stellt Frau Ackermann fest, dass es Kinder gibt, die auch die englische Bezeichnung einiger Tiere kennen. Hier werden, bezogen auf die einzelnen Schüler / -innen einer Schulklasse, heterogene Lernstände im Vergleich ersichtlich.
Ein Vergleich der Englischkenntnisse Pauls mit denen des Bildungs- und Rahmenplans für den Englischunterricht in der Grundschule kann zeigen, dass er die erwarteten Leistungen erfüllt (objektive Bezugsnorm). Seine Kompetenzen und die schuladministrativ gesetzten Erwartungen sind identisch oder homolog zueinander.
Wechselspiel von Gleichheit und Verschiedenheit
Vergleiche setzen ihrerseits Gleichheit voraus. Heterogenität und Differenzen sind nur zu bestimmen und zu erkennen, wenn Homogenität, also Gleichheit, auf einer übergeordneten Ebene vorhanden ist.
So kann die Feststellung, dass zwei Personen unterschiedliche Sprachen sprechen – Deutsch und Italienisch – nur dann erfolgen, wenn davon ausgegangen wird, dass beide sich linguistischer Symbolsysteme bedienen, um mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Diese Gemeinsamkeit gesprochener Sprachen ist die Basis des Vergleiches, mit dem festgestellt werden kann, dass es sich um unterschiedliche, also differente Sprachen handelt.
Eine Gleichheit, auf die Bezug genommen wird, ist bei der Feststellung von Heterogenität und Homogenität auf übergeordneter Ebene notwendig. Folglich kann nur Gleiches mit Gleichem verglichen werden. Eigenschaften oder Dinge, die auf abstrakterer Ebene gleich sind, können zueinander in Relation gesetzt werden, die dann als gleich / ungleich beschrieben wird. Homogenität und Heterogenität sind folglich dialektisch aufeinander bezogen und miteinander verbunden, da sich das eine nicht ohne das andere beschreiben lässt. Ein solcher vergleichsinterner und zu bestimmender Maßstab wird auch „tertium comparationis“ genannt (Prengel 2009, 141).
Im schulischen Kontext besteht Homogenität, also die Vergleichsgrundlage, zunächst darin, dass alle Kinder und Jugendlichen als Schüler / -innen gesehen werden (Wenning 2008, 6). Als solche werden sie miteinander verglichen, zueinander und / oder zu anderen Maßstäben in Relation gesetzt. Diese Form der Homogenisierung hat eine positive und eine negative Seite, die miteinander verbunden sind – wie die zwei Seiten einer Medaille: Positiv ist, dass damit für alle Schüler / -innen das Recht auf vergleichbare Teilhabe an Schule und Unterricht ermöglicht wird – im Vergleich zu einem nach sozialen Ständen differenzierten Schulwesen; negativ ist, dass die Unterschiede, anhand derer sie sich unterscheiden, ausgeblendet werden (müssen). Homogenität und Heterogenität beziehen sich in Schule und Unterricht häufig nicht auf eine absolute Gleichheit, wie im vorherigen Sprachbeispiel. Vielmehr wird Homogenität als Streuung um eine Norm verstanden, die als gleich angesehen wird (Gomolla 2009, 22). Das, was jeweils als homogen verstanden wird, unterscheidet sich je nach dem kulturellen, historischen und sozialen Kontext, in dem eine Aussage formuliert wird.
soziale und kulturelle Rahmungen
Vergleiche, deren Ergebnis Gleichheit oder Unterschiedlichkeit darstellt, finden immer in sozialen und historischen Kontexten statt. Als solche sind sie nicht neutral, sondern eingebunden in die Bedeutungen und Werte des jeweiligen Kontextes. Die Vergleiche werden aus einer Perspektive heraus vorgenommen, die durch spezifische kulturelle und soziale Bedeutungen gekennzeichnet ist, in denen die Ergebnisse mit positiverer oder negativerer Bedeutung (Wenning 2008, 6) bzw. mit Rangordnungen und Hierarchien (Prengel 2006, 34) verbunden sind. So ist in der Organisation Schule die Unterscheidung relevant, ob und wie viele Aufgaben ein Schüler / eine Schülerin in einer Klassenarbeit richtig und falsch bearbeitet hat. Dieser Vergleich wird in eine Punktzahl überführt, die anschließend in eine Zensur übersetzt wird. Irgendwo wird eine Grenze als Maßstab und Bedeutung festgelegt, die besagt, ob die Klassenarbeit bestanden wurde oder nicht. Dies ist eine Unterscheidung, die eher im sozialen Rahmen der Schule eine Bedeutung hat und insofern hierarchisch aufgeladen ist, als sie mit einer Besser- / Schlechterstellung im Schulsystem einhergeht.
Das Ergebnis eines Vergleiches ist verbunden mit Konsequenzen, die im jeweiligen Kontext daraus gezogen werden. Diese Bedeutung ist spezifisch für die Schule; andere Unterschiedlichkeiten, wie die Schuhgrößen einer Schulklasse, sind im Rahmen der Bildungsorganisation nicht relevant. Dass Merkmale, Eigenschaften oder andere Aspekte miteinander verglichen werden, steht in einer Wechselbeziehung zu den Bedeutungen und Werten innerhalb des sozialen Zusammenhangs und der spezifischen Interessen, die in dem kulturellen und sozialen Rahmen bestehen (z. B. der Klärung, ob jemand aufgrund seiner Leistung Teil einer spezifischen Lerngruppe bleiben kann oder nicht); aus den jeweiligen Zusammenhängen gehen sie hervor und bleiben zugleich mit ihnen verbunden. Sowohl die Maßstäbe, die herangezogen werden, um Differenzen zu erkennen und zu beschreiben, als auch die Wertung der Ergebnisse unterscheiden sich in kultureller, sozialer und auch in historischer Hinsicht, und sie sind nicht statisch, sondern wandelbar.
sozial konstruiert
Aus kontinuierlich vorgenommenen und in einem sozialen Zusammenhang relevanten Vergleichen heraus können sich feste Begriffe oder Kategorien entwickeln, die zur Beschreibung herangezogen werden. Diese Verdichtungen werden auf sprachlicher Ebene durch Begriffe und Wörter repräsentiert. Auf nonverbaler Ebene stellen Symbole kultureller Repräsentationen solche Verdichtungen dar (Nohl 2010, 146 f).
So stellt die Beschreibung Geschlecht, die in der Regel zwischen männlich und weiblich unterscheidet, eine begriffliche Verdichtung für Unterschiede bzw. kontinuierlich vorgenommene Vergleiche dar. In unserer derzeitigen Gesellschaft sind mit dieser Unterscheidung diverse kulturelle Repräsentationen verbunden, wie beispielsweise Kleidung und Frisuren.
In gesellschaftlichen und somit auch in schulischen Zusammenhängen haben Differenzen zugleich eine distinktive Funktion (sie dienen der Abgrenzung gegenüber anderem und anderen) und eine konjunktive, auf Gemeinsamkeiten bezogene Bedeutung (siehe Kapitel 2.2).
Heterogenität und Homogenität sind Konstruktionen, die perspektivisch gebunden hergestellt und wahrgenommen werden, da sie immer von einem Standpunkt aus, d. h. vor dem Hintergrund individueller Erfahrungen vorgenommen werden (Seitz 2008, 228). Als solche wirken sie zugleich distinktiv, also abgrenzend, da Differenzen und Unterschiede durch sie sichtbar werden, und konjunktiv, also Gemeinsamkeit stiftend, die durch sie erkennbar wird. Abgrenzungen gegenüber anderem und Zugehörigkeit zu Eigenem bzw. zu Gleichem sind zwei Seiten von Differenzkonstruktionen.
Differenzen werden aus einer konkreten sozialen Position heraus gesehen, in der die zu erkennende Unterscheidung bedeutsam ist. In dieser Bedeutungszuschreibung wird zugleich die Differenz, da sie als relevant genutzt wird, reaktualisiert und damit auch reproduziert. Dies kommt in den Praktiken, die auf die Unterscheidung folgen und auf sie aufbauen, auch zum Ausdruck.
Dies erfolgt z. B. in der Art und Weise, wie auf jemanden zugegangen wird: So werden Kinder von Erwachsenen anders adressiert als dies Erwachsene untereinander tun. Die Differenz, die zwischen den Generationen besteht, wird also in einem Gespräch zwischen den Generationen produziert und reproduziert.
Die sozialen Prozesse der Produktion und Reproduktion von Differenzen sind nicht abgeschlossen, sondern fester Bestandteil jeder menschlichen Interaktion (West / Fenstermaker 1995, 9).
Heterogenität ist partial
Heterogenität, die als sozial konstruiert verstanden wird, ist immer auf einzelne Aspekte bezogen, auf konkrete Differenzen. Im schulisch-unterrichtlichen Kontext wird der Terminus „heterogen“ häufig auf eine Lerngruppe bezogen; gemeint sind jedoch einzelne Aspekte, anhand derer eine konkrete Gruppe als different beschrieben wird (Klafki / Stöcker 1976, 497). Identifizierte Heterogenität oder auch Homogenität besteht für einen konkreten Zeitpunkt, da die Unterschiede zwischen den Vergleichsobjekten jederzeit veränderbar sind. So führt Lernen dazu, dass die Diskrepanz zwischen etwas nicht Gekonntem zugunsten von Können überwunden werden kann. Die Feststellung, ob etwas heterogen und homogen ist, ist die zeitlich begrenzte Beschreibung eines Zustandes, dessen Ergebnis sich durch Entwicklung verändern kann (Wenning 2007, 23). Differenzen in schulischen Leistungen stellen folglich keine stabilen Merkmale dar. Sie sind veränderbar, wie das Beispiel über die Englischkompetenzen des Schülers Paul oben zeigt. So kann sich durch Lernen die Relation zwischen Verglichenem verändern.
2.2 Heterogenität von Milieus
Im Anschluss an diese allgemeine und begriffliche Definition von Heterogenität soll sie, anknüpfend an die Ausführungen der „Pädagogik kollektiver Zugehörigkeiten“ von Arnd-Michael Nohl (2010) konkretisiert und durch Ausführungen zum sozialen Raum der Gesellschaft von Bourdieu (1987, 2009) erweitert werden. Arnd-Michael Nohl hat seine Ausführungen an die Überlegungen zur praxeologischen Wissenssoziologie von Karl Mannheim (1980) und Ralf Bohnsack (2010) aufgebaut.
Heterogenität und Homogenität werden in dieser theoretischen Position mithilfe des Milieubegriffs erklärt. Zunächst soll jedoch der Grundbegriff der Perspektivität von Milieus (siehe Kapitel 2.2.1) besprochen werden. Dann werden Bourdieus (1992) Überlegungen zum relationalen Zusammenhang von Milieu und sozialem Feld im sozialen Raum der Gesellschaft beschrieben (siehe Kapitel 2.2.2) und anschließend die besondere Situation von Milieus in Organisationen vorgestellt.
2.2.1 Zugehörigkeit zu Milieus
zwei Wissensformen
Um Differenzen aus der Perspektive der praxeologischen Wissenssoziologie heraus zu betrachten, ist es notwendig, zwischen zwei unterschiedlichen Wissensformen zu unterscheiden: der kommunikativ-generalisierten und der konjunktiven bzw. handlungspraktischen. Kommunikativ-generalisiertes Wissen steht v. a. sprachlich auf wörtlich-begrifflicher Ebene zur Verfügung und ist milieuübergreifend zugänglich (Nohl 2010, 149 f). Seine Verwendung setzt eine Distanz gegenüber den umschriebenen Gegenständen und Sachverhalten sowie Abstraktheit voraus. So wissen andere, wenn wir den Begriff „Buch“ verwenden, dass wir uns auf ein Bündel gebundener Blätter beziehen, die mit Schrift und / oder Bildern bedruckt sind.
Das handlungspraktische Wissen beschreibt hingegen Erfahrungswissen, das einzelne durch die Beziehung zu anderen Personen und / oder zu Gegenständen gemacht haben; so beispielsweise die Kindheitserfahrung, aus Büchern vorgelesen zu bekommen. In der je konkreten Situation wird die Erfahrung der Beziehung, gemeinsam eine Geschichte zu verfolgen, einer „Kontagion“ (Mannheim 1980, 208), gemacht – einer existenziellen Bezogenheit auf den Gegenstand „Buch“, der diese bereithält. Derartige Erfahrungen, die Mannheim als „konjunktive“ Erfahrungen (Mannheim 1980, 215) bezeichnet (einander existenziell verbindende Erfahrungen), stehen nicht notwendigerweise begrifflich reflexiv zur Verfügung. Sie machen jedoch einen wesentlichen Teil menschlichen Wissens aus und sind zugleich orientierende Grundlage für Praktiken und Handlungen, in die sie einfließen.
Definition:
Das handlungspraktische Erfahrungswissen ist jenes, das in der Auseinandersetzung mit der sozialen und materialen Welt gesammelt wird. Aus dieser Erfahrung ergibt sich ein praktisches Verhältnis der Menschen zur Welt, das vorbegrifflich zur Verfügung steht. Dieses Praxiswissen steht nicht unmittelbar reflexiv zur Verfügung (Mannheim 1980, 205 ff). Das in eigener Handlungspraxis erworbene Erfahrungswissen wird in Handlungssituationen reaktualisiert.
Folglich fungiert es als „Praxissinn“ (Bourdieu 1998, 41, Herv. im Original), also aus selbst erfahrener Handlungspraxis heraus wird die Praxis generiert.
Praxis
Dass Menschen über unterschiedliche Erfahrungen verfügen, zeigt sich in ihren je verschiedenen alltäglichen Praktiken. Die Gestaltung des Alltags umfasst jegliche Bereiche menschlichen Lebens, u. a. sich ernähren, sich kleiden, einer Arbeit nachgehen, die Freizeit gestalten. Für und in den unterschiedlichen Bereichen haben Menschen Praktiken entwickelt, die sie zwar nicht notwendigerweise explizit beschreiben können, die jedoch handlungsleitend sind. Diese Orientierung erfolgt auf der Erfahrungsgrundlage entlang des inkorporierten Wissens, das den Praktiken zugrunde liegt und in konkreten Erlebniszusammenhängen generiert wurde (Bohnsack 2010, 43). Innerhalb pluraler Gesellschaften finden sich unterschiedliche Formen der Lebenspraxis, die als „Milieus“ (Nohl 2010, 148) bezeichnet werden.
Definition:
Milieus stellen Kulturen der praktischen Lebensführung und der Alltagsgestaltung dar, die auf der Grundlage kollektiver Erfahrungen basieren (Nohl 2010, 145).
Verstehen
Milieus stellen gelebte Praxis innerhalb kollektiver Zugehörigkeiten dar, welche die Angehörigen durch Einbindung in vergleichbare, homologe, soziale Lebenszusammenhänge erwerben. Diese strukturidentischen Erfahrungen fungieren als eine Art Brille, durch die der Alltag betrachtet und Partizipation daran eröffnet wird. Die milieubezogenen Erfahrungen, die „kollektiven Erlebnisschichtungen“ (Bohnsack 2010, 63), müssen nicht in konkreten, gemeinsamen Erlebnissen gemacht werden, sondern lediglich gleichartig sein. Die Erfahrungen verbinden die Angehörigen eines Milieus miteinander, sie stellen die „Konjunktion“, eine Verbindung, zwischen ihnen her und dar. Das geteilte Erfahrungs- und Orientierungswissen wird auch als „konjunktives“, also verbindendes Erfahrungswissen bezeichnet. Es ermöglicht den Angehörigen eines Milieus, sich untereinander unmittelbar zu verstehen (Mannheim 1980, 217 ff).
Erfahrungen zwischen den Angehörigen unterschiedlicher generationeller Milieus, beispielsweise in Bezug auf die Nutzung von und den selbstverständlichen Zugang zu digitalen Medien, können sich unterscheiden. Die generationelle Differenz kann sprachlich zum Ausdruck kommen, in der Nutzung von Fachtermini und/oder handlungspraktisch, wie die Medien im Alltag genutzt und herangezogen werden.
Die Erfahrungen erlauben es den Angehörigen eines Milieus, in vergleichbarer Weise materiale und soziale Gegenstände bzw. Zusammenhänge zu betrachten und so auf sie in ihrem Alltag Bezug zu nehmen, da sie in gemeinsamen oder vergleichbaren Erlebnissen gewonnen wurden. Die Zusammenhänge müssen nicht weiter expliziert werden, sie werden verstanden, da sie in ihrer Existenz verstanden werden, die innerhalb des konjunktiven Erfahrungsraums besteht. Die Zugehörigkeit zu Milieus kann zwar reflexiv zugänglich sein, ist es jedoch im Alltag üblicherweise nicht (Bohnsack 2010, 63).
In diese Praxen werden Menschen hineingeboren und einsozialisiert. Milieus sind entsprechend der Individualität der / des Einzelnen vorgeordnet, da sich Individualität nur innerhalb von Milieus entfalten kann. Das konjunktive Wissen, über das ein Milieu zur Bearbeitung des Lebensalltags verfügt, wird v. a. in mimetischer Hinsicht sowie durch Beobachten und Aushandeln erlernt und zur Bearbeitung der eigenen Lebenspraxis herangezogen. Dabei determiniert ein Milieu die Handlungen und Praxen einzelner Personen nicht derart, dass konkrete Handlungen vorgegeben sind. Vielmehr eröffnen Milieus Optionen und Variationen. Die individuellen Spielräume ergeben sich auch durch und für die Zugehörigkeit von Menschen zu mehreren Milieus, die sich in je spezifischer Art überlagern (Nohl 2010, 149). Nohl (2013, 55) nennt die „gesellschaftlich etablierten Dimensionen von Heterogenität“ (Nohl 2013, 55), zu denen beispielsweise Geschlecht und die sozial-ökonomische Situation zählen. Dass entsprechende Milieuerfahrungen mit unterschiedlichen Handlungspraktiken einhergehen, konnte empirisch-rekonstruktiv nachgewiesen werden (z. B. Bohnsack et al. 1995; Schittenhelm 2005). Von diesen zu unterscheiden sind Milieus, die noch im Entstehen sind und/oder die noch nicht rekonstruiert wurden (Nohl 2013, 60).
Mehrdimensionalität von Milieus
Die Mehrdimensionalität von Milieus ergibt sich aus der Überlappung unterschiedlicher Erfahrungsdimensionen, wie beispielsweise der geschlechtlichen Erfahrungsdimension mit der des sozio-kulturellen Milieus.
Folglich ist nicht von einem eindimensionalen – und totalen – Verständnis von Milieu auszugehen, vielmehr überlagern sich Milieudimensionen. Die unterschiedlichen Erfahrungen, aus denen sich das handlungsleitende Wissen einzelner speist, können in Konflikt oder Widerspruch miteinander stehen. In diesen Konflikten liegt das Potenzial für bildende Entwicklung und Neugestaltung von Milieus. Die Überlappung der Milieus in einer konkreten Person führen ebenso zur Individualität respektive zu einem individuellen oder persönlichen Habitus wie die unterschiedlichen Lösungs- und Bearbeitungsformen des Alltags, die Milieus aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und Mehrdimensionalität inhärent sind (Nohl 2010, 166).
Milieus sind weder einheitlich noch statisch, sondern vielfältig, dynamisch und damit wandelbar. Unterschiedliche Erfahrungen überlagern sich, sodass verschiedene Erfahrungsdimensionen zusammenkommen. Einen Menschen auf die Zugehörigkeit zu nur einem Milieu zu reduzieren, wäre eine Verkürzung seiner Realität (Nohl 2010, 174). Derartige Reduktionen auf eine Milieuzugehörigkeit werden häufig praktiziert. Auch Forschung und Wissenschaft sind hiervon nicht frei.
Die Mehrdimensionalität von Milieus eröffnet eine Perspektive der Betrachtung von Differenzen, die über eindimensionale Zuschreibungen hinausgeht. Dennoch finden in der Gesellschaft häufig eindimensionale Betrachtungen und Zuschreibungen statt, bis hin zu einer kategorialen Verfestigung, wie sie z. B. in „die Männer“ zum Ausdruck kommt. Dass dieser einseitige Blick auf Heterogenitätsdimensionen häufig eingenommen wird, lässt sich mithilfe der „Übersetzung“ konjunktiven Erfahrungswissens in kommunikativ generalisiertes Wissen erklären (Nohl 2010, 168 f), die häufig dann und dort erfolgt, wenn die Angehörigen unterschiedlicher Milieus sich einander erklären.
Konjunktion und Distinktion
Es bestehen Differenzen zwischen unterschiedlichen und innerhalb erfahrungsbezogener Milieus. Sie fußen auf den verschiedenartigen Erfahrungen, die Menschen machen, und bieten Zugehörigkeit zu einer Lebenspraxis, also zu Konjunktionen, die es erlauben, den komplexen Alltag zu bewältigen. In den Konjunktionen sind zugleich Distinktionen enthalten, da Zugehörigkeit zu einem Milieu immer auf Abgrenzung gegenüber anderen Milieus verweist (Nohl 2010, 147).
überkonjunktiver Zusammenhang
Der wissenssoziologischen Perspektive folgend, besteht neben dem Praxiswissen, den konjunktiven Erfahrungen und ihren Gehalten, die nur innerhalb des Milieus verständlich sind, also in der existenziellen Gemeinschaft, in der sie generiert wurden (Nohl 2010, 149), wörtlich-begriffliches und nonverbales, symbolisches Wissen über die soziale wie materiale Welt und somit auch über die Milieus selbst. Anders als konjunktives Erfahrungswissen, das auf unmittelbarem Verstehen (Bohnsack 2010, 55 ff) basiert, ist das kommunikativ-generalisierte auf Interpretationen angewiesen. Dort, wo über die Grenzen von Milieus und geteilten konjunktiven Erfahrungen hinweg kommuniziert wird, wird kommunikatives Verstehen notwendig. Die Verständigung ist darauf angewiesen, dass milieugebundene Selbstverständlichkeiten überkonjunktiv expliziert werden. Um die Bedeutung von etwas zu erklären, ist es erforderlich, konkrete Erfahrungen in abstrakte Sprachlichkeit zu übersetzen. Hierfür bedarf es der Kommunikation auf explizit-begrifflicher Ebene, die auf Abstraktionen von der milieugebundenen Perspektive angewiesen ist (Nohl 2010, 150).
kulturelle Repräsentationen
Neben verbalen Formen liegt dieses auf der Ebene kultureller Repräsentationen vor (Nohl 2010, 145 ff). Sie korrespondieren mit kommunikativ-generalisierten Bedeutungen, sind in sprachlicher und in symbolischer sowie nonverbaler Hinsicht vorhanden. Wörter und Begriffe der sprachlichen Ebene finden als explizite Äußerungen ihr Äquivalent auf nonverbaler symbolischer Ebene in materialer und sozialer Hinsicht. Sie bestehen aus Selbst- und Fremdzuschreibungen der Zugehörigkeit zu kulturellen Gruppen. Die Kleidung stellt eine solche kulturelle Repräsentation dar, die uns Hinweise z. B. auf das Geschlecht einer Person gibt.
Zuschreibungsprozesse finden überwiegend auf der Grundlage kultureller Repräsentationen statt, die aufgrund der Eindeutigkeit, mit der sie von allen erkannt werden können und sollen zugleich von der Vielfalt abstrahieren, die in Milieus anzutreffen ist (Nohl 2010, 147 f). Dabei wird die Vielfalt der milieuspezifischen Repräsentation häufig verdichtet und es werden eindimensionale Reduktionen vorgenommen, die sich in stereotypisierenden Zuschreibungen zuspitzen können. Durch die Reaktualisierung der eigenen kollektiven Zugehörigkeit, durch Abgrenzungen und Distinktionen in der Beschreibung verstärkten sich diese (Nohl 2010, 168 f).
Sozialisation
Zugehörigkeit zu Milieus: Milieus bestehen durch die und in den Lebenspraxen ihrer Angehörigen. Die Aktualisierung und Weitergabe milieuspezifischen Wissens an die nächste Generation, mittels Sozialisation, erfolgt durch die Reaktualisierung in Alltagspraktiken. Sozialisation verläuft dabei nicht linear; Milieus sind weder statisch noch eindimensional, sondern dynamisch und mehrdimensional, da mehrere Differenzdimensionen in ihnen aufgehen (Nohl 2010, 177). Folglich sind keine homogenen Milieus denkbar, in die Kinder und Jugendliche einsozialisiert werden. Die frühe familiäre und außerfamiliäre Sozialisation beschreibt jenen Prozess, in dem implizites Wissen eines Milieus an die jüngere Generation weitergegeben wird; ohne dass Sozialisation je als abgeschlossener Prozess verstanden werden kann, da eine kontinuierliche, erfahrungsbezogene Differenzierung im Laufe des Lebens stattfindet. Im Vergleich zu Erziehung ist Sozialisation, die in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen wie Familie, Kita und Schule vollzogen wird, nicht bzw. nur selten intentional (Marotzki et al. 2006, 138 ff).
schwach heterogene Milieus
Mehrdimensionalität findet sich auch in sogenannten „schwach heterogenen Milieus“ ebenso wie in „stark heterogenen“. Zu schwach heterogenen Milieus gehören in der aktuellen Gesellschaft jene, die lediglich in Bezug auf die Generation und – je nachdem – das Geschlecht verschiedenartig sind (Nohl 2010, 180). Für die Bewältigung einer generationsbezogenen Weitergabe handlungspraktischen Wissens, wie in der Adoleszenz, stellen die schwach heterogenen Milieus Vorbilder und Modelle bereit, an denen sich die Kinder bzw. Jugendlichen orientieren können. Milieus, die auf diese Weise tradiert werden, zeichnen sich durch biografische Dauerhaftigkeit und Kontinuität aus, auf die sich ihre Mitglieder beziehen können (Nohl 2010, 158; 179).
stark heterogene Milieus
Liegen keine derartigen Orientierungsmodelle und Vorbilder handlungspraktischen Wissens vor bzw. sind diese nicht mit den gesellschaftlichen Erwartungen zu vereinbaren, vor die die nachwachsende Generation gestellt ist, spricht man von „stark heterogenen Milieus“. Diese verweisen darauf, dass zwischen Erwachsenen und Kindern mehr als geschlechts- und ggf. generationsspezifische Unterschiede bestehen. Dies kann beispielsweise durch die Erfahrung von Migration oder durch gesamtgesellschaftliche Umbrüche, wie dem „Fall der Berliner Mauer“ bedingt sein. Solche Ereignisse, die biografische Brüche oder Diskontinuitäten für die Betroffenen darstellen, können (so sie von mehreren Personen erfahren werden) die Entwicklung neuer Milieus eröffnen. Deren Genese findet dort statt, wo die ältere Generation praktisch anwendbare Vorbilder der Lebensbewältigung nicht an ihre Kinder weitergeben kann und die nachwachsende Generation individuelle Handlungsweisen hervorbringt (Nohl 2010, 180 ff).
Aus der Erfahrung heraus, keine Rollenvorbilder oder Modelle zu haben, werden neue Orientierungen entwickelt, um den Alltag zu bewältigen. In diesen neuen Formen werden die differenten Erfahrungen, die unterschiedlichen Sphären (wie beispielsweise die der Familie und die der Schule), aufeinander bezogen und so ihre Bewältigung vorgenommen. Dies gelingt zunächst durch eine Trennung der Sphären und den in ihnen enthaltenen Erwartungen an die Akteurinnen und Akteure. Die Abgrenzung eröffnet zum einen Handlungsfähigkeit und ermöglicht zum anderen die Entwicklung eigener neuer Bearbeitungsformen (Nohl 2010, 158). Neben den durchaus schwierigen Herausforderungen, welche die Gestaltung und Etablierung neuer Milieus für die davon betroffenen Menschen mit sich bringen, eröffnen sich zugleich Räume und Möglichkeiten für Kreativität und Entwicklung (Nohl 2010, 180 ff).
Der Fall der Berliner Mauer stellt ein Beispiel hierfür dar: Die ehemaligen DDR-Bürger / -innen sind in einem politischen und gesellschaftlichen System sozialisiert worden, vor dessen Hintergrund sie Praktiken zur Bewältigung des Alltags entwickelt haben. Zu DDR-Zeiten bestehende Selbstverständlichkeiten, entlang derer der Alltag organisiert wurde, unterschieden sich jedoch von denen der BRD. Die damalige Kinder- und heutige Erwachsenengeneration erhielt nicht in vergleichbarem Maße Modelle und Vorbilder, wie der Alltag praktisch bewältigt werden kann, wie ihre Peers aus der ehemaligen Bundesrepublik.
Die Gesellschaft ist an sich heterogen und besteht aus mehrdimensionalen Milieus (Nohl 2010, 160). Die Differenzierung der Gesellschaft in Milieus steht auch in Relation zu den unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zu gesellschaftlichen Gütern.
2.2.2 Milieus im sozialen Raum
Milieus und Habitus
Die ausgeführten Überlegungen der praxeologischen Wissenssoziologie zum Milieu werden mit den theoretischen Ausführungen Bourdieus (1982; 1998) zum Habitus verknüpft. Bourdieus empirische Annäherung an diesen (1982; 1998) erfolgt wesentlich über Kapitalien und ihre Zusammensetzung, die Akteurinnen und Akteuren zur Bewältigung ihres Lebensalltags zur Verfügung stehen. Kapitalkonfigurationen unterschiedlicher Milieus betrachtet er in Relation zueinander und anhand der Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die darin enthalten sind.
Gemeinsam ist den theoretischen Positionen, dass sie davon ausgehen, dass die soziale Situation oder Lage von Menschen sich in ihren Handlungen und Orientierungen niederschlägt. Dies zeigt sich, davon wird ebenfalls in beiden Ansätzen ausgegangen, auch in der praktischen Seite des Handelns. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, mit Hilfe der Ansätze die Dichotomie zwischen Mikro- und Makroebene zu überwinden. Ergebnisse und Resultate, die makroanalytisch betrachtet werden, wie z. B. die unterschiedliche Teilhabe von Schüler / -innen mit / ohne Migrationshintergrund an schulischen Bildungsgängen, finden sich in unterrichtlichen Interaktionen, also Praktiken und Diskursen der Mikroebene wieder.
Die Verknüpfung beider theoretischer Perspektiven soll es ermöglichen, die Bedeutung der sozio-ökonomisch unterschiedlichen Lebensbedingungen, die Bourdieu fokussiert und denen innerhalb der erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Forschung eine entscheidende Bedeutung im Zusammenhang mit (schulischem) Bildungserfolg zugeschrieben wird, in die bisherigen Überlegungen zu integrieren.
Die Bedingungen für die Gestaltung von Lebenspraxen unterscheiden sich und entwickeln zugleich eigene Dynamiken. Das, was Nohl (2007, 66) als „konjunktives Erfahrungswissen“ eines Milieus definiert, zeigt Parallelen zu Bourdieus Habituskonzept, insbesondere dem Praxissinn, der zwischen Feld und Habitus vermittelt. Dieser praktische Sinn, der Habitus, erlaubt es Menschen, in ihrem Alltag auf spezifische Art und Weise handlungsfähig zu sein (Bourdieu 2009, 139 ff).
Die entwickelte Praxis eines Milieus sieht Bourdieu (1982) in engem Zusammenhang mit den Kapitalien, die den Menschen – zur Bewältigung ihres Alltags – zur Verfügung stehen. Mithin eröffnet und verschließt (immer in Relation zu anderen Gesellschaftsmitgliedern respektive Milieus gedacht) die Verfügung über Kapitalien Möglichkeiten der Lebensführung und Gestaltung.
Der Habitus fungiert somit als Muster, mit dem die Welt betrachtet wird und in dem gleichzeitig Praktiken begründet werden, ohne jedoch konkrete Handlungsschritte vorzuschreiben. Vielmehr werden Handlungsmöglichkeiten und -optionen eröffnet (Bourdieu 1987, 100 ff). Die Ausprägung des Habitus ist eng an die Lebensbedingungen gebunden, die Bourdieu anhand des Kapitals, das zur Verfügung steht, beschreibt.
Definition:
Kapital meint akkumulierte Arbeit, die in materieller oder immaterieller – also in verinnerlichter (oder inkorporierter) – Hinsicht vorliegt (Bourdieu 1992, 49).
Kapital
Menschen investieren Arbeit und Zeit, um Kapitalien zu erwerben, dies gilt gleichermaßen für objektivierte wie für inkorporierte Formen. Der Besitz von viel Kapital eröffnet mehr Zugangsmöglichkeiten zu gesellschaftlich begehrten Positionen und Lebensstilen, als dies bei wenig Kapital der Fall ist. Unterschiedliche Kapitalien, also Ressourcen (ökonomischer, kultureller, sozialer und symbolischer Art), die sich durch ein spezifisches Verhältnis zueinander auszeichnen, sind gesamtgesellschaftlich vorhanden. Sie können gegeneinander getauscht werden, dadurch stehen sie in Relation und Abhängigkeit zu- und voneinander. Die je zur Verfügung stehenden Kapitalien und ihre Zusammensetzung eröffnen und / oder begrenzen den Erwerb spezifischer Werte, Vorstellungen und Lebenspraxen. Diese Optionen führen zu Erfahrungen, die ihrerseits ein Milieu ausmachen (Bourdieu 1992, 49 ff).
inkorporiertes kulturelles Kapital
Kulturelles Kapital: Kulturelles Kapital kann in drei unterschiedlichen Formen vorliegen: inkorporiert, objektiviert und institutionalisiert. Inkorporiertes kulturelles Kapital ist körpergebunden, d. h. der Lernaufwand, der zu seiner Aneignung notwendig ist, muss von dem / der Träger / in selbst geleistet werden. Die Investition von Zeit in ein Studium und / oder in die Schulbildung setzt formal voraus, dass Personen sich lernend auseinandersetzen; dabei handelt es sich um eine Zeit, in der kein Geld verdient oder Freizeit genossen werden kann und die finanziert werden muss, da sie eben nicht für Arbeit aufgewendet werden kann (Bourdieu 1992, 55 ff).
objektiviertes Kulturkapital
Materielle Träger wie Bücher, Gemälde und Musikinstrumente stellen das objektivierte Kulturkapital dar. Neben dem rein materiellen und ökonomischen Wert wohnt ihnen eine kulturelle Bedeutung inne, die nur dann erschlossen werden kann, wenn inkorporiertes Kulturkapital vorliegt, wie z. B. ein Instrument spielen zu können; oder der Einsatz eines technischen Hilfsmittels, wie eines Computers, und geht über den „reinen Besitz“ hinaus (Bourdieu 1992, 59 ff).
institutionalisiertes Kulturkapital
Wie das inkorporierte ist auch das institutionalisierte Kulturkapital an den Träger / die Trägerin gebunden. Hierzu zählen Bildungszertifikate und akademische Titel. Dieses Kulturkapital unterscheidet sich von (ausschließlich) inkorporiertem Wissen dadurch, dass es in der Regel einfacher umzutauschen und rechtsgültig anerkannt ist. So kann ein Zertifikat wie der „Master of Education“ genutzt / getauscht werden, um zunächst einen Referendariats- und später einen Arbeitsplatz als Lehrer oder Lehrerin an einer Schule zu erhalten. Somit eröffnet sich die Option, durch Tausch ökonomisches Kapital zu erwerben. Inhalte, die sich Menschen autodidaktisch angeeignet haben, lassen sich nicht auf vergleichbare Weise transferieren (Bourdieu 1992, 61 ff).
soziale Netzwerke
Soziales Kapital: Diese Kapitalform bezeichnet soziale Netzwerke zwischen Menschen. Sie können genutzt werden, um materielle und / oder immaterielle Tauschbeziehungen vorzunehmen. Derartiger Austausch setzt die gegenseitige Anerkennung der Akteurinnen und Akteure eines Netzwerks voraus, das institutionalisiert vorliegen kann und / oder aus dem subjektiven Gefühl der Verpflichtung heraus besteht. Zum sozialen Kapital zählen neben Freundschaften auch die Familie oder eine Parteizugehörigkeit.
Die Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken basiert auf gegenseitigem Anerkennen und eröffnet die Möglichkeit, im Sinne einer Kreditwürdigkeit, auf das Kapital des gesamten Netzwerks zugreifen zu können. Um diese Potenziale nutzen zu können, ist Beziehungsarbeit in Form von Zeit und / oder Geld aufzuwenden. Die Beziehungspflege bedarf Zeit und / oder Geld und schafft Solidarität zwischen den Netzwerkmitgliedern, die in Form von gegenseitigen Einladungen, von Geschenken oder durch anderweitige Gegenleistungen praktiziert werden kann. So kann Nachhilfeunterricht für das Kind einer Freundin mit einer Essenseinladung oder mit dem Gießen der Blumen während des Urlaubs getauscht werden. Der Tausch ist auf Gegenseitigkeit angewiesen, insbesondere dann und dort, wo keine familiären Beziehungen und Verantwortungen zwischen den Akteurinnen und Akteure bestehen.
Soziales Kapital kann in institutionalisierter Form vorliegen (wie die Zugehörigkeit zu einer Partei, einem Verein oder auch einer Arbeitsstelle) und aus dem Gefühl subjektiver Verpflichtungen heraus entstehen (Bourdieu 1992, 63 ff).
materielle Güter
Ökonomisches Kapital: Zu ökonomischem Kapital zählen neben Geld all jene Gegenstände und materiellen Güter, die jemand besitzt, wie Immobilien, Kunstwerke, Aktien u. v. m. In Marktwirtschaften können diese unkompliziert mithilfe von Geld getauscht und / oder in Geld verwandelt werden. Die Umwandlung zwischen den unterschiedlichen Kapitalsorten macht einen wesentlichen Bestandteil menschlichen Zusammenlebens aus. Hierbei nimmt das ökonomische Kapital eine Art Schlüsselstellung ein, da mit seiner Hilfe andere Kapitalsorten verhältnismäßig leicht erworben werden können; oder es kann für notwendige Transformationsprozesse eingesetzt werden (Bourdieu 1992, 52).
Mirkos Eltern verfügen über eine vergleichsweise große Menge ökonomischen Kapitals. Als seine schulischen Leistungen immer schlechter werden, finanzieren sie ihrem Sohn Nachhilfeunterricht. Eine Nachhilfelehrerin soll Mirko helfen, die schulisch von ihm erwarteten Ziele zu erreichen, damit er in die nächste Klassenstufe versetzt wird. Mirkos Eltern sind selbst Lehrer von Beruf und verfügen über das kulturelle Kapital, ihn selbst beim schulischen Lernen zu unterstützen. Sie haben sich aber entschieden, Mirko eine Nachhilfelehrerin zu finanzieren, da sie selbst wenig (Frei-)Zeit zur Verfügung haben; und diese wenige Zeit wollen sie lieber Tennis spielend mit ihren Kindern verbringen.
Stefans schulische Leistungen sind vergleichbar mit denen Mirkos. Seine Familie verfügt jedoch weder über das ökonomische noch über das kulturelle Kapital wie Mirkos Familie. Stefans Mutter bittet ihre Schwester, ihren Sohn bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Im Gegenzug möchte sie für die Schwester Hausarbeit erledigen. Stefans Mutter greift auf soziales, familiäres Kapital zurück und bietet zugleich eine Tauschleistung an.
Anerkennung
Symbolisches Kapital: Die vierte Kapitalform, das symbolische Kapital, unterscheidet sich von den drei anderen dadurch, dass sie ihnen innewohnt. Symbolisches Kapital stellt die wahrgenommenen und anerkannten Eigenschaften der drei anderen Kapitalsorten dar. Erst durch das symbolische Kapital erhalten die anderen Kapitalsorten ihren Wert, ihre Anerkennung. Die Allgemeine Hochschulreife, das Abitur, der Realschul- und / oder Hauptschulabschluss sind anerkannte Bildungsabschlüsse. Zugleich entstehen durch das symbolische Kapital Relativierungen und Unterscheidungen. So ist der Hauptschulabschluss zwar ein anerkannter Bildungsabschluss, er verfügt im Vergleich zur Hochschulreife über weniger Prestige und eröffnet ihr gegenüber einen eingeschränkteren Spielraum für weitere Bildungswegentscheidungen (Bourdieu 1998, 108 f).
Es ist festzuhalten, dass die jeweils zur Verfügung stehenden Kapitalien in Art und Umfang den Habitus von Menschen prägen, d. h. ihre „Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata“ (Bourdieu 1978, 101), mit denen sie die materielle Welt und das soziale Miteinander betrachten und bewerten und die gleichzeitig ihre Handlungen in dieser materiellen Welt strukturieren. Die praktischen Lebensvollzüge von Milieus stehen in ihrer Genese mit diesen Rahmenbedingungen in Zusammenhang.
Soziale Felder und Feld der Macht: Soziale Felder stellen Räume dar, die sich aus einem Netz relativ zueinander stehender Positionen aufspannen und in Relation zu deren Kapitalvolumen stehen. Hierfür wird auf das kulturelle und das ökonomische Kapital Bezug genommen. Dies lässt sich in einem zweiachsigen Raum abbilden (siehe Abbildung 1).
Abb. 1: Struktur des sozialen Raums (nach Bourdieu 1998, 19)
Struktur des sozialen Raums
Die vertikale Achse beschreibt das Gesamtvolumen an kulturellem und ökonomischem Kapital einer Gesellschaft und die horizontale die Struktur des Kapitals. Letztgenannte verweist auf die Relation von ökonomischem zu kulturellem Kapital über die jemand (respektive ein Milieu) verfügt. Innerhalb des sozialen Raums, der die Gesellschaft beschreibt, können unterschiedliche Positionen als unterschiedliche Milieus – im Sinne der Annahmen der praxeologischen Wissenssoziologie – gefasst werden. Milieus, die insgesamt über viel Kapital verfügen, sind beispielsweise Hochschullehrkräfte und Unternehmer / -innen. Die zwei Gruppen unterscheiden sich jedoch in der Zusammensetzung, der Struktur des Kapitals: Während erstgenannte über mehr kulturelles als ökonomisches Kapital verfügen, ist dies bei der zweitgenannten Gruppe andersherum. Hilfsarbeitende und Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind, verfügen im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen über wenig ökonomisches und / oder kulturelles Kapital (Bourdieu 1998, 16 ff).
soziale Felder
In differenzierten Gesellschaften gibt es innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Raums zahlreiche Felder, wie z. B. die Schule als Bildungsorganisation, die über relative Freiheiten bzw. Autonomien verfügen und zugleich in relationaler Weise mit den anderen Feldern verbunden sowie in das gesellschaftliche Feld der Macht eingebunden sind (Bourdieu 1998). Das Schul- und Bildungssystem kann als ein solches Feld verstanden werden. Bourdieu (1993) vergleicht Felder mit Spielfeldern, in denen Spielende entlang je feldspezifischer Regeln um einen oder mehrere Gegenstände, Werte oder Güter sowie um deren Definitionsmacht kämpfen. Die Spielenden verfügen über unterschiedliche Ressourcen – Kapitalien – die sie im Spiel zum Einsatz bringen (können), um ihre jeweilige Position im Feld gegenüber den anderen Spieler / -innen zu erhalten bzw. zu verbessern.
Positionen im Feld
Bourdieu (1993) verbindet die Möglichkeit, sich an dem Spiel zu beteiligen mit dem jeweiligen Kapitalbesitz.
Soziales Feld als Spielfeld
Innerhalb der Spielmetapher bleibend, lassen sich die Kapitalsorten mit Jetons in einem Roulettespiel vergleichen: Für die Beteiligung am Spiel, das die Vermehrung von Kapital – und damit verbundene Annehmlichkeiten im Leben – verfolgt, ist das Ziel, möglichst viele und unterschiedliche Jetons zu erhalten (Bourdieu 1993, 110 ff). Je weniger Kapital ein Mensch im Vergleich zu anderen besitzt, umso weniger kann er an dem Spiel teilnehmen bzw. für ihn ist dann das Risiko des Spieleinsatzes erheblich höher als für jemanden, der über viele Kapitalien verfügt. Menschen, denen viel Kapital zur Verfügung steht, sind es beispielsweise gewohnt, auswählen zu können. So können sich reiche Menschen (also jene, die über viel Kapital verfügen) überlegen, was sie gerne essen oder wie sie sich gerne kleiden möchten. Der Preis stellt für sie kein Auswahlkriterium dar. Verfügen Menschen hingegen über wenig ökonomisches Kapital, so schränkt der Preis von Lebensmitteln und Kleidung auch deren Auswahl ein.
Kinder und Jugendliche, die in ein Milieu einsozialisiert werden, in dem allein der Geschmack und nicht der Preis entscheidend sind, lernen, quasi nebenbei und unter der Bedingung ihrer Lebenssituation, Entscheidungen zu treffen. Menschen, die nicht über vergleichbares Kapital verfügen, müssen z. B. jene Lebensmittel kaufen, die am preisgünstigsten sind, das Gleiche gilt für die Kleidung. Diese Menschen handeln aus der Notwendigkeit heraus. Neben den unterschiedlichen Stilen im Auftreten, die sich so herausbilden, ist das Milieu jener Personen, die über viel ökonomisches Kapital verfügen, von der Erfahrung geprägt, auswählen zu können, ohne durch das Kapitalvolumen (einer oder mehrerer Kapitalien) eingeschränkt zu werden. Diese Erfahrung wird – wie es häufig im offenen Unterricht zu beobachten ist – von der Schule bzw. den Lehrpersonen erwartet.
Charakteristisch für Felder sind mindestens zwei unterschiedliche und miteinander konkurrierende Positionen um die Herrschaft bzw. Definitionsmacht im Feld. Diese werden als „orthodox“ und „häretisch“ oder als „konservativ“ und „subversiv“ bezeichnet (Bourdieu 1993, 110 f). Gemeinsam ist den unterschiedlichen Positionen die Anerkennung des Spielgegenstandes, d. h. die Anerkennung der Wichtigkeit einer Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt. Bourdieu nennt dies auch die „illusio“, also eine zentrale materielle oder soziale Bedeutung eines Feldes, die von allen anerkannt wird (Bourdieu 1998, 142).
Im Fall der Schule ist dies zunächst die Tatsache, dass Bildung, Erziehung und Lernen fundamentale Prozesse der Gesellschaft sind, die an die nächste Generation weitergegeben werden sollen. Wie dies in der Schule geschehen soll, welche Aspekte zu Bildung zu zählen sind, wie die pädagogische Organisation prinzipiell zu verstehen ist, kommt in unterschiedlichen Positionen des Feldes zum Ausdruck; dies kann im Feld der Erziehungswissenschaft und / oder dem der Bildungspolitik erfolgen wie auch in der Schule selbst. Die Differenz zwischen ihnen ist relational.
Felder haben eine Handlungsgeschichte; sie „lebt“ in den Strukturen und Objekten fort, die das Feld hervorgebracht hat und die Ausdruck von Auseinandersetzungen seiner Genese (Entstehung) sind. Diese Geschichte enthält die Bedeutungen vorangegangener Auseinandersetzungen (Bourdieu 1998, 56 f; 141 f).
Feld der Macht
Das gesamtgesellschaftliche Feld ist zugleich als ein Machtfeld konstituiert. Es unterscheidet sich von anderen Feldern dadurch, dass diese in ihm angesiedelt sind und es sich durch unterschiedliche Machtpositionen auszeichnet. Die symbolische Bedeutung und Macht von Kapitalsorten stellen den Gegenstand der Auseinandersetzungen dar. Der relative Wert sowie der Tauschwert von Kapitalsorten steht hier auf dem Spiel. Einfluss und Macht werden in diesem Feld durch das Verfügen über bürokratische Instanzen erlangt und ausgeweitet. Ein Beispiel hierfür ist die Häufigkeit der Vergabe von Bildungstiteln: Je seltener ein Bildungstitel vergeben wird, desto höher ist sein Wert. Wird der Bildungstitel häufiger vergeben, sinkt dieser Wert, da er nicht mehr in vergleichbarem Maße gesellschaftliche Privilegien absichert.
Das Hervorbringen und Bearbeiten sozialer Differenzen in der Schule ist ebenfalls eingebunden in Konkurrenz um Macht und Vorteile innerhalb der Gesellschaft. Für die in diesem Lehrbuch bearbeitete Thematik bedeutet dies, dass Unterscheidungen und Differenzen im Kontext hierarchischer Beziehungen konstruiert und mit Bewertungen verbunden werden (Diehm / Radtke 1999, 63).
2.3 Schule als Organisation
Milieu und Organisation: Sozialisations-, Bildungs- und Lernprozesse finden nicht allein in sozialen Milieus statt, sondern zu einem nicht unerheblichen Teil in gesellschaftlichen Organisationen wie der Schule. Die Definition von „Organisation“ erfolgt hier als Unterscheidung zum bereits bekannten Verständnis von „Milieu“. Organisationen und Milieus ist zunächst gemeinsam, dass sich in ihnen und durch sie überindividuelle Handlungsweisen entwickelt und herausgebildet haben. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Art und Weise, wie diese Regelmäßigkeiten moderiert sind bzw. zur Verfügung stehen und, damit im Zusammenhang stehend, wie die Teilhabe an ihnen funktioniert.
Modi der Teilhabe
Im vorangegangenen Abschnitt wurden Milieus als kollektive Formen der Lebenspraxis vorgestellt, denen konjunktive, homologe Erfahrungen ihrer Angehörigen zugrunde liegen. Die Angehörigen eines Milieus folgen impliziten Regeln, ohne dass ihnen diese reflexiv zugänglich sind oder sein müssen. Organisationen zeichnen sich hingegen durch explizite Regeln aus. Diese sind formal festgehalten und umfassen Verhaltenserwartungen sowie Rechte und Ressourcen, die an die Mitglieder – nicht als Einzelpersonen, sondern im Modus sozialer Rollen – formuliert werden. Mitglieder, die sich nicht an die formalen Regeln der Organisation halten, riskieren ihre Mitgliedschaft (Nohl 2007, 66 f).
In der Schule besteht eine formale Regel, wann der Unterricht beginnt. Zu dieser Zeit haben die Schüler / -innen anwesend zu sein. Missachten die Schüler / -innen diese Regel mehrfach, riskieren sie, über einen Weg von Verwarnungen und Mahnungen ihre Mitgliedschaft in der konkreten Schule. Aufgrund der Schulpflicht gilt dies zwar nicht für den Schulbesuch insgesamt, wohl aber in Bezug auf die konkrete Lerngruppe und die besuchte Schule.
Im Gegensatz zu einem Milieu, das vielschichtig und mehrdimensional aufgebaut ist, ist die Mitgliedschaft in einer Organisation distinktiv geregelt; sie liegt vor oder sie liegt nicht vor. Der Beitritt zu einer Organisation erfolgt üblicherweise durch die eigene Zustimmung und die der Organisation. In der Organisation Schule gilt dies für die Schüler / -innen im Vergleich zu den Lehrkräften insofern eingeschränkt, als dass die Schulpflicht in Deutschland ihren Besuch rechtlich regelt. Die Lehrpersonen hingegen sind sich ihrer Mitgliedschaftsrolle und einer relativen Freiwilligkeit bewusst; sie ist insofern relativ zu sehen, da die Tätigkeit (auch) zur Sicherung des Lebensunterhaltes ausgeführt wird.
Lehrkräfte sind sich ihrer organisationalen Mitgliedschaften v. a. in Situationen bewusst, in denen sich ihre (pädagogischen) Überzeugungen gegen die Organisationen richten. Dies kann dann der Fall sein, wenn sie Schüler / -innen Zensuren geben müssen. Widersprechen sie dieser Praxis, welche die Organisation qua formaler Regelungen einfordert, droht ihnen ein Disziplinarverfahren, das die Androhung eines Ausschlusses darstellt. Mitgliedschaft liegt hier, im Vergleich zum Milieu, reflexiv vor. Eine Tatsache, die es ermöglicht, die Organisation zu steuern, zu stabilisieren und Veränderungen zu initiieren (Nohl 2010, 195 ff). Für die Zugehörigkeit zu einem Milieu gilt dies nicht; sie ist weder durch einen Willensakt zu erzeugen noch auf diesem Wege veränderbar. Auch kann sie, anders als eine Mitgliedschaftsrolle, nicht „gekündigt“ werden. Zugespitzt verweist dies auf Zugehörigkeit zu einem Milieu einerseits und Mitgliedschaft in einer Organisation andererseits. Mitgliedschaft und Zugehörigkeit lassen sich zwar analytisch trennen, beziehen sich aber in den Praktiken innerhalb einer Organisation wechselseitig aufeinander (Nohl 2007, 66 f).
formale Regeln
Eine Besonderheit von Organisationen stellen ihre formalen Regeln dar. Diese sind eine Art Rahmen, in dem sich die konkreten Regeln entwickeln, ohne als direkte und unmittelbare Handlungsanweisung zu fungieren, wie etwas ganz genau zu tun ist. Eine formale Regel kann von den Organisationsmitgliedern durch drei unterschiedliche Formen bearbeitet werden:
toleriertes Unterleben
milieugeprägte Umgangsweisen mit formalen Regeln
informelle Regeln des Organisationsmilieus
Unterleben
Die formalen Regeln können unterlaufen werden, indem sie nicht beachtet werden, ihnen also zuwider gehandelt wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Schüler / -innen im Unterricht untereinander Gespräche führen, während die Lehrperson der gesamten Lerngruppe etwas erklärt. Die formale Regel, dass die Schüler / -innen der Lehrperson zuhören, wird hier unterlaufen, es entsteht ein Unterleben. Dieses Unterleben kann akzeptiert und damit erlaubt werden, oder es kann vonseiten der Lehrperson sanktioniert werden (Nohl 2010, 199 ff).
milieugeprägter Umgang mit den Regeln
Die Mitglieder einer Organisation gehören sozialen Milieus an. Wenn habituelle Handlungsweisen und Praktiken, ihre milieugeprägte Alltagsgestaltung, das Handeln der Mitglieder auch im organisatorischen Kontext der Schule kennzeichnen, liegen milieugeprägte Umgangsweisen mit formalen Regeln vor. Dies erfolgt dann problemlos, wenn die formalen Regeln der Schule mittels des konjunktiven Erfahrungswissens verstanden und die damit verbundenen Erwartungen in den Praktiken realisiert werden.
Hannah ist in einer Familie sozialisiert, in der sie in ihrem Alltag herausgefordert ist, Entscheidungen zu treffen, z. B., ob sie lieber einen Apfel oder eine Banane essen möchte. Wird sie von ihren Eltern oder ihren älteren Geschwistern dazu aufgefordert, kann Hannah ihre Auswahl für das eine oder das andere auch begründen. Wenn Hannah im Unterricht aufgefordert wird zu begründen, warum sie sich im Rahmen der Wochenplanarbeit für Aufgaben aus dem Fach Mathematik entschieden hat, kann sie dies. Sie wendet die von zu Hause gewohnte Praktik an, Entscheidungen zu treffen und sie zu begründen. Hannah kann die formale Regel, ihre Arbeitsschritte zu begründen, aus ihrem Milieu heraus verstehen und bearbeiten.
informelle Regeln
Die dritte Variante der Bearbeitung formaler Regeln besteht in ihrer Konkretisierung durch informelle Regeln im Sinne eines Organisationsmilieus. Dieses Prinzip findet sich dort, wo mittels konjunktivem Verständnis der Organisationsmitglieder eine formale Regel in die Praxis übersetzt wird. Praktiken, die sich dabei als erfolgreich erweisen und sich derart durchsetzen, dass sie überindividuellen Charakter annehmen, werden als „Organisationsmilieu“ bezeichnet. Sie stellen eine Konkretisierung der formalen Regel dar, die sich von einer direkten Handlungsbeschreibung unterscheidet. Sie bedürfen, wie für Milieus typisch, keiner Explikation, sondern beruhen auf Verstehen (Nohl 2007, 69 f).
Sezen ist mit ihrer Familie in eine andere Stadt gezogen und besucht eine neue Schule. Die Art und Weise wie ihre neue Lehrerin, Frau Stein, Schüler / -innen auswählt, die im Morgenkreis etwas berichten dürfen, unterscheidet sich von der, die sie aus ihrer alten Schule kennt. Sezen kann sich an den anderen Schüler / -innen orientieren, sie kann diese und ihre Praktiken, die informellen Regeln folgen, beobachten. Dies kann mimetisch und vorreflexiv erfolgen und ist nicht auf explizite Kommunikation angewiesen.
Organisationsmilieus
Die Entwicklung von Organisationsmilieus kann – langfristig – in die Formulierung formaler, neuer Regelungen münden. Hier manifestiert sich neues habituelles Handeln in der Organisation. Es ist dem eines Milieus vergleichbar, da es durch die Beobachtung anderer und mimetischer Lernprozesse angeeignet wird und den Akteuren und Akteurinnen in der Regel ausschließlich vorreflexiv zur Verfügung steht (Nohl 2010, 203 f).
Die kollektiv geteilten Regeln der Interpretation formaler Regeln beinhalten die impliziten Wissensbestände, die in der Organisation neu entstanden sind. Das so entstandene Organisationsmilieu wird folglich erst durch die Mitgliedschaft zur Organisation möglich. Die Mitgliedschaftsrolle ist also notwendige Voraussetzung für die Entwicklung einer organisationalen Milieuzugehörigkeit. Wie soziale Milieus auch, sind Organisationsmilieus vielschichtig und mehrdimensional. Innerhalb einer Schule lässt sich z. B. das Organisationsmilieu der Lehrkräfte von dem der Schüler / -innen unterscheiden, das wiederum in sich vielschichtig ist bzw. sein kann. Dass Schulen sich stark voneinander unterscheiden, ist Ausdruck unterschiedlicher Organisationsmilieus (Nohl 2007, 70).
Milieus in Organisationen
Die Handlungspraktiken innerhalb einer Organisation sind entsprechend durch zwei unterschiedliche Milieutypen bedingt: jene sozialen Milieus, denen die Organisationsmitglieder angehören und die sie in die Organisation einbringen und jene, die sich in der Organisation selbst entwickeln. Diese sind nicht identisch, stehen jedoch in Relation zueinander respektive sind aufeinander bezogen (Nohl 2010, 206).
Diskriminierung
Schule als Ort milieuübergreifender Verständigung und systematischer Benachteiligungen sozialer Gruppen: Sowohl die Strukturen, d. h. die formale Ebene, als auch die Praktiken in Organisationen bergen Risiken systematischer Benachteiligungen und Schlechterstellungen spezifischer Schülergruppen. Innerhalb von Organisationen kann dies als „Diskriminierung“ bezeichnet werden. Nohl (2010) hat unter Bezugnahme auf die soziologischen Arbeiten Luhmanns, Goffmans, Ortmanns und Bohnsacks ein Verständnis von „Organisation“ und „Diskriminierung“ entwickelt, das dies zu fassen ermöglicht (Nohl 2010, 195 ff). Die Ausführungen Bourdieus (1998) erweitern die Überlegungen Nohls (2010) um den expliziten Verweis auf die historische Entstehung formaler Regeln, in denen vorangegangene Auseinandersetzungen und Machtpositionen enthalten sind. Dies spiegelt sich zum einen in den Strukturen der Organisation der Schule wider, zum anderen in den kulturellen Praktiken, die im und durch das Organisationsmilieu tradiert werden.
Die Organisation der Schule eröffnet mithin Potenziale, um Lernen, Bildung und Sozialisation über die Grenzen von Milieus hinweg zu gestalten, und birgt zugleich Risiken systematischer Benachteiligung, also der Diskriminierung von Schüler / -innen bzw. von Schülergruppen. Eindimensionale Betrachtungen, die nur eine Milieudimension in den Blick nehmen, werden als „totale Identifizierung“ bezeichnet. Wird diese Reduktion auf eine Erfahrungsdimension herangezogen, um die Handlungen und Praktiken einzelner Personen infrage zu stellen – und entlang dieser Zuschreibungen auch den Zugang oder die Mitgliedschaft innerhalb einer Organisation –, so ist dies diskriminierend. Im Rahmen von Organisationen finden diese Diskriminierungen im interaktiven Austausch der Beteiligten statt und können zugleich durch den organisatorischen Prozess hervorgebracht werden; als solche sind sie hochkomplex, da sich mehrere potenzielle Dimensionen miteinander verbinden und auch konfligieren können. Jenseits totaler Identifizierungen finden sich jene Identifizierungen, die nicht im Vorwege, sondern im Nachhinein mit Diskriminierung verknüpft werden, z. B. wenn festgestellt wird, dass eine soziale Gruppe schlechter gestellt ist als eine andere (Nohl 2010, 216 f).
Reifizierungsproblem
Es gibt soziale Gruppen oder Milieus, die innerhalb von Schule kontinuierlich gegenüber anderen schlechter gestellt sind (Nohl 2010, 213). Der Begriff „soziale Gruppe“ bezieht sich hier nicht auf real vorhandene, sondern auf konstruierte Gruppen, wie beispielsweise „die Mädchen“. In der Beschreibung selbst wird das Reifizierungsproblem deutlich: Dass derartige Gruppen einerseits umschrieben werden müssen, um Diskriminierungspraktiken identifizieren zu können (z. B. in der statistischen Betrachtung von Benachteiligungen der Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem); durch die Beschreibung der Gruppe wird diese andererseits als solche aber auch konstruiert und – in einer eindimensionalen Perspektive – betrachtet. Derartige Identifizierungen schließen andere Milieudimensionen aus, denen die Schüler / -innen ebenfalls angehören.
habitualisierte Zuschreibungen
Die Mitgliedschaft zu Organisationen unterscheidet zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Bezogen auf die Schule als Organisation insgesamt sind fast alle Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland leben, Mitglieder in ihr, wenn auch in unterschiedlichen Suborganisationen, den verschiedenen Bildungsgängen bzw. Schulformen (in einigen Bundesländern sind Schüler / -innen ohne legalen Aufenthaltsstatus vom Schulbesuch ausgeschlossen (Gogolin 2011, 55)). Derartige Zuschreibungen können habitualisiert erfolgen, also unreflektiert und sich im Sprachgebrauch niederschlagen.
Die Gründe für diskriminierende Praktiken können auf den unterschiedlichen Ebenen der Organisation Schule greifen: formale Regeln, informelle Regeln der Organisationsmilieus, die milieugeprägten Umgangsweisen mit formalen Regeln und / oder das in ihr tolerierte milieubedingte Unterleben. Diese vier Formen können jeweils durch den Modus totaler Identifizierung einer sozialen Gruppe entstehen oder jenseits dieser (Nohl 2010, 224). Im Kontext der Organisation Schule sind folglich acht Typen systematischer Schlechterstellung zu unterscheiden:
total identifizierte Diskriminierung: durch formale Regeln, durch informelle Regeln des Organisationsmilieus, durch milieugeprägte Umgangsweisen mit formalen Regeln und durch toleriertes milieubedingtes Unterleben
Diskriminierung jenseits totaler Identifizierung: durch formale Regeln, informelle Regeln des Organisationsmilieus, milieugeprägte Umgangsweisen mit formalen Regeln und toleriertes milieubedingtes Unterleben (Nohl 2010, 224 ff)
Exklusion und Marginalisierung
Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie als Formen systematischer Benachteiligung zu Exklusionen, d. h. dem Ausschluss aus Bildungsgängen und / oder Lerngruppen, und / oder zu Marginalisierungen innerhalb dieser führen können. Letztere beziehen sich auf Schlechterstellung bzw. der Einnahme von Randpositionen innerhalb von Bildungsgängen und Lerngruppen.
Die aktuelle Konstitution der Schule als gesellschaftliche Organisation und ihre instituierten formalen Regeln sind Ausdruck historischer Auseinandersetzung, aus denen sie hervorgegangen sind und legitimiert wurden. Sie finden ihren Ausdruck in den heutigen formalen Regeln der Schule sowie den dort gängigen Handlungspraktiken, die sich in Organisationsmilieus niederschlagen. Im nachfolgenden Kapitel werden dieses formale Verständnis von Schule und ihre Aufgaben in der Gesellschaft vorgestellt. Als Teil des Bildungssystems sind der Organisation Schule Vorstellungen inhärent, wie Differenzen zu bearbeiten und herzustellen sind. Im vierten Kapitel liegt dann der Fokus auf den Praktiken, mit denen in der Schule systematische Formen der Benachteiligung hervorgebracht werden.
Zusammenfassung
Heterogenität und Homogenität beruhen auf unterschiedlichen bzw. auf gemeinsamen Erfahrungen, die Menschen in ihrem Alltag machen, und sind gleichzeitig Grundlage der Gestaltung ihrer Praktiken. Dieses praktische Wissen, über das Menschen – über explizites Wissen hinaus – verfügen, ist ihnen in der Regel nicht reflexiv zugänglich. Unterschiedliche Milieus kennzeichnen plurale Gesellschaften und stehen (auch) im Zusammenhang mit je verschiedenen Möglichkeiten des Zugangs zu gesellschaftlichen Gütern und der Teilhabe daran.
Werden Differenzen beschrieben, erfolgt dies durch Abstraktion von der Vielschichtigkeit von Milieus und ihren Praktiken. Insbesondere eindimensionale Zuschreibungen von Milieuzugehörigkeit bergen, aufgrund ihrer eingeschränkten Sicht, das Risiko diskriminierender Zuschreibungen. In Organisationen, wie der Schule, können Milieus, soziale Gruppen aufgrund ihrer Milieuzugehörigkeit und oder -zuschreibung systematisch benachteiligt werden.
2.4 Übungsaufgaben
Aufgabe 1
Wie hängen Heterogenität und Homogenität in einer sozial-konstruktivistischen Perspektive zusammen?
Aufgabe 2
Worauf kann sich die Aussage „die Klasse ist sehr heterogen“ aus sozial-konstruktivistischer Sicht beziehen?
Aufgabe 3
Erläutern Sie, was innerhalb der praxeologischen Wissenssoziologie mit „Milieu“ gemeint ist.
Aufgabe 4
Erstellen Sie eine Abbildung, die den Zusammenhang bzw. die Tauschoptionen der unterschiedlichen Kapitalsorten, die Bourdieu nennt, veranschaulicht.
Aufgabe 5
Nennen Sie Kriterien, anhand derer sich Milieus von Organisationen unterscheiden.
2.5 Literaturempfehlungen
Bohnsack, R. (2010): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden. 8. Aufl. Verlag Barbara Budrich, Opladen / Farmington Hills
Bourdieu, P. (1998): Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Suhrkamp, Frankfurt a. M.
Bourdieu, P. (1992): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur 1. Herausgegeben von Margareta Steinrücke. VSA-Verlag, Hamburg
Bourdieu, P. (1987): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt a. M.
Emmerich, M., Hormel, U. (2013): Heterogenität – Diversity – Intersektionalität. Zur Logik sozialer Unterscheidungen in pädagogischen Semantiken der Differenz. Springer VS, Wiesbaden
Gomolla, M. (2009): Heterogenität, Unterrichtsqualität und Inklusion. In: Fürstenau S., Gomolla, M. (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Unterricht. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 21–43.
Koller, H. C., Casale, R., Ricken, N. (Hrsg.) (2014): Heterogenität. Zur Konjunktur eines pädagogischen Konzepts. Ferdinand Schöningh, Paderborn
Krais, B., Gebauer, G. (2002): Habitus. transcript, Bielefeld
Lorenz, A., Lépine, R. (2014): Pierre Bourdieu. Philosophie für Einsteiger. Wilhelm Fink, Paderborn
Mannheim, K. (1980): Strukturen des Denkens. Suhrkamp, Frankfurt a. M.
Nohl, A.-M. (2010): Konzepte interkultureller Pädagogik. Eine systematische Einführung. 2. Aufl. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn
Trautmann, M., Wischer, B. (2011): Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden
Wenning, N. (1999): Vereinheitlichung und Differenzierung. Zu den „wirklichen“ gesellschaftlichen Funktionen des Bildungswesens im Umgang mit Gleichheit und Verschiedenheit. Leske + Budrich, Opladen
Hier gelangen Sie in der Lern-App zum Buch zu weiteren Fragen zu Kapitel 2:
Hex-Code: F