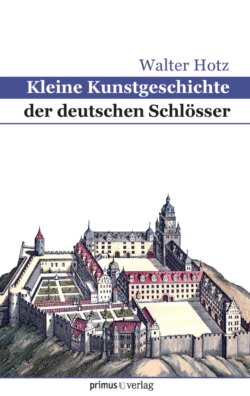Читать книгу Kleine Kunstgeschichte der deutschen Schlösser - Walter Hotz - Страница 6
VORWORT
Оглавлениеvon Prof. Dr. Matthias Müller
Als vor mehr als 40 Jahren Walter Hotz' „Kleine Kunstgeschichte der deutschen Schlösser“ bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschien, war mit diesem Buch ein zweifaches Anliegen verbunden: Zum einen sollte der vom selben Autor verfasste und im Leserkreis positiv aufgenommene Band einer „Kleinen Kunstgeschichte der deutschen Burg“ eine Fortsetzung finden, und zum anderen sollte in einer klaren, schnörkellos-informativen Darstellung eine wissenschaftlich fundierte Überblicksdarstellung zum deutschen Schlossbau geliefert werden. Wer heute ein Exemplar der Erstausgabe von 1970 in die Hand nimmt, wird beim Anblick des zwar praktischen aber auch sehr einfachen, vollkommen unbedruckten Bucheinbandes zunächst den Eindruck eines im Wortsinn ‘armen‘ Buches gewinnen, der nur schwer zu dem so sehr von Glanz und Pracht bestimmten inhaltlichen Gegenstand der Schlossbaukunst zu passen scheint. Wenn man sich aber nicht scheut, den Band aufzuschlagen und darin zu blättern, dann erblickt man ein durchaus anspruchsvoll gemachtes Buch, das nicht nur über instruktive Grundrisse und gezeichnete Ansichten einzelner Schlösser verfügt, sondern darüber hinaus auf 208 ganzseitigen Bildtafeln die wichtigsten Schlösser präsentiert. Die heute eher störende mangelhafte Brillanz der Schwarzweiß-Abbildungen schmälerte damals den hohen Gebrauchswert des Bandes für die Liebhaber deutscher Schlossbaukunst in keiner Weise.
Wenn jetzt, nach mehr als 40 Jahren, dieses für die breite Wissensvermittlung über den deutschen Schlossbau so wichtige Buch von Walter Hotz einen Nachdruck erfährt, dann soll damit an eine Tradition der knappen und preiswerten Information angeknüpft werden. Zwar musste der Bildteil der Originalausgabe entfallen, da dafür kostspielige Neuaufnahmen notwendig gewesen wären, doch erhielt das Buch nun einen ansehnlichen, modern gestalteten Einband. Der Text von Walter Hotz blieb unverändert und entspricht damit dem Stand von 1970. Ist er damit nicht längst veraltet und ein Wiederabdruck allenfalls von antiquarischem bzw. wissenschaftshistorischem Interesse?
Natürlich ist die Forschung zur Schlossbaukunst in der Zwischenzeit nicht stehen geblieben, sondern hat im Gegenteil gerade in den letzten zwanzig Jahren einen geradezu explosiven Aufschwung erfahren. Denn anders als in den 1970er Jahren, als sich für Fragen der Schlossarchitektur zwar ein breites Publikum nicht aber die akademische, zunehmend soziologisch orientierte Kunstgeschichte interessierte, gehört das Thema heute zumindest in der Forschung zu den zentralen Gegenständen des Faches. Die dabei erhaltenen Erkenntnisse haben nicht nur unser Wissen über die formal-gestalterischen, funktionalen und semantischen, d.h. die Symbol- und Zeichenhaftigkeit betreffenden Aspekte des deutschen Schlossbaus beträchtlich vermehrt, sondern darüber hinaus dank einer intensiv betriebenen Bauforschung auch unseren Kenntnisstand zur Baugeschichte und Datierung zahlreicher Schlösser teilweise fundamental korrigiert. Während es für die Wissenschaftlergeneration von Walter Hotz ein vordringliches Anliegen war, die kunst- bzw. architekturgeschichtlichen Objekte zu sortieren und zu klassifizieren, um sie so in den vermeintlichen Entwicklungsgang einer übergeordneten Stil- und Typengeschichte einzuordnen, erkennt die jüngere und heutige Generation eher die Grenzen und nur bedingte Tauglichkeit eines solchen methodischen Ansatzes. Denn sowohl die realen historischen Verhältnisse der höfischen Gesellschaft als auch die realen Verhältnisse der Baugeschichte und Baupraxis der Schlösser selbst folgten allenfalls in Ansätzen den Prämissen einer von Architekten formulierten und von Architekturhistorikern gesuchten Theorie des Bauens. In der Regel verhinderte bereits der im Schlossbau notwendige Pragmatismus mit seinen rechtlichen und ökonomischen Zwängen aber noch mehr ein für die Adelsgesellschaft spezifisches ideelles Normensystem, in das besonders auch der Schlossbau eingebunden war, die kompromisslose Orientierung an architekturtheoretischen Normen, die dem adligen Normensystem teilweise sogar geradezu widersprachen. Wegen seiner großen Bedeutung wird auf dieses Thema im Folgenden nochmals zurückzukommen sein.
Von alledem findet sich im vorliegenden Reprint selbstverständlich keine Spur. Wenn der Text von Walter Hotz dennoch auch heute noch von Nutzen sein kann, dann deswegen, weil er eine bestimmte wissenschaftliche Qualität besitzt, die auch nach Jahrzehnten nur wenige Alterungsspuren aufweist. Diese Qualität ist vor allem in der hohen Güte der Beschreibungen und formalen Charakterisierungen der vorgestellten Schlösser zu sehen. Es sind Beschreibungen, deren nüchterne, sachliche Sprache auch heute noch geeignet ist, dem interessierten Laien den oftmals komplexen Gegenstand der Schlossarchitektur näherzubringen und die durch die klare sprachliche Diktion, die nahezu ganz ohne Thesen und Spekulationen auskommt, eine erste, kenntnisreiche Annäherung an die deutschen Schlossbauten ermöglicht. Und es ist der weite geschichtliche Bogen, den Walter Hotz in seinem kleinen Buch vom ausgehenden Mittelalter bis zur ausgehenden Frühen Neuzeit spannt, sowie die Auswahl der dafür beispielgebenden Schlossbauten, die den Reprint auch heute noch nützlich erscheinen lassen. Dabei ist die Auswahl so glücklich gewählt, dass sie im Großen und Ganzen immer noch Gültigkeit beanspruchen darf. Nur für die Frühzeit des deutschen Schlossbaus sind bei Walter Hotz große Defizite festzustellen, die sich vor allem aus der Prämisse ergeben, dass erst die Rezeption von Elementen italienischer Renaissancearchitektur ein Kriterium für die Ablösung der wehrhaften Burgenarchitektur durch den repräsentativen Schlossbau liefert. Doch diese Annahme kann keine Gültigkeit mehr beanspruchen, weshalb hierzu weiter unten ein paar erklärende Hinweise gegeben werden. Wer sich darüber hinaus eine Vertiefung auf dem aktuellen Stand der Forschung wünscht, der muss auf die inzwischen reichhaltig erschienene und am Schluss in wenigen Hauptwerken genannte Spezialliteratur zurückgreifen, die jedoch wiederum selten einen so profunden Überblick über die Vielfalt der Erscheinungsformen deutscher Schlossarchitektur zu bieten vermag wie Walter Hotz’ „Kleine Kunstgeschichte der deutschen Schlösser“.
Um dennoch zu verdeutlichen, welches immense neue Wissen seit der Erstauflage dieses Buches über den Schlossbau nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa hinzugewonnen werden konnte und wie sehr dabei eine zunehmend interdisziplinär arbeitende kulturwissenschaftliche Forschung die Schlossbauten wieder als Monumente einer bestimmten kulturellen Praxis adlig-höfischen Lebens und Repräsentierens zu rekontextualisieren vermochte, sollen im Folgenden wenigstens einige Aspekte des aktuellen Wissensstandes angesprochen und auf einige wesentliche Studien hingewiesen werden. Einen wichtigen Grundstein für den Aufschwung der Schlossbauforschung hat nicht zuletzt die wegweisende Studie des Soziologen Norbert Elias über „Die höfische Gesellschaft“ des französischen Absolutismus gelegt, die zwar bereits 1969, nur ein Jahr vor Walter Hotz’ Buch zum deutschen Schlossbau, erschien, von der soziologisch orientierten Kunst- und Architekturgeschichtsschreibung aber erst beinahe zwanzig Jahre später, als das Interesse an der Erforschung höfischer Architektur wuchs, intensiv rezipiert wurde. Dabei sollte das von Elias vornehmlich am Beispiel von Versailles entwickelte Modell eines absolutistischen Hofes in seiner Prägnanz und Geschlossenheit für lange Zeit zum Leitbild der kulturwissenschaftlich ausgerichteten Hofforschung werden und prägte auch den Blick auf die Verhältnisse im deutschen bzw. Alten Reich nachhaltig. Dies hatte zur Folge, dass die von Elias für Versailles beschriebenen Verhältnisse nahezu bruchlos auf die Situation in Deutschland übertragen wurden und sich auch für die Kunsthistoriker in jedem dreiflügeligen, axial ausgerichteten deutschen Barockschloss sogleich das Vorbild von Schloss Versailles spiegelte.
Von daher ist es das Verdienst eines Teils der deutschen Geschichtswissenschaft, dieses geradezu hermetische Modell von Norbert Elias wieder aufzubrechen und vor allem für die deutschen Fürstenhöfe die besondere, viel stärker auf dem dynastischen Prinzip basierende und daher mit Frankreich nur bedingt vergleichbare Entwicklung der deutschen höfischen Gesellschaft von ihren Anfängen her differenziert zu untersuchen. Der maßgebliche Impuls ging dabei von der Residenzenkommission der Göttinger Akademie der Wissenschaften aus, die sich – anfangs unter der Führung von Hans Patze und, nach dessen frühem Ableben, dann von Werner Paravicini – zunächst den Fürstenhöfen und später auch den rangniederen Adelsgruppen widmete. Da sich der Residenzenkommission der Göttinger Akademie auch Kunsthistoriker (für die Anfangszeit sind hier vor allem Ulrich Schütte und Uwe Albrecht zu nennen) verbunden fühlten und entweder als Mitglied oder als Kooperationspartner die von den Historikern aufgeworfenen Fragen mit denjenigen der Architekturgeschichte des Schlossbaus verknüpften, profitierte von diesem Aufbruch der Residenzforschung schließlich auch die akademische Kunstgeschichte und ihr Wissen über die Funktion und Bedeutung der Schlossarchitektur im Kontext höfischer Alltags-, Fest- und Zeremonialpraxis. Sie fand zudem eigene Foren des wissenschaftlichen Austausches, zu denen in Deutschland besonders der auf Schloss Heidecksburg in der ehemaligen thüringischen Residenzstadt Rudolstadt nach der deutschen Wiedervereinigung gegründete Rudolstädter Arbeitskreis für Residenzkultur sowie die Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern gehören. Durch die Vernetzung mit den inzwischen zahlreich gegründeten europäischen Forschungsinitiativen zur Residenzkultur war es zudem möglich, die Bedeutung der deutschen Schlossarchitektur auf internationaler Ebene zu diskutieren und manche bislang für typisch ‚deutsch‘ gehaltene Besonderheit als durchaus europäisches Phänomen zu erkennen.
Zu diesen vermeintlichen Besonderheiten gehört nicht zuletzt die regionalspezifische Rezeption der italienischen Renaissance- oder französischen Barockformen, die im deutschen Reich bis zum Dreißigjährigen Krieg zumeist nur in einer an einheimische Formtraditionen bewusst angepassten Weise übernommen wurden, und der im italienischen wie im französischen Palastbau entwickelten regelmäßigen Grundrisse. Die Ansicht, dass die Herausbildung des repräsentativen Schlosses auch in Deutschland unabdingbar mit der Übernahme von Formen und Elementen der italienischen Renaissance verbunden sei, gehört zu den nachhaltigen Irrtümern der Kunstgeschichtsschreibung. Denn wie die aktuelle, kulturwissenschaftlich ausgerichtete Forschung vielfältig zu belegen vermag, war die Kunstentwicklung der Frühen Neuzeit in Europa keinem gemeinsamen, vom italienischen Renaissancehumanismus her bestimmten Ziel verpflichtet, weshalb Stildifferenzen – z.B. zwischen der deutschen Spätgotik und der italienischen Renaissance – eher die Differenzen unterschiedlicher ‚Sprachen‘ als unterschiedlich ‚fortschrittlicher‘ Kulturentwicklungen anzeigen. Eine solche Erkenntnis ist wesentlich, ermöglicht sie doch zugleich eine Neubewertung des Regionalen oder gar ‚Nationalen‘ in der Kunst und Kultur der frühneuzeitlichen Territorialherrschaften und damit auch in der Architektur der deutschen Schlossbauten. Vor diesem Hintergrund muss nun auch an der von Walter Hotz vorgenommenen Datierung des Beginns deutscher Schlossarchitektur eine wesentliche Korrektur vorgenommen werden: Nicht erst um 1550 (mit Schlössern wie Torgau, Berlin, Dresden oder Heidelberg) beginnt im deutschen Reich der Übergang von der befestigten Burg hin zum repräsentativen, nur noch bedingt wehrhaften Schloss, sondern bereits gegen 1471! Damals wurde oberhalb von Meißen mit der Albrechtsburg in Deutschland erstmals ein Fürstensitz errichtet, der im Außen- und im Innenbau die Funktionen des repräsentativen Wohnens, Verwaltens und des höfischen Festes eindeutig gegenüber den Wehrfunktionen betonte. Die für die Albrechtsburg durch den sächsischen Hofarchitekten Arnold von Westfalen entwickelten gestalterischen und funktionalen Lösungen lassen auf innovative Weise das Konzept eines modernen fürstlichen Residenzschlosses erkennen, wie es in dieser Zeit ansonsten nur in Frankreich und – in Grenzen – in Italien zu finden war. Zu diesem Konzept gehören das klar strukturierte, regelmäßige Fassadenbild unter einer einheitlichen Dachlandschaft, die wiederum mit französisch anmutenden Zwerchhäusern besetzt wurde, im Innenhof der spektakuläre filigran-offene Treppenturm mit Loggien oder – ganz wesentlich – die systematische Raumaufteilung in zweiräumige, ofen- und kaminbeheizte Appartements und die Einrichtung von separaten fürstlichen Speisezimmern („Tafelstuben“) sowie speziellen fürstlichen Rückzugsräumen in der Art französischer oder italienischer Studierstuben. Dass dieses außergewöhnliche Bauwerk von Walter Hotz weder als erstes voll ausgebildetes deutsches Schloss erkannt wurde noch überhaupt in seinem Buch Erwähnung fand, liegt einzig und alleine daran, dass es seine innovative, mit französischen oder italienischen Schlössern jener Zeit absolut konkurrenzfähige Architektur nicht in den Formen der italienischen Renaissance, sondern im Gewand der deutschen „Spätgotik“ präsentiert. Gotisch anmutende „Vorhangbögen“ und „Zellengewölbe“ (beides formal wie technisch hochkarätige Erfindungen bzw. Weiterentwicklungen des Baumeisters Arnold von Westfalen) passten einfach nicht zur idealtypischen akademischen Vorstellung eines renaissancezeitlichen Schlosses. Sie verstellten damit zugleich den offenen Blick auf die historische Tatsache, dass die um 1500 entwickelte deutsche „Spätgotik“ in ihrer konstruktiven Artifizialität im Wesentlichen als traditionsgeleitete, historisch begründete ,deutsche‘ Antwort auf die Antikenrezeption italienischer Architekten und als eigenständiger gleichsam ‚nationaler‘ Beitrag im Umgang mit den kulturellen Herausforderungen des italienischen Renaissancehumanismus zu verstehen ist.
Doch nicht nur das idealtypische Modell eines aus der italienischen Renaissancearchitektur abzuleitenden Beginns der deutschen Schlossbaukunst bedarf der Korrektur. Ebenso muss die Annahme, dass zu einem solchen Schloss idealtypisch auch ein regelmäßiger Grundriss gehört, nachdrücklich hinterfragt werden. Auch Walter Hotz bezeichnet regelmäßige Grundrisse, zu denen neben dem Kastelltypus die Drei- oder Vierflügelanlagen gehören, als anzustrebende Idealformen. In der gebauten Realität des deutschen Schlossbaus finden wir solche Grundrissformen jedoch bis zum Dreißigjährigen Krieg nur sehr selten. Und es darf bezweifelt werden, ob die fürstlichen oder gräflichen Auftraggeber überhaupt ein ebenso starkes Bedürfnis nach mathematisch klar geordneten Grundrisslösungen empfanden, wie es seit Dürers 1526 entworfenem Idealplan für eine königliche Residenz- und Festungsstadt, der strikt dem Prinzip des Quadrates folgt, immer mehr Architekten auch in Deutschland äußerten. Selbst in Italien, wo es seit Leon Battista Albertis Traktat „Über die Baukunst“ (1435) eine schriftliche Ausformulierung einer an der Antike orientierten, geometrisch regularisierten Baupraxis gab, finden wir im Schlossbau der zu Fürsten aufgestiegenen Markgrafen und Söldnerführer erstaunlich häufig ein Abweichen von der theoretischen Norm (vgl. z.B. den Palazzo Ducale in Mantua oder das Castello Estense in Ferrara). Von daher gilt es sauber zu unterscheiden und anzuerkennen, dass ein fürstlicher Schlossbau kein Florentiner oder römischer Stadtpalast und keine Villa sub urbana ist, sondern ein multifunktionaler, meist über Jahrhunderte gewachsener Bauorganismus mit spezifischen territorialrechtlichen und dynastischen Traditionen. Vergleichbar der vielgescholtenen ‚mittelalterlichen‘ Baupraxis in den nördlichen Ländern bewahren diese italienischen Schlossanlagen in ihrem Zentrum gut sichtbar eine Vielzahl älterer Bauteile, deren offensichtlich unabänderliche Existenz auch noch die Planungen theoriegeleiteter Renaissancearchitekten zu respektieren hatten.
Dies gilt im Prinzip selbst noch für die Zeit des barocken, ‚absolutistischen‘ Schlossbaus, wobei hier im deutschen Schlossbau die kaiserliche Wiener Hofburg ein besonders extremes Beispiel darstellt. Das Äußere der Wiener Hofburg präsentiert sich bis auf den heutigen Tag als ein Konglomerat verschiedenster Bauten, deren Kern die noch aus dem 13. Jahrhundert stammende staufisch-babenbergische Kastellburg bildet. Mit diesem Kern wurden seit dem ausgehenden Mittelalter eine Reihe von selbständigen Gebäudeanlagen verbunden, von der Amalienburg des 16. Jahrhunderts über den Leopoldinischen Trakt des 17. Jahrhunderts bis hin zum Reichskanzleitrakt Fischers von Erlach aus dem 18. Jahrhundert und der Neuen Hofburg des 19. Jahrhunderts. Im Vergleich zu Versailles, dem neuen, glänzenden Residenzschloss des französischen Königs, aber auch im Vergleich zum Louvre musste das Schloss des Kaisers in Wien seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert jedenfalls als vollkommen veraltet gelten und kaum geeignet erscheinen, die kaiserlichen Würden auf angemessenem europäischen Niveau zu repräsentieren. Mit den hochmodernen Barockschlössern der Fürstbischöfe, Kurfürsten und Fürsten in Würzburg, Augustusburg, Stuttgart oder Rastatt drohten sogar die deutschen Fürsten dem Kaiser architektonisch die Schau zu stehlen.
Der Eindruck, dass das kaiserliche Residenzschloss in Wien in seinem äußeren Erscheinungsbild den zeitgenössischen ästhetischen Standards nicht entsprach, gilt jedoch nur bei oberflächlicher Betrachtungsweise. Denn überall dort, wo das Residenzschloss eine lange, traditionsreiche Baugeschichte besaß, blieben die Spuren dieser Geschichte in auffälliger Weise auch noch in der erneuerten Gestalt des Schlosses sichtbar. Nicht nur in Wien, auch in Berlin, Dresden, Paris oder Madrid wurden in die neuen barocken Anlagen der Residenzschlösser Teile der Vorgängeranlagen integriert. Selbst das von Ludwig XIV. errichtete Schloss von Versailles, dessen Baugestalt geradezu zum Prototyp des absolutistischen Herrschersitzes avancierte, birgt in seinem Kern bis heute das ältere Lustschloss Ludwigs XIII.
Da sich diese Spuren aus der älteren Baugeschichte nicht plausibel als Folge ökonomischen Denkens oder als Laune des Zufalls erklären lassen, muss dem Vorzeigen von Bauteilen, die aus der Vergangenheit des Schlosses stammten, ein besonderer Wert zugemessen worden sein. Offensichtlich existierte in der höfischen Architekturästhetik ein Bereich, der vom Regelwerk der Architekturtheorie nicht unmittelbar erfasst wurde und dessen Normensystem und Wertemaßstab sich daher in den Traktaten nicht ohne weiteres dargestellt findet. Erst wenn über die Aussagen der Baumeister und Theoretiker hinaus auch anderes auf die Residenzschlösser bezogenes Quellenmaterial (wie Teilungsurkunden, Stammbücher, fürstliche Briefwechsel etc.) berücksichtigt wird, lassen sich aufschlussreiche Hinweise darauf finden, in welchem Maße die für die gesamte Adelskultur maßgeblichen Prinzipien der Tradition und der Altehrwürdigkeit auch für den Bereich der höfischen Baukunst Gültigkeit besaßen. Weil das Schlossgebäude von alters her als corpus principis, als architektonischer Körper des Fürsten und Königs verstanden wurde, musste dieser Körper – wenn irgend möglich – auch äußerlich Spuren seiner jahrhundertealten Lebensgeschichte aufweisen. Erst dadurch konnte der Baukörper des Schlosses tatsächlich zu einem Äquivalent des dynastischen oder monarchischen Körpers eines Adelsgeschlechts oder einer herrschaftlichen Institution wie des Königtums werden, mit dem das Schloss funktional oftmals über Jahrhunderte verbunden blieb. Mit ihrem solchermaßen begründeten ideellen Wert befindet sich die baustoffliche Materie eines solchen Schlosses im Übrigen in einer großen Nähe zu den anderen Zeugnissen adliger Altehrwürdigkeit und konkurriert auf dieser Ebene mit den vielbeachteten Altertumssammlungen, Haus- und Erbkleinodien oder Familienarchiven. So wird das Schloss selbst noch im 19. Jahrhundert gewissermaßen zu einem Gegenstand der auf einen dynastischen Personenverband bezogenen Memoria und – mit den illustrierten Stammbäumen vergleichbar – zu einem Monument für die über alle Epochen hinweg ununterbrochen bestehende Existenz und Herrschaft einer fürstlichen Dynastie oder adligen Familie.
Weiterführende Literaturhinweise:
– Thomas Biller/G. Ulrich Großmann, Burg und Schloss. Der Adelssitz im deutschsprachigen Raum, Regensburg 2002.
– Stephan Hoppe, Die funktionale und räumliche Struktur des frühen Schloßbaus in Mitteldeutschland. Untersucht an Beispielen landesherrlicher Bauten der Zeit zwischen 1470–1570, Köln 1996.
– Stephan Hoppe, Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas 1580–1770, Darmstadt 2003, 2. Aufl. 2010.
– Hellmut Lorenz, „… Im alten Style glücklich wiederhergestellt …“. Zur repräsentativen Rolle der Tradition in der Barockarchitektur Mitteleuropas, in: Wiener Hofburg. Neue Forschungen (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 1997, Heft 3/4), S. 475–483.
– Matthias Müller, Spätmittelalterliches Fürstentum im Spiegel der Architektur, in: Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter (Residenzenforschung, Bd. 14), Stuttgart 2002, S. 107–145.
– Matthias Müller, Das Schloß als Bild des Fürsten. Herrschaftliche Metaphorik in der Residenzarchitektur des Alten Reichs (1470–1618) (Historische Semantik, Bd. 6), Göttingen 2004.
– Anke Neugebauer/Franz Jäger (Hgg.), Auff welsche Manier gebauet. Zur Architektur der mitteldeutschen Frührenaissance (Hallesche Beiträge zur Kunstgeschichte, Bd. 10), Bielefeld 2010.
– Friedrich B. Polleroß, Tradition und Recreation. Die Residenzen der österreichischen Habsburger in der frühen Neuzeit (1490–1780), in: Majestas, 6(1998), S. 91–148.
– Ulrich Schütte, Das Schloß als Wehranlage. Befestigte Schloßbauten der frühen Neuzeit im alten Reich, Darmstadt 1994.
– Ulrich Schütte, Das Fürstenschloß als „Pracht-Gebäude“, in: Die Künste und das Schloß in der frühen Neuzeit (Rudolstädter Forschungen zur Residenzkultur, Bd. 1), München/Berlin 1998, S. 15–29.