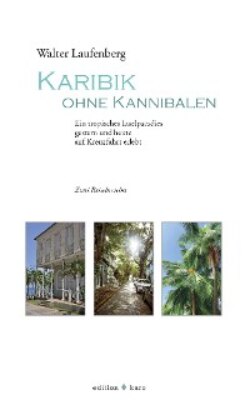Читать книгу Karibik ohne Kannibalen - Walter Laufenberg - Страница 6
PUERTO RICO
Оглавление8. Januar 1971. Früher Morgen. Seestärke 2, Windstärke 4, Wassertemperatur 30 Grad Celsius, Lufttemperatur 29 Grad Celsius, Geschwindigkeit 18,5 Knoten. Eintausend Meter Wasser unter mir – und daheim im Rheinland minus 15 Grad Celsius. Das erste Mal nach dem vergangenen Sommer wieder in Badehose. Am und im Swimmingpool des Schiffs.
Das ist heute der erste richtige Urlaubstag. Die meisten der fünfhundert Frostflüchtlinge bieten ihre weißen Körper der Sonne dar. Der große Wettbewerb um die knackigste Bräune hat begonnen. Nach dem ersten Vormittag an Deck sehe ich bereits etliche gerötete Schultern und Beine, auch hohe Denkerstirnen, die sich verfärbt haben. Dabei hatte die Reiseleitung über Bordlautsprecher eine eindringliche Warnung gegeben. Bei einem so plötzlichen Temperaturunterschied von 45 Celsiusgraden werde der Kreislauf gefährlich überlastet, hieß es.
Deshalb solle man bitte gerade am Anfang Zurückhaltung üben. Dass es auf der vorigen Reise zwei Todesfälle durch Kreislaufzusammenbruch gegeben hat, wie ich vom Reiseleiter erfahren hatte, wurde den sonnenhungrigen Gästen vorenthalten. Begann für sie doch gerade das teure High Life. Das durfte keine Flecken zeigen.
Schon vor dem Abflug in Frankfurt, als die Türen so lange offen standen, hatte sich jeder in die Wolldecke eingewickelt, die er auf seinem Sitz fand. Eine Ladung einheitlich verpackter Mumien. In einem Flugzeug, das dann wie eine üppig gefüllte Weihnachtsgans über den Atlantik flatterte, manchmal mit unangenehmem Flügelschlagen. Schon der endlos erscheinende Start, als die Maschine mit den 260 Menschen und all ihrem Gepäck auf dem Frankfurter Flughafen die ganze Länge der Rollbahn brauchte, um abzuheben. Weswegen ich versuchte, mich leicht zu machen in meinem engen Sitz.
Der Flughafen von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan hatte uns am Morgen mit bedecktem Himmel empfangen, nachdem drei unangenehme Kontrollen überstanden waren. Die Insel ist seit 1952 assoziiertes Mitglied der USA, also nicht ganz in amerikanischem Besitz, dafür umso amerikanischer im Auftreten. Die Inselbewohner wollten nicht von den Amerikanern einverleibt werden, sie lassen sich lieber als Busenfreunde hätscheln. Weil die US-Touristen nicht mehr auf ihrer Lieblingsinsel Kuba Urlaub machen können, von Fidel Castro vertrieben, ergießen sie sich mit Vorliebe über Puerto Rico. Also ist diese Insel doch so was wie ein Stück USA. Das bringt für deutsche Touristen allerlei Umstände. Das fing schon mit der Beschaffung eines Visums an. Dann mussten im Flugzeug besondere Landepapiere ausgefüllt werden, und zwar mit großen Druckbuchstaben. Das Herkunftsland musste auf Englisch genannt werden, bei der Heimatadresse sollten wir zuerst die Hausnummer, dann die Straße und danach den Ort schreiben. Auch Zahlen mussten so geschrieben werden, wie die Amerikaner es gewohnt sind: Die Eins ohne Anstrich und die Sieben ohne Querstrich.
Auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel in San Juan, in dem wir die erste Nacht verbringen sollten, war der amerikanische Einfluss unübersehbar. Riesenreklamen und Riesenautos. Immer wieder verkommene Mietskasernen mit vielen schwarzen Kindern. Dazwischen aber auch typische Landhäuser im alten Kolonialstil, die mit ihren vorspringenden Giebeln, mit vielen Säulen und allerlei Geschnörkel und zierlichem Gitterwerk anheimelnd wirkten.
Puerto Rico ist für den Fremden ein selbstbewusst auftretendes kleines Spanien, trotz der amerikanischen Besatzer. Also liefen wir durch die engen Straßen der Altstadt von San Juan und besichtigten spanische Festungen, die jahrhundertelang den holländischen, französischen und britischen Eroberern getrotzt haben.
In der kleinen Bodega freute sich der Wirt über mein freundliches »gracias« und »hasta mañana«. Auf seiner Theke eine uralte hölzerne Registrierkasse. Oben, wo der Preis abzulesen ist, zugeklebt mit Bildern der Gottesmutter. Wir amüsierten uns noch über die Maria-Hilf-Kasse, als in der Ecke hinter uns ein Huhn laut wurde. Es hatte gerade in der Wirtsstube ein Ei gelegt.
Am 19. November 1493 landete Christoph Kolumbus auf dieser Insel. Er war zum zweiten Mal unterwegs in den Weiten Westindiens, wie er diese von ihm entdeckte Weltecke nannte. Starrköpfig blieb er stets seiner Auffassung treu, dass er Indien durch die Hintertür betreten habe, auf dem von ihm berechneten Westkurs über die See. Was er durch eifriges Karten- und Notizenstudium erfahren hatte, nämlich dass die Erde eine Kugel ist und deshalb der weite Umweg um Südafrika herum nicht erforderlich, um in das sagenhaft reiche Land Indien zu gelangen, das fand er sogar bestätigt beim Propheten Jesaja. Ja, Kolumbus stützte sich nicht nur auf die Fachleute Marinus, Ptolemäus und Toscanelli. Der Prophet von anno dazumal war ihm genauso wichtig. Hatte der doch gesagt: Die Welt ist zu sechs Teilen Trockenland und zu einem Teil Meer. Deshalb war Kolumbus sicher, keine allzu lange Seereise machen zu müssen, um mit Westkurs auf Indien zu stoßen. Er blieb bei seiner Meinung, er habe vorgelagerte Inseln des sagenhaft reichen Kontinents Indien betreten. Den Touristen von heute bescherte er damit tatsächlich Reichtum, nämlich ein Stückchen spanisches Amerika.
Imponierend genug sind sie, diese gewaltigen Befestigungsanlagen, das Fort San Christobal und das Castillo de San Felipe El Norro. Stolze Reste des spanischen Weltreichs von anno dazumal. Wenn uns die übrig gebliebenen Geschütze auch als putzige Kanönchen vorkommen. Sie haben viele Eroberungsversuche unmöglich gemacht. Jede Zeit hat ihr eigenes Format, damit müssen sich unsere von der Moderne geweiteten Augen abfinden.
Die Straßen der Hauptstadt San Juan, jetzt voll von großstädtischem Autoverkehr, sind immer noch enge Schluchten zwischen Häusern mit streng geschlossenen Gesichtern. Überall Erker und Balkone mit kunstvollen schmiedeeisernen Gittern. So hinter Gittern durften die Frauen und Töchter der spanischen Eroberer sitzen und dem Leben zuschauen, wohl behütet vor der Welt. Sie wurden nicht gefragt, ob ihnen das gefällt.
Auch als Tourist auf Kurzbesuch bekam ich wie durch eiserne Gitterstäbe nur schmale Ausschnitte des Lebens zu sehen. Dort amerikanisch protzige Hotelkästen, hier ein Hilton-Hotel, das nur eines von vieren war, womit San Juan die Großstädte Berlin und Kairo ausstach. Und das Darlington-Hotel, das an meinem Erkundungsweg stand, sollte mit seinen dreißig Stockwerken sogar das höchste Gebäude Westindiens sein. So verriet San Juan sich als Ausflugsziel der US-Bürger. Dass es an Sonn- und Feiertagen nachmittags auch Stierkampfveranstaltungen gab, typisch spanisch, obwohl die Stiere nicht getötet wurden, kriegte ich nur als Information mit. Genauso den Namen der Ureinwohner dieser Insel, der Arawaks. Sie wurden von den spanischen Kolonisten, die unter der Führung von Juan Ponce de Leon im Jahre 1508 auf die Insel kamen und sie zu einer spanischen Festung ausbauten, gnadenlos ausgerottet.
Erst 390 Jahre später, im Jahre 1898, im spanischamerikanischen Krieg, wurde die Festungsstadt San Juan von den Amerikanern erobert. 1916 bekamen die Puertoricaner, diese Nachkommen von Arawaks und Spaniern und ihren afrikanischen Sklaven, sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sehr großzügig. Wer von ihnen sich jedoch verleiten lässt, in eine der US-Großstädte auszuwandern, der gehört dann zu einer der ärmsten und am geringsten geachteten Minderheiten in den USA, wie mir bei einem einmonatigen Aufenthalt in New York aufgefallen war. Sein Schicksal ist dort meist weitaus härter als das der Puertoricaner, die auf ihrer Insel bleiben. Die Daheimgebliebenen können wenigstens das milde Klima ihrer Insel genießen, wie sie da auf Bänken und Mäuerchen sitzen, unter Schatten spendenden Bäumen, und Domino spielen.
Eine von den kleinen, oft übersehenen Touristen-Attraktionen, die ich genossen habe. Dafür musste ich auf größere Attraktionen verzichten, wie auf den Besuch der Bacardi-Rum-Destillerie oder die Fahrt in den El-Yunque-Regenwald in den Luquillo-Bergen. Ein Rest von tropischem Urwald, mit feuchter Bruthitze und kurzen, heftigen Regenfällen, die einen in jeder Stunde mehrmals überraschen können.
Ich habe mich ein wenig auf unserem Schiff umgesehen, mit dem Informationsheft der Schwarzmeer-Reederei in der Hand. Neun Decks hat das Schiff, was schon Hochhausformat ist, 176 Meter lang ist es und fast 24 Meter breit. Ein 20 000-Tonnen-Schiff mit 350 Mann Besatzung, die weitgehend aus jungen Frauen besteht. Weitere Attraktionen sind der Swimmingpool und zwei Bibliotheken, das Kino und die Läden, die zwei Friseurbetriebe für Damen und Herren, der Souvenirshop, der Fotokiosk und die Schneiderwerkstatt, aber für den täglichen Bedarf vor allem die drei Restaurants, die fünf Bars und drei Musikkapellen, außerdem zig Liegestühle. Das ist es, was der Winterurlauber braucht neben dem Sonnenbaden, Sonnenbaden, Sonnenbaden. Immer mal wieder sich im Meerwasserbecken abkühlen, dann Tischtennis spielen oder Schach, Skat, Bingo, Volleyball, Shuffleboard. Und alle paar Stunden ein neues Tischlein-Deck-Dich-Erlebnis in mehreren Gängen. Am Abend dann Musik und Tanz. Für die Unermüdlichen in der Ukraine-Bar sogar bis halb fünf. So kurz zusammengefasst das Leben auf dem von der Firma N-U-R gecharterten russischen Passagierschiff Taras Shevchenko, das – natürlich linientreu – nur eine einzige Klasse führt: Alles steht jedem zur Verfügung, wenn auch die Kabinen unterschiedlich groß und teuer sind.
Zwei Dieselmotoren mit zusammen 21 000 Pferdestärken konnten das Schiff auf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten bringen, rund 38 km/h. Die Taras Shevchenko war eins von fünf Schiffen der sogenannten Schriftsteller-Klasse, die Mitte der sechziger Jahre in der DDR gebaut worden waren, in Wismar. Die anderen vier heißen: Ivan Franko, Aleksandr Pushkin, Shota Rustaveli und Mikhail Lermontov.
Schnell war klar: Der besondere Reiz dieser Reise lag, abgesehen von dem Reiseziel Karibik, in dem Nebeneinander der Nationalitäten: Deutsche, bedient von Russen. Also von Menschen aus der anderen Welt, aus der verschlossenen Welt hinter dem Eisernen Vorhang. Für uns so fern und unzugänglich wie der Mond. Bewohner der Sowjetunion, die wie Gefangene ihres Staates eingesperrt waren. Einige Hundert von diesen Menschen waren auf unserem Schiff leibhaftig zu sehen. Das war wie ein Wunder. Schweigsame Menschen, wenn nicht sogar verschwiegene, das war mein erster Eindruck von diesen Männern, Frauen und Mädchen. Sie sagten nichts, einfach überhaupt nichts. Und sie lachten nicht. Kein Kichern, kein Singen, kein Pfeifen, kein Seufzer oder munterer Zuruf, nichts. Auch keine unnötige Bewegung. Alle so proper in der Erscheinung, wie aus einem Werbefilm ausgeschnittene Figuren, schön, aber überlegen stumm. Selbst die hübschen Mädchen in ihren spitzenverzierten weißen Blusen hinter der Bar, sie machten mich verlegen mit dieser Abgehobenheit, in der sie meine Bestellung annahmen, und der kühlen Perfektion, mit der sie mich bedienten. Ich kam mir vor wie aus meiner Welt gefallen. Und irgendwo auf einem anderen Stern gelandet.
Wir Touristen waren auf diesem Schiff die Römer der Spätzeit, bunt aufgemacht und mit falschen Haarschöpfen, an die Theke gefesselt, dem Genuss verfallen. Die Russinnen würdigten den halbtrunkenen Gast keines Blickes. Sie taten ihre Pflicht in einer maschinenmäßigen Gleichförmigkeit. Eine sonderbare Pflicht, der sie gehorchten. Zur Förderung des Sozialismus verwöhnten sie die der Verwöhnung durch das Geld verfallenen Westmenschen, die Knechte des Kapitals. Manche Gäste waren so feinfühlig, dass ihnen die unverbindlich freundliche Unterkühltheit des Personals auffiel. In ihren Gesprächen kam als Erklärung immer wieder der Begriff Scheu vor. Was mir zu kurz gegriffen erschien. Lag doch auf der Hand, dass das russische Personal dieses Schiffs aus ideologisch intensiv geschulten und kritisch ausgewählten Mustermenschen des Sozialismus bestand. Personifizierte Visitenkarten, die in einer großen Show die Überlegenheit des Kommunismus vorzuführen hatten.
Wir Passagiere waren verwirrt von der ungewöhnlichen Paarung: Ein typisch privatkapitalistisches Unternehmen hat sich mit einem kommunistischen Staatsunternehmen zusammengetan. Und dabei kam ausgerechnet eine Amerikareise heraus. Irritierend, dabei doch so passend. Das Geld war der gemeinsame Nenner. Oder das Gold, von dem Christoph Kolumbus träumte, redete und schrieb.
Kolumbus hätte also Verständnis für die west-östliche Mesalliance gehabt, die wir gerade mit dieser Schiffsreise erlebten.
Vom Reiseleiter erfuhr ich, dass es im ersten Jahr dieser Karibik-Rundreisen größere Schwierigkeiten gegeben habe. 1967, auf der ersten Fahrt, wollten einige Inseln für ein russisches Schiff nicht ihre Häfen öffnen. Da mussten Ausweichhäfen gesucht werden. Die Ziererei hat sich aber bald gelegt. Man verstand: Das russische Schiff bringt deutsche Leute mit Geld, und das ist entscheidend. Zudem war es günstiger zu chartern als jedes vergleichbare Schiff von westlichen Reedereien. Nicht zuletzt weil die 350 Männer, Frauen und Mädchen aus der Sowjetunion nicht so hohe Löhne bezogen wie bei uns. Dabei verstand kaum einer von ihnen Deutsch. Aber sie waren auch noch nicht so raffiniert wie die Leute in Ländern mit langer Tourismustradition. Das war ein Erlebnis, über das die Passagiere gerne sprachen.
»Man hat hier keinen Augenblick das Gefühl, übers Ohr gehauen zu werden. Wechselgeld kann man unbesehen einstecken, weil es immer stimmt.«
»Hier wird man auch nicht schief angeguckt, wenn man an der Bar nur ein Selters bestellt, weil man noch vom Vorabend verkatert ist. Ist doch alles so verdammt billig, dass man viel zu viel in sich hineinschüttet. Kostet ja nicht den Führerschein.«
Was auch auffiel: Unser Schiff fuhr ohne jeden Flaggenschmuck, sogar ohne die Fahne der Schwarzmeerreederei, der es gehörte. Keine Nationalitätsflagge und keine Flagge der Heimatstadt des Schiffs, Odessa. Das heißt, wir fuhren in Piratenmanier durch fremde Hoheitsgebiete. Was ein besonderes Gefühl von Abenteuerlichkeit gab. Es war lediglich ein breiter roter Streifen rund um den Schornstein gemalt, der an beiden Seiten ein riesiges Hammer- und Sichel-Zeichen als gelbes Neontransparent trug. Und der Name des ukrainischen Dichters Taras Shevchenko in großen lateinischen und kyrillischen Buchstaben an den Schiffsflanken.
Deshalb hier ein paar Zeilen zu diesem Mann und seiner Bedeutung. Als Dichter und als Maler ist er für die Ukrainer so was wie Goethe für uns: der Nationalheros. Dabei hat er ein viel schwereres und auch viel kürzeres Leben durchlitten. Taras Grigorjewitsch Shevchenko, 1814 in der Ukraine in einem Dorf nahe Kiew geboren, schon mit elf Jahren Vollwaise, wurde nur 47 Jahre alt. Von dieser kurzen Lebenszeit hat er 24 Jahre in der Leibeigenschaft verbracht und mehr als zehn Jahre als Verbannter in der asiatischen Steppe. Er war einer der vielen Tausend Prügelknaben des zaristischen Russlands. Bei uns so gut wie unbekannt, aber in seiner Heimat unvergessen. In der Bordbibliothek fand ich bloß ein einziges übersetztes Buch von ihm. Kobzar, eine Sammlung von Liedern und Balladen, voller Freiheitsdurst und Begeisterung für seine ukrainische Heimat.
Doch zurück zu »seinem Schiff«: Heute war um viertel nach sieben Sonnenaufgang. Wir waren halt sehr weit im Westen. Schnell mal den frühen Vogel machen. Die Decks glänzten vom Schrubben. Auf dem obersten Deck machte einer der Offiziere seinen Frühsport. In den Meer- und Ölgeruch mischten sich erregende Düfte, die meine Schritte beschleunigten: Backbord roch es nach Kuchen, steuerbord nach Kaffee. Der Swimmingpool war schon vor der Frühstückszeit gut besucht. Auf dem Sportdeck legte sich gerade ein früher Gast in einen Liegestuhl, noch bevor die Sonne diesen Fleck erreichen konnte. Fünf weitere Liegestühle neben sich hatte er mit Handtüchern als sein Privatgelände markiert. Nach zehn Uhr sah ich, dass immer noch Liegestühle zu haben waren. Das wird der Sowjetunion mindestens so viel Sympathie eingebracht haben wie eine gelungene Mondlandung. Offenbar wusste man auch hinter dem Eisernen Vorhang: Auf Konsumbürger gerichtete Öffentlichkeitsarbeit muss konsumorientiert sein. Habe ich doch gesehen und gehört, wie Passagiere sich über die bescheidenen 60 Pfennige gefreut haben, die ein doppelstöckiger Wodka an der Bar kostete. Ganz klar, ein Klarer zum politischen Werbepreis. Mir war viel interessanter, dass die Bedienung noch mit dem Abakus in der Hand mit uns abrechnete, mit dieser wohl dreitausend Jahre alten Rechenhilfe, auf der zum Addieren und Subtrahieren Kugeln hin und her geschoben werden, und das mit einer Geschwindigkeit, die einen schwindelig werden lässt.
Als Christoph Kolumbus am 3. März 1492 zu seiner ersten Reise nach Westindien startete, hatte er nicht so ein 20 000-Tonnen-Schiff zur Verfügung. Was ihm die spanischen Majestäten Ferdinand und Isabella nach jahrelangem Ablehnen und Hinhalten endlich an die Hand gegeben hatten, das waren drei kleine Schiffe: eine Nao und zwei Karavellen. Die Nao Santa Maria wurde sein Flaggschiff, obwohl er dieses 100-Tonnen-Boot für zu groß hielt. Nicht geeignet für Erkundungszwecke, weil zu langsam und zu schwerfällig und mit zu viel Tiefgang für die Suche nach Landemöglichkeit in flachen Küstengewässern. Doch hatte sie den Vorteil, dass sie sehr geräumig war und fünfzig Mann Besatzung aufnehmen konnte. Wesentlich schneller waren die beiden Karavellen Pinta und Niña mit ihren jeweils nur 60 Tonnen und 31 beziehungsweise 27 Mann Besatzung. Eigentlich unverständlich, wie zögerlich und wie knickerig das spanische Königspaar Isabella I. und Ferdinand II. sich gezeigt hatte. Gehörte zum Ziel der geplanten Exkursion doch nicht bloß die Erkundung eines neuen Seewegs, sondern auch Landnahme und damit der direkte Zugriff Spaniens auf die sagenhaften Goldschätze Indiens, daneben auch auf den damals noch goldwerten tiefblauen Farbstoff aus der indischen Indigopflanze sowie neue exotische Gewürze. Aber der Italiener Kolumbus war Ausländer und allein damit für Spanier schon eine Zumutung, sowohl für das spanische Königspaar als auch für die spanischen Schiffsbesatzungen, wie Kolumbus immer wieder zu spüren bekam.
Die weißen Segel der kleinen Entdeckerflotte waren mit dem christlichen Kreuzzeichen bemalt, also ideologisch gerüstet, wie jetzt unser Schiff mit Hammer und Sichel als Neontransparent. Eine bunt gemischte Schar, bis auf Kolumbus und vier andere Männer sämtlich Spanier. Ohne Uniformen. Privatleute wie wir. Zu ihnen gehörten aber auch Ärzte und ein Maler, ein Polizeioberst und zwei königliche Beamte, die als Aufseher über die Ausgaben und die zu erwartenden gewaltigen Gewinnanteile der Krone zu wachen hatten, unterstützt von einem Protokollführer für die offizielle Inbesitznahme neuer Länder im Namen der Katholischen Majestäten. Dazu kam noch ein Dolmetscher für Arabisch. Denn Arabisch hielt man damals für die Mutter aller fremden Sprachen. Der gute Mann konnte sich nicht nützlich machen. Hatte Kolumbus auf dieser ersten Reise doch die Bahamas und Kuba und Haiti entdeckt, wo kein Mensch ein Wort Arabisch beherrschte.
Ein wenig südlicher hielt Kolumbus sich auf der zweiten Reise, die ihn unter anderem nach Puerto Rico und nach Jamaika führte. Auf dieser Fahrt vom 25. September 1493 bis zum 11. Juni 1496 befehligte Kolumbus schon eine Flotte von 17 Schiffen mit insgesamt fast 1500 Menschen. An der Insel Puerto Rico hatte Kolumbus so wenig Interesse, dass er sich nicht einmal die Mühe machte, einen Landeplatz zu suchen. Er ließ seine Flotte einen Tag lang vor der Küste anhalten, schickte zur Erkundung einen Teil seiner Männer mit Booten an Land und begnügte sich im Übrigen damit, der Insel den schönen Namen St. Johannes zu geben.
Der mitreisende Arzt Doktor Chanca beschrieb in seinem Reisebericht die neu entdeckte Insel so: »Dies ist eine prachtvolle Insel, und sie scheint fruchtbar zu sein. Die Kariben suchen sie oft heim, um die Eingeborenen zu unterwerfen. Meistens schleppen sie viel Volk fort. Die Bewohner dieser Insel besitzen weder Boote noch die geringsten Schifffahrt-Kenntnisse. Aber nach den Angaben unserer Gefangenen benutzen sie ebenso wie die Kariben Bogen. Gelingt es ihnen zufällig, bei einem auf sie gerichteten Angriff einige der Eindringlinge gefangen zu nehmen, dann fressen sie diese ebenso auf, wie die Kariben sie im entgegengesetzten Falle verzehren würden.«
Da haben wir sie schriftlich, die alte Mär von den Menschenfressern in der Karibik. Kolumbus war gerade zu der Zeit dort umhergesegelt, als die auf den Inseln schon länger als zweitausend Jahre ansässigen Arawaks sich gegen den wachsenden Zustrom der Karaiben oder Kariben wehrten, die vom südamerikanischen Festland herüberkamen. Den Namen Kariben verstand Kolumbus als Kaniben, und die waren ihm aus dem Bericht des Marco Polo als Völker des Großkhans bekannt. Kolumbus hatte damit einen weiteren »Beweis« dafür, dass er Indien erreicht hatte. Und wir bekamen damit die menschenfressenden Kariben als Kannibalen serviert.