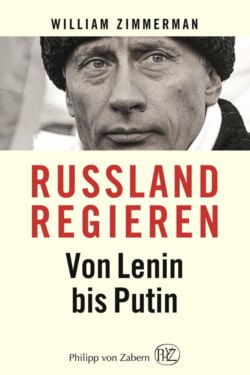Читать книгу Russland regieren - William Zimmerman - Страница 8
|50|2. Alternative Mobilisierungsstrategien, 1917–1934
ОглавлениеStaaten unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, Bürger für ihre Zwecke zu mobilisieren. In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit den sowjetischen Bemühungen um Mobilisierung der eigenen Bürger in den Jahrzehnten vor dem Großen Terror.
Im Anschluss an die Oktoberrevolution ging es vor allem darum, Bauern für die Rote Arbeiter- und Bauernarmee (RKKA) zu gewinnen und die städtische Bevölkerung für eigene Zwecke zu rekrutieren. In den 1920er-Jahren folgte die Neue Ökonomische Politik (NÖP), in der das Regime seine Macht konsolidierte. Damals glich das Regime noch anderen normalen oder „voll“1 autoritären Staaten und war keines, das im Sinne von Jowitts „Kampfaufgabe“2 auf Mobilisierung und Veränderung setzte. Darauf folgte jedoch eine Phase, während der sich auf dem Land die Schrecken der Kollektivierung manifestierten und in den Städten die Parteidoktrin faktisch alle beruflichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Kreise durchdrang.
Die Geschichte des Bauernwiderstands gegen die Politik der Bolschewiki ist umfassend dokumentiert. Diese Politik führte u.a. zu einer galoppierenden Inflation, die noch durch die bolschewistische Idee verschärft wurde, Geld könne als Zahlungsmittel abgeschafft werden, sowie zu einem Mangel an Konsumgütern, der wiederum die Tendenz der Bauern verstärkte, Getreide zu horten.
Anders als Mao und Tito, die zunächst auf dem Land die Macht ergriffen und dann in die Städte vordrangen, waren die Bolschewiki in den Städten an die Macht gelangt und versuchten nun, ihren Einfluss auszuweiten. Sechs Monate nach der Machtergreifung war Jakow Swerdlows Beobachtung, „die revolutionäre Sowjetmacht [sei] in den Städten stark genug“, zwar übertrieben, mit seiner Einschätzung, „dasselbe könne man nicht von den Dörfern behaupten“, lag er jedoch genau richtig. Um Abhilfe zu schaffen, machten sich die Bolschewiki daran, „das Dorf in zwei unversöhnliche feindliche Lager“ zu spalten, „um dort |51|einen Bürgerkrieg … zu entfachen“.3 Dies geschah auf dreierlei Weise: durch die Einrichtung von Dorfkomitees der Armen (kombedy), durch die Entsendung von „Beschaffungstrupps“ aus bewaffneten Arbeitern, die in den Dörfern das Staatsmonopol auf den Getreidehandel durchsetzten, und durch den Einsatz der neu gegründeten Roten Armee.
Tatsächlich entfachten die Bolschewiki mit diesen drei Mitteln nicht nur einen, sondern gleich mehrere Bürgerkriege: Da war zum einen der Krieg der Weißen gegen die Roten, den – so heißt es gewöhnlich – die Roten gewannen, weil die Bauern die Weißen noch weniger leiden konnten und die Rückkehr der Gutsbesitzer fürchteten. Und da war zum anderen der Krieg der Roten gegen die Grünen, gegen die Bauern. Beide hinterließen – im Zusammenspiel mit den verschiedenen ausländischen Interventionen – bleibende Spuren in der russischen Gesellschaft.
Die Zusammenstöße zwischen Grünen und Roten fanden häufig in Form eines Guerillakriegs statt, wobei die Grünen Wälder als Schutzschilde nutzten und Beschaffungstrupps der städtischen Arbeiter sowie die Rote Armee aus dem Hinterhalt überfielen. Die Roten verfolgten mit ihrem Kampf die Beschlagnahmung von Getreide und den Aufbau der Sowjetmacht auf dem Land sowie allgemeiner die Einschüchterung der Bürger. Während sie mit ihrem ersten Ziel, der Zwangseintreibung von Getreide, weniger erfolgreich waren, gelang es den Bolschewiki trotz ihrer lange untergeordneten Rolle außerhalb der großen Städte, regionale Regierungen einzusetzen. Insgesamt stellte nach Einschätzung von Vladimir Brovkin und Robert Conquest „das Ausmaß des bolschewistischen Krieges gegen die Bauern [die Grünen] im Innern den Frontkrieg gegen die Weißen bei Weitem in Schatten“.4
Zwar ist dies ein weitgehend unerforschtes Thema, doch einige der größten Aufstände – der Bauernaufstand von Tambow ist das bekannteste Beispiel5 – und der Großteil des organisierten Widerstands gegen bolschewistische Einfälle auf dem Land sind eingehend untersucht worden. Unstrittig ist, dass der für die Bauern typische passive Widerstand – das Verstecken von Getreide, verminderter Anbau und so weiter – weitreichend war. Außerdem kam es zu zahlreichen lokalen Bauernaufständen (bunty), die häufig die Entsendung von „Strafkommandos“ zur Folge hatten.6 Brovkin zitiert amerikanische Geheimdienstquellen: „[D]ie Landbevölkerung der Bezirke Nowgorod, Petrograd und Twer hat vor Kurzem eine riesige Bewegung organisiert. In den meisten Bezirken sind die Bauern gut bewaffnet und besitzen sogar eine Kanone [sic], Maschinengewehre |52|und Handgranaten.“7 Ähnlich zitiert Brovkin kommunistische Quellen, denen zufolge im zentralrussischen Twer 50.000 und in Rjasan fast 55.000 grüne Rebellen festgenommen worden seien.8 Das Problem besteht darin, wie Brovkin feststellt, dass wir nicht wissen, wie verbreitet solche Vorkommnisse waren. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Lenins Anstrengungen, die Dorfbewohner gegeneinander und gegen die bewaffneten Arbeiter aufzubringen bzw. die Rote Armee gegen die Dörfer aufzuhetzen, nur bedingt erfolgreich waren.
Unstrittig ist auch, dass die Gewalt auf beiden Seiten erschreckend war – wie es in Bürgerkriegen oft der Fall ist. Lenin bestand auf Geiselnahmen, einer Maßnahme, die in den Roten Terror überging, in dem die Tscheka fast ohne Kontrolle agierte. Als Reaktion auf einen Aufstand in Pensa forderte Lenin, dieser müsse „gnadenlos unterdrückt“ werden:
„1. nicht weniger als 100 bekannte Kulaken, reiche Männer, Blutsauger unbedingt hängen, damit die Leute das sehen
2. ihre Namen veröffentlichen
3. ihnen alles Getreide wegnehmen
4. Geiseln bestimmen – siehe gestriges Telegramm“9
Anatoli Lunatscharski informierte Lenin über die Urenskoje-Affäre in Kostroma, die „ein einziger Albtraum [gewesen sei]. Ihr Ende war schrecklich. Die Bauern töteten 24 unserer Genossen bzw. ließen sie erfrieren oder verbrannten sie bei lebendigem Leib, nachdem sie sie schrecklichen Foltern unterzogen hatten.“ „Doch“, so fügt Lunatscharski in wahrscheinlich ungewollter Untertreibung hinzu, „bin ich mir nicht ganz sicher, dass einzig die Bauern die Schuld tragen … es begann mit einem Maschinengewehrfeuer auf sie.“10
Die vielleicht aufschlussreichsten Informationen über den begrenzten politischen Einfluss des Regimes betreffen jene Russen, die zugleich Bauern und Zwangsrekrutierte waren. Wenn auch die Verpflichtung der Bauern, Getreide an die Städte abzutreten, nur mäßig erfolgreich war, lohnt es sich doch, den Erfolg der Bolschewiki bei der Rekrutierung von Steuereintreibern zu untersuchen, die ebenfalls überwiegend Bauern waren.
Im Folgenden schildere ich die Entwicklung der RKKA, die in verschiedener Hinsicht und vor allem dank Trotzkis Bemühungen eine große Leistung war. Dabei handelt es sich indes nicht um eine reine Erfolgsgeschichte. Ein erheblicher Teil der Männer, die zum Militär eingezogen, gedrängt oder gezwungen worden waren, desertierte. Laut |53|Schätzungen führender westlicher Historiker wie John Erickson und Mark von Hagen liegt die Zahl derer, die entkamen, bei einer Million oder mehr. Das beeinträchtigte erheblich die Umgestaltung dessen, was unmittelbar nach der Revolution die Streitkräfte waren und sich rasch zur RKKA entwickelte.
Dennoch kann man durchaus von einer Umgestaltung sprechen. Die Aufgaben der Sowjet-Armee in der Zeit von 1919 bis 1920 unterschieden sich weitgehend von jenen, die sie unmittelbar nach der Machtergreifung der Bolschewiki in Petrograd wahrnahm. Armeen sind normalerweise disziplinierte und hierarchische Organisationen, doch die Bolschewiki setzten anfangs ihre Politik aus der Zeit vor der Machtergreifung fort, eine Politik, welche die Spaltung einer ohnehin in Auflösung begriffenen Armee noch verschärfen sollte. Merle Fainsod11 bringt das Ergebnis auf den Punkt: „Der … Traum von einem egalitären Volksheer beherrschte die Köpfe der bolschewistischen Führung und bestimmte den Inhalt der ersten Dekrete über die Armee. Dem Befehl vom 29. Dezember 1917, der die militärischen Ränge und Titel abschaffte, folgte das Dekret des Rats der Volkskommissare vom 12. Januar 1918,12 das die Bildung einer sozialistischen Armee proklamierte, die ‚von unten auf den Grundsätzen der Offizierswahl und der gegenseitigen kameradschaftlichen Disziplin und Achtung aufgebaut werden sollte.‘“
Diese Maßnahmen dienten einem konkreten Ziel: die Truppenloyalität gegenüber einer Regierung zu verbessern, die den Anspruch hatte, die Arbeiter in einem Land zu repräsentieren, das zu drei Vierteln aus Bauern bestand. Das gelang den Bolschewiki zunächst, indem sie nur Soldaten aus der städtischen Arbeiterklasse rekrutierten und eine Art Loyalitätsbeweis verlangten in Form einer Empfehlung durch eine Parteiorganisation, eine Gewerkschaft oder „demokratische Organisationen, die auf der Plattform der Sowjetmacht stehen“.13 Doch für eine Armee, die zunächst aus Freiwilligen bestand, war dies von geringem Wert. Sicherlich gingen manche aus Gründen zum Militär, die mit den Zielen des Regimes vereinbar waren. Doch wie Trotzki beobachtete, waren „die meisten von denen, die sich meldeten, Vagabunden übelster Art“.14
Eine Kehrtwende hin zur Schaffung einer konventionelleren Armee zeichnete sich erst mit der Ernennung Trotzkis zum Volkskommissar für Krieg im März 1918 ab, auch wenn der 23. Februar 1918 offiziell als |54|Gründungsdatum der Roten Arbeiter- und Bauernarmee gilt. Im April wurde die Wehrpflicht eingeführt, die sich in den folgenden Monaten über alle Alters- und Klassenkohorten hinweg auswirkte. Eine Armee, die im Mai 1918 noch nur ungefähr 300.000 Mann zählte, war am 1. Januar 1920 auf drei Millionen angewachsen und im Laufe desselben Jahres auf über fünf Millionen, wenngleich die Zahlen in gewissem Maße fiktiv sind und die Einheiten bunt zusammengewürfelte Haufen waren: „Lettische Grenadiers, bolschewistische Matrosen, Arbeiter aus Moskau, Petrograd und dem Ural, Freiwillige aus dem alten kaiserlichen Heer, ehemalige Kriegsgefangene und Bauern, die sich in lokalen Milizeinheiten durchmischten, sie alle tummelten sich im Zentrum oder über die Provinzen verteilt oder wurden erneut in herumstolzierende Mini-‚Armeen‘ eingeteilt.“15 Darüber hinaus ergriff Trotzki Maßnahmen, um Entscheidungsprozesse zu zentralisieren, ehemalige zaristische Offiziere und Unteroffiziere in Kommandostrukturen einzugliedern, die Disziplin herzustellen und die gewöhnlichen Soldaten für einfache, aber wesentliche Aufgaben zu schulen, die Soldaten in einer großen schlagkräftigen Massenarmee zu erfüllen haben.
Mit den Dekreten vom 21. März und 22. April 1918 wurde die Wahl von Offizieren eingestellt und die Todesstrafe wieder eingeführt.16 Fast 50.000 ehemalige Offiziere, die schönfärberisch als „Militärspezialisten“ bezeichnet wurden, schlossen sich im Laufe des Bürgerkriegs der Roten Armee an. Zwei Maßnahmen dienten dazu, sich ihrer Loyalität zu versichern. Dies war zum einen die Einrichtung eines Systems politischer Kommissare, die – wie Trotzki es ausdrückte – neben den Spezialisten stehen sollten, „einer zur Rechten und einer zur Linken mit dem Revolver in der Hand“.17 Zum anderen wurden die Familien der Militärspezialisten als Geiseln genommen, wobei man ihnen „sofortige Verhaftung“ androhte. Wenn Offiziere die Bolschewiki verrieten, so Trotzki, sollten sie wissen, dass sie „gleichzeitig Mitglieder ihrer eigenen Familien“18 verrieten.
Die Rolle der Militärspezialisten in der neuen Armee rief unter vielen Bolschewiki, insbesondere unter bolschewistischen Soldaten, scharfe Kritik hervor. Skepsis war in gewissem Maße berechtigt, da – wie Trotzki erkannte – viele der ehemaligen zaristischen Offiziere zu den Weißen übergelaufen waren.19 Im Allgemeinen fügten sich die Offiziere jedoch der neuen Realität. Die Verwendung von Militärspezialisten auf Schlüsselpositionen jetzt zu verwerfen, wäre genauso kontraproduktiv, bekräftigte |55|abermals Trotzki, „als wollte man alle Eisenbahningenieure wegjagen, … weil es unter ihnen ein paar Saboteure gibt“.20
Der vielleicht wichtigste Faktor beim Übergang zu einer konventionellen Armee waren jedoch Trotzkis entschlossene Bemühungen: „Jede Armee-Einheit muss regelmäßig ihre Rationen bekommen, Lebensmittel dürfen nicht dem Verderb ausgesetzt werden, und das Essen muss ordentlich gekocht sein. Wir müssen unseren Soldaten persönliche Sauberkeit beibringen und darauf sehen, dass sie Ungeziefer vertilgen. Sie müssen ihr Ausbildungspensum richtig lernen und es so oft wie möglich im Freien üben. Wir müssen sie lehren, ihre politischen Reden kurz und verständlich zu halten, ihre Gewehre zu putzen und ihre Stiefel einzufetten … Das ist unser Programm [für die nächste Zeit].“21 Craig Nation weist zu Recht mit Trotzki darauf hin, dass die Ambitionen der RKKA „deutlich erkennbar blieben“ und insofern unverwässert, als sie „durch die Präsenz einer moralischen Idee definiert [waren] – daher siegreich“.22 Dennoch bedeutete dies „eine Rückkehr zur Normalität“,23 da „das Schlachtfeld“ von der Roten Armee Maßnahmen verlangte, „die denen ihrer Feinde ähnelten“.24
Der Erfolg blieb nicht aus. Innerhalb nur eines Jahres „hatte eine besiegte Nation, die man am Ende ihrer Kräfte glaubte, eine Massenarmee mobilisiert, ihr eine qualifizierte Führung verschafft und erfolgreich eine Vision ihrer Ziele entworfen. Es war eine Armee, die – wie die Ereignisse zeigen sollten – kämpfen und gewinnen konnte.“25 Diese positive Einschätzung ist jedoch in einen größeren Kontext zu stellen. Tatsächlich stand die neu gebildete Rote Armee vor vielfältigen Aufgaben, die sie mal besser, mal schlechter bewältigte. Die Ergebnisse ihrer Bemühungen, Lebensmittel auf dem Land zu beschaffen, um sich und die Städte zu versorgen, waren, wie wir gesehen haben, zweifelhaft und brachten zahllose Menschen eher dazu, zu desertieren, als ihr Leben dem Kampf zu opfern.
Für gewöhnlich liegt zudem die Kernaufgabe von Armeen im Schutz des Staates vor äußeren und inneren Bedrohungen. In der Situation eines zusammengebrochenen Imperiums waren 1919 gängige Vorstellungen von äußerer und innerer Bedrohung jedoch hinfällig geworden. Eine Liste der Länder, deren Truppen sich auf russischem Gebiet befanden, deutet die gewaltige Aufgabe an, vor der die Rote Armee stand. Zwischen November 1917 und März 1921 drohte wechselweise Gefahr von den Alliierten (Großbritannien, Frankreich und den USA), den Deutschen |56|(mit und ohne schwächere Verbündete), den Japanern, den Tschechoslowaken, den Polen und den Weißen.
Anfangs suchten die Bolschewiki die Unterstützung der Alliierten gegen die Deutschen. In einem Telegramm an den amerikanischen Botschafter vom 21. März 1918 erklärte Raymond Robin: „Telegramm aus Murmansk meldet, dass Engländer und Franzosen mit der Sowjetregierung beim Schutz von Häfen und Schienen auf ausdrückliche Anordnung von Moskau kooperieren.“26 Eine Bedrohung stellte die Kontrolle der Transsibirischen Eisenbahn durch die Tschechoslowaken dar – ein wichtiger Anstoß für die Entscheidung, die Armee in eine konventionelle Armee rückzuverwandeln. Pipes27 behauptet jedoch, „mehrere Hundert Tschechen“ seien mit den Briten in Murmansk gelandet, wo sie anfangs den Bolschewiki helfen wollten. Und während der deutsche Vormarsch nach dem Aussetzen der Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk die Oktoberrevolution anfangs bedrohte, spielten die Deutschen in der Folge eine nicht unwesentliche Rolle für den Machterhalt der Bolschewiki.
Neben ihrem Kampf gegen ausländische Streitkräfte, gegen die Weißen und die Grünen war die Rote Armee mit zahlreichen anderen Aufgaben beschäftigt. Trotzki hatte die Idee, Einheiten, die aus den Kampfgebieten abgezogen worden waren, dazu zu verpflichten, ihre Uniform weiterhin zu tragen und Aufgaben zu übernehmen „wie das Reparieren von Schienenbetten, den Transport von Treibstoff und das Reparieren von Landmaschinen“.28 Damit war sie freilich nicht die einzige Armee, die solche zivile Funktionen übernahm, wie sie insbesondere im Anschluss an Katastrophen anfallen – sei es infolge von Krieg, Aufständen oder Unwetter.
Die bolschewistische Führung sah eine sogar noch größere Rolle für die RKKA vor. Für sie war die Armee das Mittel, mit dem sich die Russische Revolution mit den Revolutionen in Ost- und Zentraleuropa verbinden ließ. In dieser Verbindung sahen sie anfangs eine unabdingbare Voraussetzung für ihren Machterhalt in Russland. Dass die Bolschewiki die Armee nicht nur für Verteidigungszwecke, sondern auch als Eingreiftruppe bei den Revolutionen in Europa verwenden wollten, unterstreicht auch Craig Nation.
Die Polen, die gewartet hatten, bis klar war, dass die Roten gegen die Weißen gewinnen würden, griffen 1920 die Sowjetrepublik Ukraine an. Anfangs konnte die Rote Armee erhebliche Erfolge verbuchen und den |57|Einfall der Polen abwehren. Die sowjetische Führung erkannte schnell, dass sie den russischen Nationalismus nutzen konnte, um Stimmung gegen äußere Bedrohungen zu machen. Nur drei Monate nach der Machtergreifung der Bolschewiki in Petrograd drängten Lenin und andere das russische Volk mit beachtlichem Erfolg, sich für ihre Sache zu engagieren: „Das sozialistische Vaterland ist in Gefahr!“
Wie indes die Ereignisse in Polen bewiesen, änderte sich die Situation schlagartig, als die Rote Armee, angetrieben von Slogans wie „Gebt uns Warschau!“, die polnische Armee nicht nur aus der Ukraine zurückdrängte, sondern weiter in polnische Gebiete vorrückte.29 Die RKKA sah sich bald in einer unhaltbaren Position, vor allem deshalb, weil die polnischen Arbeiter und Bauern die Armee als russisch-imperialistische Besatzer und nicht als Befreier und revolutionäre Wegbereiter begriffen, die einen Bogen zwischen der Revolution in Russland und der Revolution in Deutschland sowie möglicherweise in anderen Ländern Ostund Mitteleuropas schlagen würden. Dennoch hatte sich eine Rote Armee mit herkömmlichen hierarchischen und disziplinarischen Strukturen zusammen mit einer beträchtlichen Dosis revolutionärer Begeisterung und politischer Kontrolle als erfolgreich erwiesen und den Armeen europäischer Staaten wie Polen ebenbürtig, wenn sie auch noch nicht auf Augenhöhe mit den Armeen der europäischen Großmächte kämpfte. Wie andere Streitkräfte schlug sie sich allerdings in den Anfangsjahren der Sowjetmacht weitaus besser bei der Verteidigung des Mutter- respektive Vaterlandes als bei Eroberungsfeldzügen; das sollte sich später ändern.
Selbstverständlich war es in erster Linie das Militär, das mit ausländischen Interventionen, der Tschechoslowakischen Legion und den Weißen fertig werden musste. Schon früh wurde es aber auch damit betraut, Bauern zu unterdrücken und mit vorgehaltener Pistole Getreide zu requirieren, um die Städte zu ernähren. Die Armee, die Armenkomitees und andere bolschewistische Anhänger wurden auf das Land losgelassen. Ihre Gegner kämpften landesweit entschlossen zurück, allerdings mit begrenzter Feuerkraft und mangelnder Organisation. Pipes weist darauf hin, dass die Einführung der Wehrpflicht und Lenins Anweisungen, das Kriegskommissariat in Militärisches Versorgungskommissariat umzubenennen, am selben Tag erfolgten. Lenins vordringlicher Grund für diese Namensänderung war, dass „neun Zehntel der Arbeit des Kriegskommissariats sich darauf konzentrieren [sollten], die Armee auf den Krieg um Brot einzustellen und einen solchen Krieg über drei Monate, von Juni bis August, zu führen“.30 Die Bolschewiki erweiterten aber nicht nur die Aufgaben des Militärs, vielmehr ging es ihnen darum, die gesamte Gesellschaft zu militarisieren.
Es wird gern behauptet, der Kriegskommunismus sei eine Reaktion auf den Bürgerkrieg und ausländische Interventionen gewesen. Das früheste Dekret (29. November 1917) zur Rolle der Arbeit hatte tatsächlich noch einen ausgesprochen syndikalistischen Einschlag und sah Arbeiterkontrollen vor – eine Einrichtung, die unter anderem das Recht der „Organe der Arbeiterkontrolle“ bekräftigte, in den Fabriken „die Produktion zu überwachen, eine Mindestleistung festzulegen und die Produktionskosten zu bestimmen“. Die Kontrolle sollte von „[durch Arbeiter] gewählten Organisationen“31 ausgehen. Der Glaube an vollständiges Staatseigentum, an Planwirtschaft und an die ‚führende Rolle der Partei‘32 ging dem Bürgerkrieg voraus. Wie Paul Gregory anmerkt, fanden alle Verstaatlichungen 1917 vor Ausbruch des Bürgerkriegs statt, „das extremste Verstaatlichungsdekret wurde im November 1920 verabschiedet, nachdem der Bürgerkrieg weitgehend beendet war“.33 1920 waren die Weißen so gut wie besiegt. Zu diesem Zeitpunkt leiteten die Bolschewiki – vor allem, aber nicht nur Trotzki – die Maßnahmen ein, die zu einer Diktatur über das Proletariat – statt eines Diktatur des Proletariats – führten.34
Der Status der Fabrikarbeiter wandelte sich ähnlich wie der des Armeesoldaten und fand fast zeitgleich zu den Veränderungen im Militär statt, traf jedoch auf größeren Widerstand. Im Januar 1918 verloren die Fabrikkomitees einen Großteil dessen, was sie auf dem Ersten Gewerkschaftskongress im November 1917 errungen hatten.35 Im selben Monat gab das Regime „die Erklärung der Rechte des werktägigen und ausgebeuteten Volkes“ heraus, in der es „mit Blick auf die Zerstörung der parasitären Klassen der Gesellschaft und die Organisation der nationalen Wirtschaft“ hieß: „[D]er universelle Arbeitsdienst ist etabliert.“36 Dieser Erklärung folgte im Oktober ein Dekret, das verkündete: „[A]lle Bürger der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) … [mit einigen Ausnahmen] unterliegen der Pflichtarbeit.“ Was auf die Einberufung von Zivilisten herauslief, begann im November und Dezember 1918. Ganz ähnlich wie die Militärspezialisten wurden zivile Arbeiter und Techniker „für den Militärdienst mobilisiert und unterstanden dem Militärgericht“.37
|58|Pipes’ umfangreiche Liste verdient es, zitiert zu werden: „Die ersten Zivilisten, die ‚mobilisiert‘ wurden, waren Eisenbahner (28. November 1918). Weitere Kategorien folgten: … medizinisches Personal (20. Dezember 1918), Angestellte der Fluss- und Meeresflotten (15. März 1919), Bergarbeiter (7. April 1919), Angestellte der Post-, Telefon- und Telegrafenämter (5. Mai 1919), Arbeiter in der Kraftstoffindustrie (27. Juni 1919 und 8. November 1919), Arbeiter in der Wollindustrie (13. August 1920), Metallarbeiter (20. August 1920) und Elektriker (8. Oktober 1920).“38 Symbolisch für die Fusion von militärischem und zivilem Sektor übernahm der im März 1918 zum Kriegskommissar ernannte Trotzki im Dezember 1919 zusätzlich den Posten des Präsidenten einer Kommission zur Arbeitsorganisation. In einer solchen Situation verstand es sich von selbst, dass die Gewerkschaften nicht mehr Arbeiter gegen die Launen der Betriebsleitung verteidigten, wie es im Kapitalismus der Fall gewesen war. Vielmehr wurden sie immer mehr zum verlängerten Arm des Staates und blieben es in der gesamten sowjetischen Ära. Der junge sozialistische Staat, so Trotzki, „braucht Gewerkschaften nicht zum Kampf für bessere Arbeitsbedingungen – das ist Aufgabe der gesellschaftlichen und politischen Organisation insgesamt – sondern zur Organisation der Arbeiterklasse zum Zweck der Produktion … [Sie sollen] ihre Autorität Hand in Hand mit dem Staat ausüben, um die Arbeiter im Rahmen eines einzigen Wirtschaftsplans zu führen.“39
So schuf Trotzki, in der Regel gedeckt von Lenin, nicht nur eine Armee, die mit Blick auf Disziplin, Ordnung und Hierarchie viele Merkmale einer konventionellen Armee des frühen 20. Jahrhunderts aufwies, wenn auch mit vergleichsweise breitem Mandat selbst zu Kriegszeiten. Lenin und Trotzki – und nicht Stalin – waren es auch, die den Zivilsektor nach dem Muster der Roten Armee umgestalten wollten, wozu sie ebenfalls bürgerliche ‚Spezialisten‘ einführten. Fehlzeiten von Arbeitern sollten als Fahnenflucht gelten, die Aufgaben sollten von Moskau aus verteilt werden. Chamberlin beschreibt sehr schön, wie die kommunistischen Führer Anfang 1920 „noch nicht zum Eingeständnis bereit [gewesen seien], dass der Kriegskommunismus … nicht imstande war, das Land zur normalen Produktivität von Industrie und Landwirtschaft und zu erträglichen Lebensbedingungen zurückzuführen.“ Er zitiert das Zentralkomitee auf dem IX. Parteitag Anfang 1920, das „die Mobilisierung des industriellen Proletariats, eine Verpflichtung zum Arbeitsdienst, die Militarisierung des wirtschaftlichen Lebens |59|und den Einsatz von Militäreinheiten zu ökonomischen Zwecken“40 befürwortete.
Die repressiven Maßnahmen gegen Stadt- und Landbewohner lösten nicht unerhebliche Aufstände im ganzen Land aus, insbesondere als die Gefahr eines Siegs der Weißen gebannt war. Die Wirtschaft lag am Boden. Im Militär grassierte Fahnenflucht. Der bekannteste Bauernaufstand unter vielen fand 1920 statt und setzte sich 1921 fort. Die alarmierendsten Aktionen der Arbeiter waren aus bolschewistischer Sicht die Streiks in Petrograd im März 1921, die zu einer solidarischen Rebellion der Matrosen auf der Insel Kronstadt kurz vor Petrograd führten. Der Aufstand, der während des X. Parteitages stattfand, forderte ominöserweise „Sowjets ohne Kommunisten“. Er wurde brutal niedergeschlagen.
Ernst nahm Lenin den Aufstand dennoch, sah er das Regime doch in großer Gefahr. Das Ergebnis war die Neue Ökonomische Politik, die das Verhältnis zwischen Regime und Gesellschaft neu zu gestalten suchte und deren Kernpunkte das Ende der Getreidekonfiszierung, die Einführung einer „proportionalen Steuer auf Landwirtschaft“ sowie die Stabilisierung der Währung und die Legalisierung des freien Handels waren.41 Dies kam einem enormen Zugeständnis an die Bauern gleich und bedeutete einen deutlichen Rückzug aus dem Mobilisierungssystem, das die Bolschewiki angestrebt hatten. Zugleich kündigte es einen stärkeren Trend in Richtung eines geschlossenen politischen Systems an.
Die Neue Ökonomische Politik
Die NÖP lässt sich am besten als Waffenstillstand der Bolschewiki mit dem Kleinbürgertum (sprich hier den relativ begüterten Bauern) im Inland und einem vergleichbaren Waffenstillstand mit dem Großbürgertum im Ausland (siehe das anglo-russische Handelsabkommen, die Anerkennung von Atatürks Türkei und vice versa sowie geheime militärische Abkommen mit Deutschland) begreifen.42 Innenpolitisch ähnelten diese Verhältnisse sehr denen anderer autoritärer Regime. Vom stalinistischen Versuch, die gesamte Gesellschaft für den Kampfauftrag43 des Regimes einzuspannen, um den industrialisierten Westen einzuholen und zu überholen, unterschieden sie sich maßgeblich.
Im Hinblick auf das Gros der Gesellschaft – d.h. die Bauern – bedeutete diese spätere Politik Stalins „die Liquidierung der Kulaken als Klasse“, wie er es formulierte, sowie massive und rasche Kollektivierung. |60|Dem städtischen Arbeiter brachte sie zunächst den ersten Fünfjahresplan und dann den Fünfjahresplan, der bereits nach vier Jahren für erreicht erklärt wurde. Künstler und Wissenschaftler waren mit der Aufforderung zur „Kulturrevolution“ konfrontiert – ein Begriff, der nicht auf allen Gebieten der Wissenschaft und Fachausbildung greift. Er steht für die Anstrengungen des Systems, Parteidiktate über die verschiedensten Wissensgebiete von der Literatur bis zu Ichthyologie zu verhängen. Die Anfangsjahre dieser Bemühungen wurden als der Große Umbruch (Velikij Perelom) bezeichnet und brachten neben Repressionen eine nicht unerhebliche Förderung dessen mit sich, was vorsichtig als politischer Unternehmer zu bezeichnen ist. Hierbei handelte es sich um Menschen verschiedenster Provenienz, die oft aus Karrieregründen starke Anhänger der Umgestaltung bestimmter Bereiche der ländlichen und städtischen Sowjetgesellschaft waren.
Zu behaupten, wer im Auftrag der Sowjetmacht gehandelt habe, sei zunächst entweder Anhänger des Kriegskommunismus oder des NÖP gewesen, ist eine starke Vereinfachung. Diese Überspitzung macht jedoch eine zentrale Tatsache deutlich: War ein Bürger auf dem Land, ein Wissenschaftler, eine qualifizierte Führungskraft oder ein Vertreter der Geistes- und Sozialwissenschaften nicht Regimegegner oder als solcher erkannt, wurde er während der NÖP und vor Stalins Interventionen auch wie ein Befürworter behandelt.
Die Regelung, die das Regime den Bauern unter dem Namen NÖP anbot, war klar und weit vom politischen Terror in den Dörfern mit dem entsprechenden Kampagnenvokabular des Kriegskommunismus – Kampf, Front, Schlacht – entfernt. Kernelement dieser Abmachung war, was normalerweise als Naturaliensteuer beschrieben wird. (Anfangs war der Begriff noch treffend, doch ab 1924 bezahlten die Bauern mit Geld.) Eine proportionale Landwirtschaftssteuer44 abhängig von der Größe der Ländereien ersetzte die Praxis der Requisitionen mit vorgehaltener Waffe. Diejenigen mit größeren Flächen – die wahrscheinlich auch die Bauern waren, deren Getreidemengen über den Eigenbedarf ihrer Familie hinausgingen – wurden stärker besteuert. In den ersten Jahren der NÖP war der Steuersatz jedoch nicht so erdrückend, als dass er dem Anreiz der relativ wohlhabenden reicheren und mittleren Bauern (der „Kulaken“ und serednyaks, „Mittelbauern“) entgegengewirkt hätte, Getreide anzubauen und zu verkaufen. Ihre Erzeugnisse konnten sie zudem nach Abzug von Steuern auf einem mehr oder weniger offenen |61|Markt verkaufen. Natürlich waren nach Beginn der Kollektivierung die Kriterien, die festlegten, wer ein Kulake war, häufig nicht eindeutig und manipulierbar. Die Kategorisierung als Kulake war somit häufig eine Waffe, die sich – unabhängig von Grundbesitz, Getreideproduktion oder der Zahl der Beschäftigten – gegen aufsässige Bauern richtete. Sofern die Bauern während der NÖP jedoch mobilisiert wurden, geschah dies durch Preis- und Steueranreize, nicht durch Zwang bei vorgehaltener Waffe.
Das Regime erlaubte nicht nur, sondern ermunterte motivierte Bauern sogar, mehr zu produzieren (dies galt in erster Linie für die mittleren und mäßig begüterten Bauern), indem es die Pacht von Land und die Anstellung von Landarbeitern legalisierte. Während die NÖP die Währung stabilisierte und die Voraussetzung für einen Markt an Konsumgütern schuf, wirkte sie sich zudem auf die Konsumfreudigkeit der Bauern aus. Insofern sie alles außer den „Kommandohöhen“ des Industriesektors privatisierte, veränderte sie auch das Arbeitsumfeld der Städte.
Wie Gregory feststellt, „war die NÖP allen normalen Indikatoren zufolge ein voller Erfolg. Die wirtschaftliche Erholung, die 1921 eingesetzt hatte, war eine der rasantesten der Geschichte“.45 1926 befand sich die Landwirtschaft wieder auf Vorkriegsniveau.46 1927 jedoch gingen die „staatlichen Einkäufe, nicht aber die … gesamten landwirtschaftlichen Verkäufe“,47 merklich zurück und sanken 1928 und 1929 noch weiter. Folglich wurde es erforderlich, „zum ersten Mal in der russischen Geschichte Getreide zu importieren“.48 Wie Tabelle 2.1 zeigt,49 gingen die staatlichen Ankäufe mit hoher Wahrscheinlichkeit deswegen zurück, weil sich die staatlichen Preise gegenüber denen auf dem freien Markt verschlechtert hatten. Angesichts dieses Umschwungs verkauften die Bauern aus gutem Grund mehr Getreide auf dem freien Markt und modifizierten ihre Aussaat leicht, um höhere Erträge einzufahren. Gregory stützt diese Vermutung anhand ökonometrischer Modelle und behauptet: „Wenn man das Landwirtschaftsjahr 1925–26 als ‚normales‘ Verhalten einstuft, dann reagierte die Bauernwirtschaft auf jeden Prozentpunkt Senkung des staatlichen Getreidepreises relativ zum privaten, indem sie ihren Verkauf an den Staat um 13 Prozentpunkte senkte … 1927–28 beherrschen [jedoch] administrative Maßnahmen privatwirtschaftliche Entscheidungsprozesse. Das ökonometrische Model weist keine ‚normalen‘ Reaktionen auf relative Preisanreize mehr auf. Im Landwirtschaftsjahr 1928–29 … waren außergewöhnliche Maßnahmen |62|vonnöten, um einer unwilligen Bauernschaft Getreide abzupressen. Der Befehl hatte die Märkte ersetzt.“50
Tabelle 2.151. Produktionsmenge, Weizenpreis und staatliche Ankäufe
Stalin behauptete, die Bauernschaft habe sich gegen die Sowjetmacht verschworen, schürte die Angst vor einem Krieg und erklärte, rasche Industrialisierung sei unbedingt erforderlich, aber unmöglich, wenn nicht sofortige Kollektivierung erfolge.52 Er verlangte die Liquidierung der Kulaken als Klasse und eine massive und rasche Kollektivierung der Landwirtschaft. Die Fachliteratur ist geteilter Meinung darüber, inwieweit die sich anschließenden Ereignisse auf dem Land vor allem von Moskau ausgingen, inwieweit also die ländliche Mobilisierung von patriotischen Überlegungen oder Karriereplänen der Stadtbewohner geleitet war oder von örtlichen Parteifunktionären veranlasst wurde. Unter Ersteren sind insbesondere die sogenannten Fünfundzwanzigtausend zu nennen, oder um mit dem Titel eines maßgeblichen Buchs von Lynne Viola zu sprechen: The Best Sons of the Fatherland.53 Diese „besten Söhne des Vaterlandes“ waren eine bunte Truppe: „ausgebildete oder hoch qualifizierte Kaderarbeiter, Bürgerkriegsveteranen, Stoßarbeiter, Fabrikaktivisten, Mitglieder der Kommunistischen Partei“,54 die in Dörfer der gesamten Sowjetunion geschickt wurden, um das Tempo der Kollektivierung zu beschleunigen, und die oftmals als erste Vorsitzende der verschiedenen Kolchosen dort blieben.
Die entsprechenden Anweisungen des Zentrums waren vage und schwankten im Laufe der Zeit.55 Wichtige Dokumente aus den Sowjetarchiven, die zunächst auf Russisch und inzwischen auch auf Englisch vorliegen,56 untermauern jedoch die These führender Spezialisten dieser Epoche wie Viola und insbesondere Fitzpatrick, dass diese Unbestimmtheit durchaus Absicht und strategisch motiviert war. So schaltete sich Stalin im November 1929 in S. I. Syrzows Rede im Plenum des Zentralkomitees ein und verspottete die Vorstellung, „alles [könne] ‚im |63|Voraus organisiert‘ werden“.57 Er und Molotow setzten sich mit Nachdruck dafür ein, das Dokument zur Kollektivierung, welches eine Kommission des Politbüros im Dezember 1929/Januar 1930 vorbereitete, zu kürzen und in seinen Anweisungen weniger konkret zu halten, um – so Stalin – „der wachsenden kollektivwirtschaftlichen Bewegung maximale Unterstützung“58 zu bieten. Fitzpatrick merkt dazu an: „Dass das Regime es nicht fertigbrachte, entsprechende Instruktionen zur Kollektivierung und Entkulakisierung zu erteilen, war nicht einfach nur ein Versehen. Vielmehr scheint es eine Strategie gewesen zu sein, … um örtliche Kader dazu zu bewegen, auf das absolute Maximum zu drängen. … Die zur Kollektivierung hinausziehenden Kader … wussten sehr wohl, dass es (für ihre eigene Karriere und für die Sache) besser war, bei der Kollektivierung zu weit zu gehen als nicht weit genug … Sie wussten auch, dass das Kleben am Buchstaben des Gesetzes nicht der richtige Weg war, um revolutionäre soziale Veränderungen zu erzielen.“59
Fitzpatricks zynischer Standpunkt zu den Beweggründen derer, die wie die Fünfundzwanzigtausend 1930 auf das Land zogen, ist völlig angemessen. Jedoch ist die von den Begriffen „Kulturrevolution“ und „Großer Umbruch“ geprägte Atmosphäre der damaligen Zeit zu bedenken. Ende der 1920er- und Anfang der 1930er-Jahre nährten das Regime und insbesondere Stalin das Gefühl von einer neuen revolutionären Phase, in der traditionelle Ansätze infrage zu stellen seien und die Einführung wahrer sozialistischer Praktiken und Denkweisen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen stark erwünscht sei. Insbesondere Stadtbewohner wurden durch das Gefühl mobilisiert, sie beteiligten sich an einem Großen Umbruch. Die enorme Mobilisierung der Bürger geschah nicht nur durch Repressionen, sondern auch durch die erfolgreiche Überzeugung der größtenteils städtischen Anhänger und Unternehmer. Auf dem Land jedoch waren Repressionen der wichtigste Antrieb für die radikalen Umwälzungen.
Das Ergebnis war ein Bürgerkrieg mit begrenztem aktiven Widerstand der Bauern und enormem menschlichen Leid sowie weit verbreitet passivem bäuerlichen Widerstand. Heute liegen glaubwürdige Berichte der Geheimpolizei (der OGPU, wie sie damals hieß) vor, die einen Eindruck vom Widerstand der Bauern und von den menschlichen Verlusten durch die Kollektivierung geben. Das Ausmaß des Widerstands belegt ein streng geheimer Bericht der OGPU aus dem Jahr |64|1931. Demnach60 kam es 1930 zu 13.754 Unruhen (zehnmal so viel wie im Vorjahr), an denen insgesamt „über 2.468.000 Menschen“ beteiligt waren, im Durchschnitt rund 170 Menschen pro „Unruhe“. Die Geheimpolizei klassifizierte 176 dieser Vorfälle als „aufständisch“. Dem Bericht zufolge waren allein im Jahr 1930 fast 1.200 Beamte und andere Anhänger der Kollektivierung ermordet und Mordanschläge auf eineinhalbmal so viele Befürworter der Kollektivierung unternommen worden.
Der Bericht schildert außerdem, wie brüchig die Sowjetmacht in manchen Gegenden geworden war, und gibt damit einen Eindruck von der Intensität des Widerstands. Im März/April 1930 bemerkte die OGPU:
Aufseiten der Kulaken und der Konterrevolutionäre … hat eine Verschiebung hin zu einem offenen bewaffneten Kampf gegen die Sowjets [stattgefunden]. In der Zentralen Schwarzerde-Region, in der Ukraine, in der Krai Nördlicher Kaukasus, in Transkaukasien, in der Krai Untere Wolga, in den Weißrussischen SSR, im Oblast Moskau, in Sibirien, in der Krai Fernost, in Burjatien-Mongolei und Kasachstan haben Kulaken und antisowjetische Element nicht ohne Erfolg versucht, einzelne lokale Unruhen mit der aufständischen Bewegung ganzer Rayons abzustimmen und sie kontrarevolutionär zu prägen … Die Sowjetmacht hat faktisch mehrere Tage nicht existiert. … Im Okrug Mosyr, in den Weißrussischen SSR leisteten die Teilnehmer an Unruhen selbst gegenüber einsatzfähigen Kommandos hartnäckigen Widerstand.61
Die Folgen für die Menschen waren verheerend. Millionen zogen in die Städte, manche unter Zwang, andere als Reaktion auf den ersten Fünfjahresplan.62 Ein Dekret des Politbüros vom 30. Januar 1930 teilte die Kulaken in drei Kategorien ein: Kulaken der ersten Kategorie sollten „umgehend“ liquidiert werden, „indem man sie in Konzentrationslagern interniert und bei Organisatoren terroristischer Akte, kontrarevolutionärer Unruhen und aufständischer Organisationen nicht vor der Todesstrafe Halt macht[e]“. Die zweite Kategorie bestand aus den verbleibenden „reichsten Kulaken und Halb-Grundbesitzern …, die in entlegene Regionen der UdSSR und [dort] in die entlegensten Gebiete … zwangsumgesiedelt werden soll[t]en“. Deportierte der dritten und letzten Kategorie durften in ihrem Rayon bleiben, mussten allerdings „außerhalb |65|von Kolchosen“ siedeln.63 Laut Beschluss waren zunächst 60.000 Kulaken der ersten Kategorie festzunehmen. Bereits Mitte April 1930 überstieg die Zahl der Festgenommenen jedoch bei Weitem diesen ursprünglichen Richtwert. Ein Dokument der OGPU sprach von rund 140.000, eine Übererfüllung des Plans, die laut Viola eine Folge des „bolschewistischen Tempos, gesellschaftlicher Säuberungen und einer Polizeiführung, die sich mehr für Fälle als für Kulaken interessierte“ gewesen sein mag.64 Der Chef der Geheimpolizei, Genrich Jagoda, setzte Stalin davon in Kenntnis, dass laut Stand vom Januar 1932 1,4 Millionen Menschen deportiert worden seien.65 Tausende starben auf dem Weg, Tausende andere kamen in ihrem ersten Winter in Sibirien oder Kasachstan um.
Auch die Hungersnot 1932 bis 1933 stand in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Kampf zwischen Regime und Bauern. Fitzpatrick merkt an, dass bei Hungersnöten „ein gewisser Grad an staatlicher Verantwortung … eher eine Regel als eine Ausnahme ist“ und dass „die Hungersnot 1932–33 ein ungeheuerliches Beispiel dafür war“. Für die Tausenden, die starben, ist dies zwar völlig irrelevant, doch Wissenschaftler debattieren, ob sie als Opfer von Mord oder von Totschlag zu bezeichnen sind. Für unsere Geschichte ist allerdings sehr wohl von Belang, dass das Regime ausdrücklich untersagte, die Hungersnot in der Presse zu benennen – die „wohlbekannten Ereignisse“ lautete die Umschreibung –, dass ausländische Journalisten keinen Zutritt zu Gebieten erhielten, die von der Hungersnot betroffen waren, dass sowjetische Kommentatoren öffentlich und privat behaupteten, die Bauern versuchten eine Hungersnot zu inszenieren und stellten sich als ruinierte Kolchosbauern hin, und ein delinquenter Bauer habe gar seine Familie aus Propagandazwecken verhungern lassen.66 Stalin und seine Anhänger lagen mit den Dörfern im Krieg. Das vielleicht expliziteste Eingeständnis dieser Realität stammte von Mendel Chatajewitsch, einem hochrangigen ukrainischen Parteifunktionär: „Zwischen den Bauern und unserem Regime herrscht ein erbarmungsloser Kampf … Dieses Jahr war eine Bewährungsprobe für unser Durchhaltevermögen. Es brauchte eine Hungersnot, um ihnen zu zeigen, wer hier der Herr ist. Sie hat Millionen Leben gekostet, doch das Kollektivwirtschaftssystem wird so schnell nicht verschwinden. Wir haben den Krieg gewonnen.“67
Eine Mehrheit der Bauern, die während der Jahre 1929 bis 1933 nicht gestorben waren, war für die Ziele des Regimes eingespannt worden. |66|Viele wurden in Lagern interniert, beim Bau von Projekten wie dem Weißmeer-Ostseekanal geknechtet oder in entlegene Gegenden der Sowjetunion zwangsumgesiedelt, wo sie häufig umkamen.
Als das im Dezember 1932 verabschiedete Gesetz über Inlandspässe in Kraft trat, mussten die Kolchosbauern feststellen, dass sie faktisch genauso eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit waren wie jene in den Lagern oder im Exil. Zusammen mit einem System obligatorischer Werktage für das Kollektiv68 lief dieses Gesetz überspitzt gesagt auf eine Wiederherstellung der Leibeigenschaft hinaus. Während die Städter von Arbeit zu Arbeit ziehen konnten, hatte der Krieg gegen die Kulaken letztlich zur Geiselhaft der gesamten Bauernschaft geführt69 – unabhängig davon, ob sie nun mit ihrem Dorf in eine Kolchose eingegliedert worden waren, ob sie interniert oder verbannt worden waren in den Norden Sibiriens, in den Ural oder nach Kasachstan. Die Bauern hatten Widerstand geleistet, was zu Stalins Rede „Vor Erfolgen von Schwindel befallen“ und der kurzzeitigen Unterbrechung der Kollektivierung 1930 geführt hatte.
Lynne Viola konstatiert zu Recht, dass die Kollektivierung sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben durchgesetzt wurde.70 Was in jener Formulierung fehlt, ist der Aspekt der asymmetrischen Interdependenz der Wirkfaktoren. Jenes Verhalten, das die Kollektivierung von unten nach oben durchsetzte, war daher eine Folge dessen, was Fitzpatrick treffend als von Stalin geschaffene politische Atmosphäre beschreibt; eine Atmosphäre, in der Übererfüllung und Eifer gewöhnlich Wege zum Erfolg waren, und die auch in „Vor Erfolgen von Schwindel befallen“ noch zum Ausdruck kommt. Um eine Analogie aus dem Bridge-Spiel zu verwenden, empfiehlt es sich oftmals, der anderen Partei einen Stich zu überlassen, um einen Kleinschlemm anzusagen.
Mit der energischen Reaktion Ende 1929 und über weite Teile des Jahres 1930 konnten die Bauern einen Stich machen. Doch es blieb bei einem. Im Gegensatz zum weiter verbreiteten passiven Widerstand, etwa dem Verstecken von Getreide, hatte der aktive Widerstand der Bauern zwar bis zu einem gewissen Grad Erfolg, nahm aber rapide ab, als die Kollektivierung im Herbst 1930 mit Nachdruck wieder aufgenommen wurde.
|67|Der Große Umbruch in den Städten
Der Schachty-Prozess im Mai und Juni 1928 und sein Nachfolger, der Prozess gegen die Industriepartei, kündigten die Kulturrevolution der späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre sowie die „Säuberungen“ und Schauprozesse Mitte und Ende der 1930er-Jahre an. Der Schachty-Prozess im Mai und Juni 1928 richtete sich gegen „bürgerliche Spezialisten“, die – so hieß es – Schädlinge seien und für ausländische Regierungen sowie das „internationale Kapital“ arbeiteten.71
Der Schachty-Prozess hing insofern mit der Kulturrevolution zusammen, als seine politische Botschaft lautete, man benötige wahrhaft sowjetische Ingenieure und Wissenschaftler, die keine Verbindungen zur Vergangenheit oder zu ausländischen Mächten hätten. Ähnlich war das übergeordnete Thema der Kulturrevolution ab 1928 das Bestreben nach einer wahrhaft revolutionären und wahrhaft sozialistischen Wissenschaft, entsprechenden öffentlichen Institutionen und einer entsprechenden Literatur. So entstand ein Klima, in dem die Jagd auf nicht-bolschewistische oder nicht-stalinistische Kommunisten in den wissenschaftlichen Instituten der Akademien und Universitäten eröffnet war. Es trug ebenfalls zum Misstrauen gegenüber den unterschiedlichsten nichtsowjetischen Dingen bei – einem Misstrauen, das die gesamten 1930er-Jahre prägte, obwohl die Phase, in der radikales Denken viele Bereiche zu dominieren schien, kaum länger andauerte als der Fünfjahresplan. Sowjetische Wissenschaft unterschied sich oder sollte sich radikal von bürgerlicher Wissenschaft unterscheiden. So entwickelte sich ein grassierendes xenophobes Denken, das sich durch die gesamten 1930er-Jahre zog und zu extremen Repressionen in den verschiedenen Eliten führte. Auch gerieten nun Völker verstärkt ins Visier, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des sowjetischen Staatengebiets ansässig waren. Der Schachty-Prozess und der Prozess gegen die Industriepartei sind außerdem zu Recht als Generalproben für die politischen Prozesse des Jahres 1937 bewertet worden, wobei sie keinesfalls milder ausfielen: „[N]ur zehn der 53 Angeklagten legten ein umfassendes Geständnis ab und belasteten die anderen; ein weiteres halbes Dutzend legte Teilgeständnisse ab; der Rest pochte auf seine Unschuld und wehrte sich gegen die Beschuldigungen.“72 Dabei war kaum zu übersehen, dass es sich um Schauprozesse handelte. So gibt Tucker in Stalin in Power eine englische Übersetzung der Anklageschrift wieder, die sich nicht von einem Programmheft unterscheidet und tatsächlich die Aufschrift „Der Plot“ trägt.73
|68|Die Prozesse dienten als Kulisse für die Kulturrevolution, indem sie das Gefühl von einer kapitalistischen Umzingelung vermittelten und von deren gefährlichen Manifestationen im Inland – vor allem in Form von Zersetzung. Sie verstärkten Forderungen nach einheimischen Ingenieuren und Wissenschaftlern, welche die Industrialisierungspläne – ihr Inbegriff war der außerordentliche Dünkel der Fünfjahrespläne – umsetzen sollten. In einem brillanten Aufsatz hat Richard Lowenthal74 dargelegt, wie die Utopie einer Revolution schließlich von eher alltäglichen Entwicklungsaufgaben eingeholt wurde.
Die Geschichte der Sowjetunion gestaltete sich jedoch komplizierter, da eine Art dialektischer Prozess im Gange war. Während der Jahre des Großen Umbruchs sind radikale Ansätze auf breiter Front auszumachen, welche im Laufe der 1930er-Jahre häufig sehr traditionellen, ja geradezu viktorianisch anmutenden oder nationalistischen Symbolen, Strategien und Normen Platz machten. Der sogenannte Große Umbruch lieferte den Rahmen und die Gründe für eine radikale und wahrhaft sozialistische Wissenschaft. Forderungen wurden laut, die bürgerliche Wissenschaft müsse auf verschiedenen Gebieten durch eine sozialistisch-proletarische abgelöst werden. Entsprechendes wurde in fast allen Bereichen, aber nicht durchgängig proklamiert: „In der Ökonomie gab es Schädlings-Theorien von Planern wie [W]. Basarow und N. Kondratjew (die das heroische stalinistische Industrialisierungstempo nicht annähernd für möglich hielten). ‚Schädlinge‘ grassierten in der Forstwissenschaft, in der Meliorationstheorie, in der Bergbauwissenschaft, in der Hochspannungstechnologie, in der Mikrobiologie und sogar in der Ichthyologie.“75
An der Ichthyologie lässt sich eine Kernprämisse veranschaulichen. Die normale Wissenschaft76 ging davon aus, der Fünfjahresplan sei nicht auf Fische anwendbar, da ihr Verhalten nicht dahingehend zu beeinflussen sei. Wer jedoch so dachte, beging den fundamentalen Denkfehler, nicht zwischen Fischen in einem kapitalistischen Land und Fischen in der Sowjetunion zu unterscheiden.77 Auf manchen Gebieten hielt sich diese Vorstellung einer sozialistischen Besonderheit bis weit in die Post-Stalin-Zeit hinein. Selbst nach der Kuba-Krise 1962 wies die sowjetische Führung beispielsweise die Chinesen noch darauf hin, dass „die Atombombe sich nicht an das Klassenprinzip hält“.78
Es gibt jedoch eine entgegengesetzte Entwicklung, die ebenfalls mit dem Großen Umbruch ihren Anfang nahm. Wie Kulturhistoriker gern |69|feststellen, war dies eine Zeit enormer horizontaler und vertikaler Mobilität.79 Und in Anbetracht dieser entwicklungspolitischen Realität warnte Stalin schon früh davor, radikale Innovationen zu ernst zu nehmen. Die Kulturrevolution war eine Zeit, in der Wissenschaftler und Politstrategen die Abschaffung verschiedener wichtiger „bürgerlicher “ Institutionen nachdrücklich vorantrieben und den Egalitarismus hochhielten. Ihnen zufolge sollten nicht nur der Staat, sondern auch Institutionen im Bereich des Rechtsystems und Schulen allmählich verschwinden. Stalins Augenmerk hingegen lag konsequent auf der Begründung und dem Ausbau der staatlichen Macht mit Hinweis auf die kapitalistische Umzingelung.
Bereits 1931 attackierte er auf einem Industriellenkongress „linken Egalitarismus (uravnilovka) im Lohnsektor“. Schon zuvor hatte er auf dem Höhepunkt der Kulturrevolution erklärt: „Höchste Entfaltung der Staatsmacht zur Vorbereitung für das Absterben der Staatsmacht – so lautet die marxistische Formel.“ Das sei, so erkannte er natürlich, „widerspruchsvoll. …. Aber dieser Widerspruch ist dem Leben eigen, und er spiegelt vollständig die marxistische Dialektik wider.“80
Insgesamt ist das Thema in der Ära der Fünfjahrespläne ein „Schwinden des Verschwindens“, bis Ende der 1930er-Jahre hatte Stalin die Vorstellung eines schwindenden Staats vollständig aufgegeben. „Manchmal wird gefragt: ‚Die Ausbeuterklassen sind bei uns aufgehoben, feindliche Klassen gibt es im Lande nicht mehr, es gibt niemanden mehr, der zu unterdrücken wäre, also braucht man den Staat nicht mehr, er muss absterben … Ist es nicht an der Zeit, den Staat in ein Museum für Altertümer abzuschieben?“ In solchen Fragen, so erklärte Stalin, „kommt nicht nur die Unterschätzung des Bestehens der kapitalistischen Umzingelung zum Ausdruck. In ihnen offenbart sich ebensowohl die Unterschätzung der Rolle und Bedeutung der bürgerlichen Staaten und ihrer Organe, die in unser Land Spione, Mörder und Schädlinge entsenden und nur auf den Moment lauern, um einen militärischen Überfall auf unser Land zu unternehmen; ebenso offenbart sich in ihnen die Unterschätzung der Rolle und Bedeutung unseres sozialistischen Staates und seiner … Organe [,Organe‘ meint hier die Geheimpolizei und andere, die Gewaltinstrumente einsetzten].“81
Auch war die kapitalistische Umzingelung für Stalin kein geografisches Konzept. Mit der Bildung des Sowjetblocks nach dem Zweiten Weltkrieg war sie in Stalins Augen nicht beseitigt. Noch 1950, nachdem |70|die Kommunisten die Macht in Osteuropa und in Fernost übernommen hatte, erklärte er: „[W]enn der Sieg der sozialistischen Revolution im Angesicht der kapitalistischen Umzingelung in nur einem Land stattgefunden hat, während der Kapitalismus weiter in allen anderen Ländern herrscht, darf das Land, in dem die Revolution gesiegt hat, nicht nachlassen, sondern muss auf alle nur mögliche Weisen seinen Staat, die Staatsorgane, die Geheimdienste und die Armee stärken, wenn es nicht von der kapitalistischen Umzingelung zerstört werden will.“82 Erst Ende der 1950er-Jahre, als Chruschtschow feststellte, es sei nicht länger klar, „wer wen umzingelt“,83 wurde die Begründung für den anhaltenden Terror offiziell verworfen.84
Hierzu kam es jedoch erst lange, nachdem die Kulturrevolution Mitte der 1930er-Jahre eingestellt worden war. Stellvertretend für andere Fachgebiete seien an dieser Stelle nur einige Beispiele aus dem Rechts- und Bildungswesen genannt, in denen das Verschwinden des Staates während der Kulturrevolution ernsthaft angeregt wurde: In den Bereichen Literatur und Geschichte hatten radikal-marxistische Wissenschaftler während der Kulturrevolution scheinbar die Oberhand und legten das Verschwinden des Staates nahe, nur um daraufhin zu erleben, wie ihre Bemühungen durch intensivierte Eingriffe der Partei in ihr Forschungsgebiet durchkreuzt wurden; am Rande sei auch auf die Physik und Biologie hingewiesen, in denen der unmittelbare Schaden aus der Kulturrevolution zwar gering war, sich jedoch für die Biologie und Biologen zu einer Katastrophe entwickelte. Diese Beispiele geben einen Eindruck davon, wie sehr diese Zeit auf Wandel setzte und wie groß das Ausmaß der Mobilisierungsbemühungen des Regimes während der Kulturrevolution war. Sie ermöglichen auch ein besseres Verständnis dafür, wie tief die Kulturrevolution die Beziehungen zwischen Regime und Gesellschaft prägte und welch geradezu einzigartiges Ausmaß des Terrors sie ermöglichte, das mit einer verstärkten Verwendung von traditionalistischen Symbolen und Anreizen einherging.
Für den Wandel argumentierten die Vertreter der Kulturrevolution auf dreierlei Weise. Erstens gingen sie davon aus, die nahende Vollendung des Sozialismus bringe völlig neue Wissenschaften mit sich – sowjetische Wissenschaften und Künste. Diese würden sich nicht nur von westlicher Wissenschaft unterscheiden, sondern besser sein als diese und auch besser als die Wissenschaften und Künste vor dem Triumph der Sowjetmacht in Russland. Zweitens vertraten sie den Standpunkt, |71|dass angesichts der Erfolge bei der Umsetzung des Sozialismus fundamentale Institutionen „bürgerlicher“ Gesellschaften – wie der Staat, das Rechtssystem85 und die Schule – deutlich weniger benötigt würden und daher verschwinden könnten. Drittens argumentierten sie für Veränderung, indem sie behaupteten, das Wesen des Menschen insgesamt unterliege aktuell einem Wandel, der den neuen Sowjetmenschen hervorbrächte.86
Die Entwicklungen in Physik und Biologie liefern weitere Beispiele dafür, wie der Anspruch, sowjetische von bürgerlicher Wissenschaft zu unterscheiden, sich während der Kulturrevolution in den Naturwissenschaften auswirkte. Im Falle der Physik drohte, wie Loren Graham gezeigt hat, „ein Bündnis aus marxistischen Ideologen und stalinistischen Bürokraten damit … [, die] Physik als solche einzuschränken … vielleicht sogar die Relativitätsphysik und die Quantenmechanik“87 ganz zu verbieten. Anders als auf anderen Forschungsgebieten entzündete sich die harsche Kritik (weniger von Physikern als vielmehr von Philosophen) im Wesentlichen an den philosophischen Prämissen der modernen Physik statt an der Physik selbst. Daher vertraten sowjetische Physiker Anfang der 1930er-Jahre in erster Linie die Auffassung, die analytische Kraft von Relativität und Quantenmechanik sei von den philosophischen Präferenzen westlicher Physiker abzukoppeln.
Wie Graham zeigt, waren die späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre zunächst eine Phase großer Erfolge in der sowjetischen Physik.88 Zur wahren Herausforderung kam es erst 1936, als in einer Fachzeitschrift für Physik eine ernsthafte Kampfansage an die Quantenmechanik erschien.89 Danach waren Physiker von den „Säuberungen“ 1937 bis 1938 stark betroffen und standen während des Kalten Krieges unter Druck, allerdings wurde kein Forschungsansatz oder -gebiet je ganz verboten.
Anders im Falle der Genetik. Die Sowjetunion verpasste verschiedene große Revolutionen des 20. Jahrhunderts, darunter die genetische. Dieses Versäumnis war anfangs eine direkte Folge der Kulturrevolution und der Kollektivierung in der Landwirtschaft und später eine Folge des Aufstiegs von Trofim Lyssenko, der die Biologie beherrschte. Lyssenko machte schon während der Kulturrevolution von sich reden, da das Landwirtschaftsministerium 1931 beschloss, seinen Ansatz in der Pflanzenphysiologie zu erproben. Wie im Falle der Physik traten die wirklich destruktiven Ereignisse jedoch erst Mitte der 1930er-Jahre und 1948 ein, als nach einer Rede von Lyssenko, die bekanntermaßen von |72|Stalin redigiert worden war und gemäß dessen Änderungen den „reaktionären Charakter … ausländischer Wissenschaft“90 betonte, die Genetik ausdrücklich verboten wurde. Lyssenko war ein Scharlatan und Marktschreier, der gefälschte Produkte und – durch sein Ausblenden von (westlichen) Erkenntnissen – letztlich eine komplett unseriöse Theorie darüber anpries, wie die Landwirtschaft in der Sowjetunion auf wundersame Weise verändert werden könne; Stalin und später Chruschtschow fielen auf ihn herein.
Weitaus seriösere sowjetische Wissenschaftler vertraten hingegen die Auffassung, die nahende Vollendung des Sozialismus werde erst den unverwechselbaren Charakter der Sowjetmacht im Gegensatz zu normalen bürgerlichen Staaten hervortreten lassen, da im Sozialismus der Zwangsapparat fehle, der für Marxisten den essenziellen Kern des Staates ausmachte.91 In verschiedenen Veröffentlichungen92 hat Robert Sharlet die Rolle von Jewgeni Paschukanis während der Kulturrevolution beleuchtet, seine Kritik an der Rechtsform: die begriffliche Unmöglichkeit eines proletarischen respektive sozialistischen Rechts – ein Versuch, der gegen Ende der NÖP begann, sich bis in die Kulturrevolution fortsetzte und endete, als Paschukanis als einer von Tausenden 1937 hingerichtet wurde. Für ihn war die Rechtsprechung eine direkte Folge des Privateigentums und des Warentausches. Der Staat war als Institution der Klassenherrschaft – „der politische Staat“ – in Paschukanis’ Augen ein „meta-juristisches Phänomen, das den Rahmen der Rechtstheorie sprengte“.93 Wenn Sozialismus und Planung den freien Markt und die Rechtsprechung ersetzten, würde der „Rechtsstaat“ verschwinden. Diese Ansichten hatten Ende der 1920er- und Anfang der 1930er-Jahre enormen Einfluss, „insbesondere im Straf- und Zivilrecht bzw. -verfahren und der Strafrechtspflege.“94 Als Teil eines allgemeineren Trends, „bürgerliche“ Spezialisten aus dem Weg zu räumen, entfernten Paschukanis und seine Anhänger erfolgreich leitende Professoren aus den juristischen Fakultäten und aus dem Staatsapparat.
Allerdings stand Paschukanis vor dem Problem, dass Stalin bereits Mitte der 1930er-Jahre explizit ausgeschlossen hatte, den Staat in naher Zukunft verschwinden zu lassen. Wie viele Vertreter auch anderer Fachrichtungen gegen Ende der Kulturrevolution wurde Paschukanis zur Selbstkritik und zur Änderung seiner Ansichten gezwungen, obwohl er bis Mitte der 1930er-Jahre eine wichtige Rolle gespielt hatte. Zu dem |73|Zeitpunkt war unübersehbar, dass „Stalin das Rechtswesen zum einen zur Stabilisierung seiner ‚Revolution von oben‘ und zum anderen als Instrument für künftige soziale Manipulationen benötigte“.95 Paschukanis’ endgültiger Untergang war die Verabschiedung der neuen sowjetischen (Stalin’schen) Verfassung Ende 1936, die unter anderem das Recht auf „Privateigentum … [und] einen verlässlichen Rechtsrahmen“96 garantierte. Kurz darauf, Anfang 1937, wurde Paschukanis verhaftet und verschwand (vermutlich in Lagern). Fortan definierte Stalins berühmte Bemerkung „die Stabilität der Gesetze aber brauchen wir jetzt mehr denn je“ die Aufgaben sowjetischer Anwälte, Richter und juristischer Fakultäten. „Paschukanis’ Nachfolger ließen im Grunde die Rechtskultur der NÖP mitsamt ihren stalinistischen Beigaben wieder aufleben“97 – ein Rechtssystem, das trotz ungeheuerlicher Auswüchse wie Artikel 58 des Gesetzbuches der UdSSR (ein bewusst vage gehaltener Artikel, der „Terrorismus, gegenrevolutionäre Agitation und Schädlinge“98 unter Strafe stellte) erkennbar kontinentaleuropäisch war.
Bildung war ein weiteres Gebiet,99 auf dem die Kulturrevolution weitreichende Folgen hatte, und diese Folgen hingen direkt mit dem Schachty-Prozess zusammen. Als sich der Klassenkampf verschärfte, erhob die Kulturrevolution Forderungen, wonach Studierende „proletarisiert“ und Mitglieder der alten Intelligenzija aus den Fachbereichen entfernt werden mussten. Die soziale Struktur der Universitäten veränderte sich dramatisch zugunsten der Arbeiter, während sich der Schwerpunkt des Lehrplans in Richtung einer Ausbildung mit unmittelbaren industrienahen Anwendungen verschob. In diesem Milieu genoss Wassili Schulgin einen kurzen Augenblick des Ruhms. Seiner Ansicht nach sollte die Schule eine immer unbedeutendere Rolle bei der Ausbildung der Schüler spielen: „[D]ie Sowjets, die Partei, Berufsverbände, Massenorganisation – das waren für Schulgin die wahren ‚Schulen der Massen‘.“100 Diese Haltung kam in den Jahren 1928 bis 1930 gut an, als Bucharin und seine Verbündeten auf der Rechten die wichtigsten politischen Angriffsziele darstellten, sodass Schulgins Sinn für Umwälzungen anfangs auf Anklang stieß. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit gering, dass Stalin mit seinem Augenmerk auf der wirtschaftlichen Entwicklung das Verschwinden der Schule positiver bewerten würde als das Verschwinden des Staates. Lapidus stellt daher treffend fest: „Bereits 1931 wurden linke Abweichler als größte Gefahr identifiziert.“101
|74|Das radikale Moment in der Bildung erfüllte den Zweck, die Position von vorrevolutionären Spezialisten – seien es Lehrer oder Forscher – zu untergraben und das Schulklima zu politisieren. Dieses Moment wich jedoch rasch der Meinung, Kernaufgaben der Bildung sei die Vorbereitung einerseits der Arbeiter auf gewöhnliche Stellen und andererseits jener, die ihre akademische Ausbildung über die Sekundarstufe hinaus fortsetzen würden. Landesweit wurden der Lehrplan und das Schulsystem vereinheitlicht, so dass sie bald schon an das Schulsystem in der Zarenzeit erinnerten, wobei die Indoktrination im Sinne der Partei eine sehr viel größere Rolle als noch während der NÖP oder der Kulturrevolution spielte. Lapidus warnt ihre Leser, diese Entwicklungen nicht „als Reaktion auf die universellen funktionalen Anforderungen der Modernisierung“ zu verstehen.102 Stalins Rache am Überbau103der sowjetischen Gesellschaft verlieh – angesichts des streng hierarchischen Verhältnis des Regimes zu allen gesellschaftlichen Aspekten einschließlich den Schulen seit der Kulturrevolution – „sowjetischen Modernisierungsmustern einen ganz besonderen Beigeschmack.“104 Dennoch machten die Wiedereinführung von Zensuren und Prüfungen, die Abkehr von positiver Diskriminierung zugunsten von Arbeiterkindern und die Rückkehr von Uniformen in Verbindung mit der Überwachung der Lernfortschritte sowjetische Schulen klar wiedererkennbar für diejenigen, die mit den stereotyp traditionalistischen westeuropäischen oder amerikanischen Schulen bzw. den Zarenschulen aus dem 19. Jahrhundert vertraut waren.105
Bildung und Rechtsprechung waren nur zwei der vielen Bereiche, die maßgeblich von der Kulturrevolution betroffen waren. Von 1928 bis 1931 gab es zahllose Versuche, radikal andere und wahrhaft sowjetische kulturelle und wissenschaftliche Gebiete zu schaffen. Ein solches Gebiet, mit dem sich die westliche und russische Forschung106 ausführlich beschäftigt hat und auf dem der Versuch unternommen wurde, etwas wirklich Eigenes zu schaffen, waren Literatur und Kunst. Persönlichkeiten des kulturellen Lebens, die selbst nicht aus einer niedrigeren sozialen Klasse stammten, forderten, dass Literatur und Kunst „proletarisiert“ werden sollten, wobei sie als Sprecher des Proletariats den Ton dabei angeben wollten.
In Bezug auf die Literatur bedeutete dies im Wesentlichen, einem bereits von ihnen dominierten Organ, nämlich der Russischen Assoziation Proletarischer Schriftsteller (RAPP), eine hegemoniale Stellung in der |75|Kulturszene zu verschaffen. Auf den meisten kulturellen Gebieten einschließlich dem der Literatur brachte dies auch die Verdrängung einiger älterer, häufig nichtkommunistischer Zeitgenossen von prominenten Positionen mit sich sowie die Neubesetzung dieser Positionen mit radikalen Elementen. Doch Anhänger der RAPP taten sich durchaus auch in künstlerischer Hinsicht hervor. Westliche Literaturwissenschaftler loben ihr Bekenntnis zu einem ungeschminkten Realismus und das Recht des Autors, sein bzw. ihr Werk selbst zu bewerten – vorausgesetzt, das spielte sich innerhalb eines klassenbewussten Rahmens ab.107 Wie im Falle von Bildung und Rechtsprechung geriet der radikale Marxismus, den die RAPP-Mitglieder vertraten, in Konflikt mit Stalins Sorge um eine Atmosphäre, in der Themen wie die Staatsbildung, die Industrialisierung und die Fähigkeit des sowjetischen Volkes, übermenschliche Aufgaben zu erfüllen, zentral waren für die Mobilisierung der Bürger.
Stalins Ansinnen erforderte eine andere Organisationsstruktur und eine ganz andere Art von Realismus. In der Literatur führte es in institutioneller Hinsicht zum Niedergang der radikalen, aber nicht allumfassenden RAPP und zur Gründung einer Schriftstellerunion108 im April 1932. Diese bestand sowohl aus kommunistischen wie nicht-kommunistischen Schriftstellern, wobei der kommunistische Flügel die herausragende Rolle spielte.109 Der sozialistische Realismus unterschied sich erheblich vom Realismus der radikalen Marxisten. Während Letzterer „ein Abreißen der Masken“ und eine Darstellung kommunistischer Helden in all ihrer Komplexität forderten, ging der sozialistische Realismus davon aus, dass das „Enthüllen der menschlichen Komplexität politisch schädlich“ sei und dass es stattdessen die Pflicht der Autoren sei, positive Helden darzustellen. Sie sollten darüber hinaus die Regeln der partiinost’ (Parteigesinnung) je nach Parteilinie in die Praxis umsetzen. Der Realismus bezog sich nicht auf Bestehendes, sondern auf das Werdende; das Ideal war real. So wurde der Realismus zum Darstellungsmodus des mythischen Neuen Sowjetmenschen, wie ihn die Stachanowisten versinnbildlichten, mit deren Hilfe eine neue sozialistische Ordnung entstehen sollte. Die Stachanowisten waren selbstverständlich hünenhafte Arbeiter, die das Plansoll sagenhaft übererfüllten. Wie der für Kulturfragen zuständige Parteisekretär Andrej Schdanow betonte, sollten Literatur und Kultur wie fast alle anderen Bereiche ihren Teil dazu beitragen, die Gesellschaft für die Zwecke des Regimes einzuspannen. Der Zweck der Literatur bestand nach sowjetischem Verständnis darin, ein neues Vorbild |76|für die Sowjetbürger zu gestalten und damit einen Beitrag zu ihrer Mobilisierung und zu ihrer Transformation zu leisten. Schdanow formulierte es so: „Die Sowjetliteratur muss verstehen, unsere Helden zu gestalten, sie muss verstehen, einen Blick in unsere Zukunft zu werfen. Das wird keine Utopie sein, denn unsere Zukunft wird durch planmäßig bewusste Arbeit schon heute vorbereitet.“110
Die Ambition, einen Neuen Sowjetmenschen zu schaffen, galt logischerweise auch für die Psychologie. In den 1920er-Jahren bestimmte der „Umweltdeterminismus“ das sowjetische Bild von der menschlichen Psyche.111 Wie weit sich der Mensch ändern könne, war umstritten; während der Kulturrevolution neigte man jedoch dazu, menschliches Verhalten durch die marxistische Brille zu betrachten. Wie bereits in anderen Bereichen wurden Psychologen in rascher Folge zunächst des rechten Opportunismus beschuldigt und bezichtigt, sie würden einer reaktionären Doktrin anhängen, nach der „die Arbeiterklasse aus Robotern“112 bestünde. Später dann wurden insbesondere Psychologen, die im Kontext von Fabriken und Schulen angewandt forschten, linksgerichtete Tendenzen unterstellt, die dem Menschen „Bewusstsein und Bestimmung“ zubilligten.113
Ähnlich hatte 1931 die deutlich stärkere Betonung der partiinost’ zur Folge, dass Forschung, welche unerwünschte Ergebnisse produzierte – nämlich solche, die bestehende Parteidogmen infrage stellte –, als politisch schädlich galt und unterdrückt wurde. Wie in anderen Bereichen sowjetischer Forschung galt auch in der Psychologie die Praxis im weitesten Sinne als entscheidend und hatte daher Vorrang vor bloßer theoretischer Forschung – etwas, was linke Schwärmer unter den Psychologen verkannt hatten. Und so galten ab 1932 so einfache Elemente im Portfolio eines Psychologen wie „Forschung zu Gesinnungsfragen“ als suspekt. Denn offene Fragen könnten ja den Eindruck erwecken, es gäbe mehr als eine akzeptable Antwort. 1936 hieß es offiziell: „Fragebögen, welche die politischen Ansichten der Testperson betreffen oder die tiefe und intime Seite des Lebens erforschen … müssen kategorisch verboten werden.“114
Das in gewisser Weise interessanteste und instruktivste Beispiel betrifft die Geschichtswissenschaft. Auf diesem Forschungsgebiet versuchten zwei Marxisten in der Annahme, ihre Ansichten deckten sich mit denen des Zentrums, eine beherrschende Stellung einzunehmen, wobei sie unterschiedliche Auffassungen vertraten und unterschiedliche |77|institutionelle Bindungen hatten: Michail N. Pokrowski und Jemeljan Jaroslawski, die sowohl in wissenschaftlichen als auch in Parteikreisen verkehrten. Pokrowski war 1930 Mitglied des Präsidiums der Zentralen Kontrollkommission der KPdSU, während Jaroslawski einer ihrer Sekretäre und Mitglied der Chefredaktionen führender Partei- und staatlicher Zeitungen war. Wie wir bei der Darstellung der anderen Disziplinen gesehen haben, waren die späten 1920er-Jahre eine Zeit, in der es nach Ansicht der jüngeren Generationen opportun war, Wissenschaftler zu attackieren, die nicht in der Partei waren. So auch in den Geschichtswissenschaften. Pokrowski hatte den Angriff offenbar nicht initiiert, schloss sich ihm jedoch in dem Klima nach dem Schachty-Prozess an und machte ihn sich zunutze, um eine Kommunistische Akademie zu propagieren, deren Mitglieder – wie ihr Name schon sagte – Kommunisten sein sollten. Er geriet außerdem in ernsthaften Konflikt mit einem Historiker und Altbolschewik, Iwan A. Teodorowitsch, der Verbindungen zu Jaroslawski hatte.
Diese Auseinandersetzungen hatten nichts gemein mit dem manierlichen akademischen Geplänkel, wie es im Westen üblich ist. In den Debatten ging es um inhaltliche Kommentare sowie um die durchaus gefährliche Anklagen des „Trotzkismus“ und des „bürgerlichen Liberalismus“. Die Streitigkeiten unter Historikern reichten bis hinauf ins Zentralkomitee und mündeten im März 1931 in eine Resolution desselben. Im Oktober 1931 schrieb Stalin seinen berühmten Brief an die Redaktion der Zeitschrift Proletarskaya Revolyutsiya, in dem er „Archivratten und hoffnungslose Bürokraten“ attackierte, womit er ganz klar brave Historiker aller politischer Couleur meinte, für die Fakten wichtiger waren als Aktionismus und die Parteilinie.
Der Brief hatte verheerende Auswirkungen für die Historiker und schwerwiegende Folgen für unterschiedlichste Gebiete der Wissenschaft. Der englische Historiker John Barber115 bemerkt, dass „die Geschichtswissenschaft quasi zum Erliegen kam“.116 Es war eine Zäsur. „Kritik, Selbstkritik, die Entlassung aus akademischen Positionen, Parteiausschluss“117 und in manchen Fällen Repressionen118 waren fast umgehend die Folge. Jaroslawski und seine Mitarbeiter sowie Pokrowskis Kollegen wurden sämtlich kritisiert. Viele von ihnen verloren ihre Stellung. Pokrowski wurde wahrscheinlich nur deshalb nicht angegriffen, weil er quasi im Sterben lag. 1932 erlag er seiner Krebserkrankung. Ab 1934 galt er offiziell als Volksfeind.119
|78|Was das Verhältnis zwischen Regime und Wissenschaft anbelangt, so kam es zu zwei entscheidenden Entwicklungen. Erstens hatten die Befürworter von Wandel auf die Signale der politischen Führungsebene reagiert. In Zeiten, da alle Anzeichen wie der Schachty-Prozess, die Angriffe auf rechtsgerichtete Kräfte in der Führung und der erste Fünfjahresplan auf Wandel hindeuteten, ließen sie ihren revolutionären Ansichten oftmals freien Lauf. Ferner nutzten sie das Klima der Zeit, um ihre institutionelle Position zu stärken, und kommunizierten häufig mit zentralen Parteiführern, um diese um Unterstützung bei entsprechenden Projekten zu bitten. In den meisten Fällen scheiterten sie jedoch an Stalins Entschlossenheit, praktisch alle intellektuellen Ressourcen der Akademie für den Aufbau staatlicher Strukturen zu nutzen. In einem solchen Milieu waren die Institutionen und der Alltag Einzelner in der Akademie unmittelbarer von den alles durchdringenden Parteiorganen kontrolliert als noch während der NÖP oder der Kulturrevolution. Das Ausmaß der Einmischung in Institute und sogar in den beruflichen Alltag einzelner Wissenschaftler nahm neue und direktere Formen an. In der Geschichtswissenschaft, so Barber, „schrieb die höchste politische Autorität Intellektuellen zum ersten Mal genau vor, welche Interpretation eines bestimmten Themas vorzulegen war. Fortan sollte die Parteiführung selbst als Richter über die Wahrheit auftreten – in der Geschichte und auf potenziell jedem anderen wissenschaftlichen und kulturellen Gebiet … Da die Unterscheidung zwischen Parteigehorsam und Staatstreue praktisch nicht mehr existierte, war jegliches Abweichen von der Parteilinie nicht nur falsch, sondern Treuebruch und Verrat.“120
Mitglieder des Politbüros, von denen zu vermuten wäre, sie hätten etwas Besseres zu tun, diktierten Autoren buchstäblich, was diese zu schreiben hatten.121 Jaroslawski etwa erhielt „persönliche Instruktionen von [Lasar] Kaganowitsch und Stalin, wie er sein [Buch zur Geschichte der Kommunistischen Partei] zu überarbeiten habe“.122
Zweitens versuchten die Führer der Kulturrevolution ebenfalls häufig, ranghohe nichtkommunistische Professoren aus ihren Ämtern zu drängen, um Platz für jüngere, marxistische Wissenschaftlicher oder für sich selbst zu machen. Ironischerweise blieben zahlreiche der vielgeschmähten „bürgerlichen Spezialisten“123 zu Hochzeiten der Kulturrevolution auf ihren Posten bzw. wurden auf ihre einflussreichen Stellungen in der Akademie zurückversetzt – im Falle der Geschichtswissenschaften |79|vor allem, weil ihre Sicht auf die vorrevolutionäre russische Geschichte der positiven Sicht des russischen Staates näher kam, die Stalin im Laufe der 1930er-Jahre zunehmend propagierte. Stalins Brief löste einen Prozess aus, welcher der Kulturrevolution im Allgemeinen praktisch ein Ende setzte. Im Dezember 1931 verlangte Kaganowitsch zur Krönung des Ganzen, der „Trotzkischen Kontrabande“ müsse man „auf bolschewistische Weise“ begegnen.124 Zentrale Figuren wie Paschukanis, Schulgin und G. E. Deborin (Philosophie)125 mussten sich der Kritik und Selbstkritik unterziehen und wurden gezwungen, ihre Meinungen zu widerrufen.
Die hier erörterten Wissenschaftsgebiete hatten Verschiedenes gemeinsam. Sie vertraten die Ansicht, dass sie insofern erkennbar marxistisch waren, als sie die Auswirkungen der gesellschaftlichen Basis bei der Erklärung von Ereignissen berücksichtigten. Und sie hatten eine ähnliche Vorstellung davon, wie das soziale und ökonomische Umfeld die menschliche Natur prägte. Spätestens 1932 war klar geworden, dass die stalinistische Führung und Stalin selbst mit solch einschränkenden Sichtweisen nichts zu tun haben wollten. Stalin suchte in der Geschichte nach Staatsgründerfiguren, nach heldenhaften Erbauern und nach wachen und zielstrebigen Menschen in allen Bereichen des alltäglichen Lebens. Was er nicht wollte, waren Wissenschaftler und Spezialisten, welche die Komplexität der Menschen und ihrer Aufgaben in den Mittelpunkt stellten oder den russischen Staat in einem schlechten Licht erscheinen ließen.