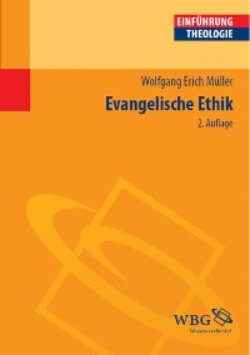Читать книгу Evangelische Ethik - Wolfgang Erich Müller - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеUnter der Voraussetzung eines allgemeinen Verständnisses von Ethik als einer Reflexion menschlichen Handelns muss, ohne weitere Priorität, die nebeneinander stehende Vielgestaltigkeit ethischer Lösungsversuche festgehalten werden. Die Unterschiede bestehen in der Motivation zum Handeln und in den sich daraus ergebenden Konsequenzen.1 Im Folgenden soll der Fokus einer allgemeinen Ethik auf den einer evangelischen Ethik begrenzt werden, um ihre spezifische Vorgehensweise und Problemlösungskompetenz aufzuzeigen. Damit ist kein Gegensatz intendiert, sondern das Verständnis der theologischen Ethik als einer besonderen, die an der allgemeinen Ethik partizipiert und ihr gegenüber dialogfähig bleibt. Auf diese Weise wird der gleiche Wirklichkeitsbezug und Wissenschaftscharakter beider Ausrichtungen der Ethik gewährleistet.
Im ersten Teil werden Grundbegriffe und entscheidende Verhältnisbestimmungen geklärt. Dann können Umrisse der gegenwärtigen kulturellen Situation gekennzeichnet werden, auf deren Herausforderungen auch eine theologische Ethik Antworten finden muss. Im zweiten Teil werden beispielhaft wichtige Ansätze evangelischer Ethik vorgestellt und in ihrem Weltbezug verglichen. Damit ist die Grundlage gegeben, das Spezifische einer evangelischen Ethik im Kontext gegenwärtiger philosophischer Ethik zu erarbeiten. Dies geschieht im dritten Teil unter den Hauptbegriffen von Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit. Mit Liebe ist eine Reflexion auf das ethisch relevante Datum des Rechtfertigungsgeschehens gemeint. Aufgrund dieser Zueignung der Gottesliebe können Menschen in Freiheit leben, also in der Identität christlicher Existenz. Daraus folgt ein sittliches Handeln, das am Sachverhalt der Gerechtigkeit reflektiert wird, womit sich individual- und sozialethische Reflexionen verknüpfen. Dann wird an einem wirtschaftsethischen Problemfeld versucht, den gewonnenen Ansatz evangelischer Ethik zu bewähren. Überlegungen zur ethischen Urteilsfindung und zur Positionsbeschreibung dieser Ethik schließen dieses Buch ab.
In der Darstellung habe ich, um dem Zweck eines Studienbuches gerecht zu werden, nämlich über das Fachgebiet zu informieren und die Möglichkeit zu geben, die dargelegten Positionen selbst zu erarbeiten, die zugrunde gelegte Primärliteratur auf ein überschaubares Maß beschränkt. Entsprechend habe ich auch bei der Sekundärliteratur nur wenige grundlegende Werke zur Überprüfung der hier gemachten Aussagen genannt. Zur weiteren Information möchte ich deshalb ausdrücklich auf die gängigen Lexika 3EKL, HCE, HWP, 3LThK, 4RGG, TRE und folgende grundlegende Werke hinweisen:
Christofer Frey: Theologische Ethik, Neukirchen-Vluyn 1990 (8); Ders. mit Peter Dabrock und Stephanie Knauf: Repetitorium der Ethik, Waltrop 31997 (9). Diese Arbeitsbücher weisen in ethische Hauptprobleme ein. Der theologische Standpunkt Freys ist von dem Versuch geprägt, die Ethik der Reformatoren mit der der so genannten Wort-Gottes-Theologie zu verbinden, was zu einer dezidiert theologischen Ethik in einem oft zu geringen Dialog mit nicht-theologischer Ethik führt.
Martin Honecker: Einführung in die theologische Ethik, Berlin/New York 1990 (10); Ders.: Grundriß der Sozialethik, Berlin/New York 1995 (11). Honecker bietet Antworten auf viele material-ethische Probleme. Wesentlich ist für ihn die Dialogfähigkeit zwischen theologischer und nicht-theologischer Ethik.
Dietz Lange: Ethik in evangelischer Perspektive, Göttingen 1992 (67). Lange gewichtet die Bedeutung der reformatorischen Rechtfertigungslehre für eine gegenwärtige theologische Ethik sehr stark und vermittelt zwischen den Typen evangelischer Ordnungs- und Bekenntnisethik.
Hartmut Kreß: Theologische Ethik, in: Ders. und Karl-Fritz Daiber: Theologische Ethik – Pastoralsoziologie, Stuttgart 1996 (13: 9 – 118). Kreß entfaltet nach einer Darstellung der Tendenzen evangelischer Ethik im 19. und 20. Jahrhundert die Personwürde als normatives Kriterium und exemplifiziert es an der Problematik der Technik.
Ulrich H. J. Körtner: Evangelische Sozialethik, Göttingen 1999 (12). Integrative Ethik, die aus der Perspektive der Rechtfertigungslehre über den Begriff der Verantwortung die Pflichtenethik mit der Güter- und Tugendlehre verbindet und auf praktisch-relevante Themenfelder bezieht.
Handbuch der christlichen Ethik, 3 Bde. Aktualisierte Neuausgabe, Freiburg 1993 (22). Standardwerk in evangelisch-katholischer Autorenschaft, das die verschiedenen Facetten christlicher Verantwortung in der modernen Gesellschaft darlegt.
Geschichtliche Darstellungen, wenngleich oft sehr summarisch, geben: Christofer Frey: Die Ethik des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart, Gütersloh 21994 (2); Jan Rohls: Geschichte der Ethik, Tübingen 21999 (7).
Zeitschriften: Zeitschrift für Evangelische Ethik, Gütersloh 1957 ff. (33); Ethica, Innsbruck 1993 ff. (39).
Hans Reiner: Die philosophische Ethik. Ihre Fragen und Lehren in Geschichte und Gegenwart, Heidelberg 1964 (226). Dieses Buch ist ein Klassiker der Darstellung philosophisch-ethischer Ansätze.
Friedo Ricken: Allgemeine Ethik, Stuttgart 3 1998 (227). Dieses Werk vermittelt einen kurz gefassten Grundriss ethischer Argumentation.
Bernhard Irrgang: Praktische Ethik aus hermeneutischer Sicht, Paderborn 1998 (203). Durch den hermeneutischen Zugang wird die konkrete Situation des Handelns betont, weniger aber auf die Begründung von Ethik reflektiert.
Julian Nida-Rümelin: Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, Stuttgart 1996 (217). In diesem Handbuch finden sich qualifizierte Beiträge, die die Anwendungsorientierung der Ethik für verschiedene Bereiche unserer gegenwärtigen Zivilisation deutlich werden lassen.
Otfried Höffe (Hrsg.): Lexikon der Ethik, München 51997 (25). Dieses praktische Hilfsmittel erschließt über seine Kurzartikel wichtige neuere Literatur und führt Hauptwerke der philosophischen Ethik auf.
Der Ansatz dieses Studienbuches ist im Verhältnis zu den vorgestellten Werken dadurch zu charakterisieren, dass hier die Möglichkeit einer evangelisch-theologischen Ethik im Pluralismus erarbeitet werden soll. Diesem Bezug auf die Gegenwart als herausforderndem Problemfokus entspricht die Voraussetzung einer Autonomie des Handels als Ausdruck heutiger Gewissensfreiheit. Für eine theologische Ethik ergibt sich daraus zwingend eine Klärung der Relation von Autonomie und Theonomie (siehe Kapitel I, 2 und II sowie III, 2d).