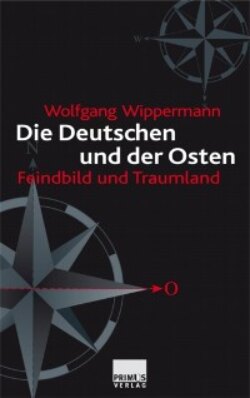Читать книгу Die Deutschen und der Osten - Wolfgang Wippermann - Страница 7
„Ex oriente lux“
ОглавлениеReligiöser und orientalischer Osten
„Ex oriente lux“ – aus dem Osten kommt das „Heil“ bzw. das „Licht“. In vielen Kulturen sind Licht und Heil fast identisch. Dies gilt auch für den antiken Mithraskult, der die – aufgehende – Sonne verehrte, und einen gewissen Einfluss auf das Christentum ausübte. Doch dies ist nicht der oder gar der alleinige Grund, weshalb das „Morgenland“ auch für Christen eine gewisse religiöse Bedeutung hat. Weit wichtiger ist, dass sich im Land der aufgehenden Sonne – „Orient“ – das „Heilige Land“ befindet, in dem Jesus Christus geboren, gestorben und „am dritten Tage auferstanden von den Toten“ ist. Hier wird er nach christlicher Überlieferung auch am „jüngsten Tag“ wieder kommen. Daher war Jerusalem auf vielen mappae mundi im Zentrum verortet als Nabel der Welt.1
Doch aus Jerusalem erwarten auch die Juden den Messias, und Muslime glauben, dass der Prophet Mohammed von hier aus in den Himmel gefahren ist. Jerusalem im Heiligen Land ist für drei Religionen heilig. Das führt zu einer Art Jerusalem-Konkurrenz und hat sich schon immer auf das Bild ausgewirkt, das sich das christliche Abendland vom gesamten Morgenland gemacht hat.
„Abendland“ und „Morgenland“
Das Christentum ist im Osten des damaligen Römischen Reiches entstanden, hat sich aber sehr schnell auch über dessen westliche Teile verbreitet. Im Jahr 391 wurde es Staatsreligion im gesamten Römischen Reich, das vier Jahre später in einen östlichen und westlichen Teil geteilt wurde, der schon 476 unterging. Diese politischen Vorgänge beeinflussten auch die Kirche und führten letztlich dazu, dass sie ebenfalls in einen westlichen und östlichen Teil zerfiel.
Diese Entwicklung begann bereits im 4. Jahrhundert, als die Bischöfe von Rom eine Sonderstellung innerhalb der vier Patriarchate – Jerusalem, Antiochia, Alexandria, Rom – beanspruchten. Dies mit dem Hinweis auf ihren „Vorgänger“, den Apostel Petrus, der in Rom ermordet und begraben wurde, nachdem ihn Jesus mit einer besonderen Befugnis ausgestattet und als „Fels“ bezeichnet hatte, auf den er seine „Gemeinde“ auf bauen wollte und dem er des „Himmelreichs Schlüssel“ übergeben hatte. Dies alles konnten die römischen Bischöfe zwar mit dem Hinweis auf Matthäus 16, 18–19 theologisch begründen, waren aber zunächst kaum in der Lage, diesen Anspruch auch politisch durchzusetzen.
Der oströmische (!) Kaiser Valentinian III. hatte nämlich 445 den Primat des als vicarius Christi (Stellvertreter) bezeichneten römischen Bischofs respektive Papstes nur für die Territorien des vor dem Zerfall stehenden weströmischen Reiches anerkannt. Das sechs Jahre später tagende Konzil von Chalkedon war noch einen Schritt weiter gegangen und hatte gegen den energischen Protest Papst Leos I. die Gleichrangigkeit der „Bischöfe“ (!) von Rom und Byzanz bestätigt. Auf dem 6. Ökumenischen Konzil von Konstantinopel wurde schließlich 681 die Vormachtsstellung Roms gegenüber Byzanz und dem Osten generell bestritten.
Die (römischen) Päpste waren in eine aus ihrer Sicht mehr als missliche Lage geraten. Um sich aus ihr zu befreien, griffen sie einmal zu moralisch anrüchigen und rechtlich verwerflichen Methoden wie dem Fälschen von Urkunden, die wie die (angebliche) donatio Constantini (konstantinische Schenkung) und die (völlig fiktiven) „pseudo-isidorischen Dekretalien“ ihren Machtanspruch beweisen sollten. Rechtlich korrekter und politisch erfolgreicher war dagegen das Bündnis mit dem Frankenreich, das schließlich im Jahr 800 mit der Krönung Karls des Großen zum imperator Romanorum durch Papst Leo III. besiegelt wurde. Gewissermaßen mit den Kaisern im Rücken konnten die Päpste jetzt ihre Macht, die schon in der Stadt Rom gefährdet gewesen war, im gesamten christlichen Abendland durchsetzen und sich zugleich von der Kirche im dann immer schwächer werdenden öströmischen bzw. byzantinischen Reich abgrenzen.
Dafür wurde die Spaltung der Kirche in einen westlichen und östlichen, katholischen und orthodoxen Teil (die beide wieder in weitere Kirchen zerfielen) in Kauf genommen. Alle Versuche, die schon 867 vollzogene und 1054 endgültig fixierte Spaltung zu überwinden, blieben erfolglos. Dieses Schisma hält bis heute an.
Die Kirchenspaltung hat zugleich dazu geführt, dass das gegenüber dem antiken2 gewissermaßen nach Nordosten gedrehte Europa3 auf seinen westlichen katholischen Teil verengt wurde. Dieses „christliche Abendland“ war zudem mit dem von Karl dem Großen begründeten und dann von den ostfränkischen, sächsischen und schließlich deutschen Kaisern erneuerten „Römischen Reich“ nahezu identisch. Obwohl die politischen Beziehungen zwischen diesem neuen „Römischen“ und dem vormals „oströmischen“ und jetzt „byzantinischen“ Reich zunächst gut waren, wovon nicht zuletzt die dynastischen Beziehungen etwa der Ottonen mit den byzantinischen Kaisern zeugen, grenzten sich beide Reiche immer mehr voneinander ab. Allerdings hat sich das „Reich der Deutschen“ nicht an dem vom Papst ausgerufenen vierten Kreuzzug beteiligt, der 1204 zur Eroberung Konstantinopels und zur Gründung eines „lateinischen Kaiserreiches“ führte, das zwar 1261 wieder unterging, aber zu einer nachhaltigen Schwächung des byzantinischen Reiches geführt hat.
Mit den von der Ostkirche missionierten Völkern im Osten und Südosten Europas gab es dagegen von Anfang an nur sehr lose Kontakte, die völlig abrissen, als fast ganz Russland unter die mongolische Fremdherrschaft geriet und die ebenfalls orthodoxen Balkanstaaten von den muslimischen Osmanen erobert wurden.
Generell ist festzustellen, dass der Antagonismus zwischen dem christlichen bzw. katholischen Abendland und dem orthodoxen Osten für „die Deutschen“ keine große Bedeutung hatte. Der von dem amerikanischen Politologen Huntington konstatierte „Kampf der Kulturen“ zwischen dem westlichen Katholizismus und der östlichen Orthodoxie ist auch in der Neuzeit nicht ausgebrochen, als das orthodoxe Russland wieder erstand und zur Großmacht wurde – und wird es auch in der Gegenwart nicht tun.4
Anders ist es mit dem Antagonismus zwischen dem gesamten christlichen Abendland und dem islamisch gewordenen Morgenland. Ihn hat es gegeben, und er hat auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf das Selbstverständnis Europas ausgeübt, das sich wesentlich durch die Abgrenzung vom Islam definiert, ja konstituiert hat. Der christlich-islamische Konflikt führte gleichzeitig zu einer Veränderung des Bildes, das sich das Abendland vom Morgenland machte. Verantwortlich war die religiöse Konnotation des Morgenlandes, in dem sich einige der wichtigsten heiligen Stätten beider Religionen befanden. Um ihren Besitz oder Nichtbesitz wurden sehr grausame und unheilige, „Kreuzzug“ und Jihad genannte „Heilige Kriege“ geführt. Beide Seiten verteufelten einander und wollten im Land des jeweils anderen das „Reich des Bösen“ erblicken. Dennoch hat es immer auch Gegenstimmen und Nebenströmungen gegeben. Mit Abendländern, die sich nach wie vor vom Morgenland angezogen fühlten, und mit Christen, für die Muslime nicht Feinde, sondern Brüder waren, wollen wir uns im Folgenden beschäftigen.
„Parzival“ und „Feirefiz“
Vom Morgenland angezogen wurden keineswegs nur aggressive Kreuzfahrer, sondern auch friedliche Pilger, die im Heiligen Land nur ihr Seeelenheil suchten. Auch die Kreuzfahrer zog es nicht immer aus religiösem Fanatismus in den Osten. Wussten und schätzten sie es doch, dass das Morgenland dem christlichen Abendland in kultureller und geistiger Hinsicht weit voraus war. Zeugnisse dieser überlegenen orientalischen Kultur haben sie dann auch mit zurück ins Abendland gebracht. Neben Gebrauchsgegenständen wie Gläsern und Teppichen sowie Gewürzen und Genussmitteln waren es auch Kenntnisse über den besseren Bau von Burgen und Häusern. So sollen sie die Idee, wenigstens einige Räume ihrer Burgen, die so genannten Kemenaten, zu beheizen, im vergleichsweise warmen Orient gewonnen haben. Doch weitaus wichtiger waren die geistigen Güter, nämlich die Schriften von antiken Philosophen und Naturwissenschaftlern wie Aristoteles und anderen, die ins Arabische übersetzt und so überliefert worden waren.5
Als ,geistige Umschlagplätze‘ zwischen dem weiter entwickelten Orient und dem vergleichsweise ,rückständigen‘ christlichen Abendland fungierten neben Spanien, in dem es geradezu zu einer kulturellen Symbiose von Orient und Okzident kam, auch Apulien und Sizilien. Diese Territorien waren aus normannischem in den Besitz der Staufer übergegangen und gehörten damit zum „Deutschen“ und späteren „Heiligen Römischen Reich deutscher Nation“. Der wegen seines unheiligen Lebenswandels (er soll sich nach orientalischer Sitte einen Harem gehalten haben) und wegen seiner antipäpstlichen Politik von der Kirche viel gescholtene Kaiser Friedrich II. hat sich für den ostwestlichen ,Kulturtransfer‘ besonders interessiert und um ihn verdient gemacht.6 Dafür war er persönlich bestens vorbereitet. Sprach und las er doch neben Deutsch (dies jedoch zunächst ziemlich schlecht) sowie Latein und Griechisch auch noch Arabisch.
Kaiser Friedrich II. stand mit seiner Bewunderung für den Orient nicht allein da. Sein Vorbild wurde auch von einigen Angehörigen der adligen Herrenschicht imitiert. (Wie das einfache Volk dachte, wissen die Historiker nicht, sofern sie sich überhaupt dafür interessiert haben.) Dies wirkte sich wiederum auf die mittelhochdeutsche Literatur aus. In ihr wurden die orientalischen Glaubensfeinde keineswegs immer als „Antichristen“ und „Teufelskinder“ bezeichnet und beschimpft, sondern nicht selten als ritterliche und durchaus ebenbürtige Gegner geschätzt. Bestes und eindrucksvollstes Beispiel ist Wolfram von Eschenbachs Epos Parzival.7
Wolfram von Eschenbach zeigte hier eine bemerkenswerte Missachtung des sonstigen fundamentalen Gegensatzes zwischen dem muslimischen Orient und dem christlichen Okzident. Sein Parzival spielt in beiden Welten und zeigt, dass in beiden gute und schlechte Menschen, Schurken und Helden leben. Einer dieser Helden ist Parzivals Vater Gahmuret, der sich nicht scheut, in den Dienst des (natürlich islamischen!) Kalifen von Bagdad zu treten. Hier, im ansonsten fremden und verteufelten Orient vollbringt Gahmuret verschiedene ritterliche Heldentaten. Er befreit die völlig schutzlose Königin von Sasamanc, Belakane, aus der Hand ihrer Feinde, um sich sogleich in sie zu verlieben. Dabei ist Belakane nicht nur Heidin, sondern auch noch von swarzer varwe. Trotz dieser ihrer rabens varwe gilt sie als schön und tugendhaft. Obwohl in doppelter Hinsicht ungleich – ungelich war doch ih zweier hut –, werden Belakane und Gahmuret ein Paar und bekommen einen Sohn namens Feirefiz, der von Wolfram von Eschenbach (dem die Mendelschen Vererbungsgesetze noch nicht bekannt waren) als zweifarbig – der zweier varwe was – wie eine Elster (als ein agelster wart gevar / sin har und och sin vel vil gar) geschildert wird.
Gahmuret verlässt dann zwar seine Belakane, um nach Europa zurückzukehren, doch nicht deshalb, weil er moralische Skrupel bekommen hat, sondern weil er weitere Abenteuer erleben möchte. An seiner Liebe zu Belakane hält er auch noch fest, als er durch einen Schiedsspruch verurteilt wird, Herzeloyde zu heiraten, die ihm Parzival gebiert. Ohne das zunächst zu wissen, begegnet dann der erwachsene Parzival seinem Halbbruder Feirefiz, durch den er im ritterlichen Kampf besiegt, aber in noch ritterlicherer Weise am Leben gelassen wird. Beide Brüder erkennen sich und ziehen gemeinsam zur Gralsburg, wo es Parzival mit Hilfe von Feirefiz gelingt, Gralskönig zu werden.
Diese Geschichte ist schön. Schön wegen ihrer religiösen und, wenn man will, sogar „rassischen“ Toleranz. Vor allem aber ist sie ein Beispiel dafür, dass das deutsche Bild des Orients im Mittelalter ganz offensichtlich nicht völlig negativ (nämlich unzivilisiert und bedrohlich) war wie das englische und französische, auf das sich Edward W. Said in seinem Orientalismus-Buch gestützt hat.8
„Mohren“ aus dem „Morgenland“
Beim deutschen Türkenbild der frühen Neuzeit war dies anders. Es scheint sogar noch negativer gewesen zu sein als das westeuropäische. Dennoch gab es auch hier Ausnahmen und Unterströmungen zur allgemeinen Turkophobie, auf die noch (im nächsten Kapitel) einzugehen ist. Bewundert und sofort übernommen wurden vor allem die türkischen Genussmittel. Allen voran der Kaffee, der 1683 nach der Niederlage des türkischen Heeres von den Wienern im verlassenen türkischen Heerlager gefunden und nicht nur zu ihrem, sondern auch vieler Deutschen Lieblingsgetränk wurde. Trotz aller Mahnungen, dass doch eigentlich nur „der Muselman“ vom „Kaffee nicht lassen kann“. Hieß es doch in einem Lied: „K-A-F-F-E-E / Trink doch nicht zu viel Kaffee / Du bist doch kein Muselman / Der das nicht lassen kann.“
Adlige und sonstige Reiche, die es sich leisten konnten, wollten auch von ihren, wie der (viel) spätere Sarotti-Mohr in türkische Gewänder gekleideten „Kammermohren“ nicht lassen, die sie sich aus der Türkei kommen ließen und als eine Art Statussymbol hielten.9 Dabei kamen diese „Kammermohren“ ursprünglich gar nicht aus der Türkei. Es handelte sich um Afrikaner, die versklavt und an Türken verkauft worden waren. Das Image dieser „Mohren“ genannten Afrikaner war weitaus besser als das der später direkt aus Afrika geholten „Neger“. Beweis und Beispiel sind die „Mohrenköpfe“, die bürgerliche und adlige Häuser und Wappen zierten. Einige dieser „Mohren“ galten sogar als „edel“. Der bekannteste ist einer der drei Könige oder Weisen aus dem Morgenland – der schwarze Balthasar.
Eindeutig türkischer Herkunft sind auch einige Musikinstrumente wie die Pauke und der von der Bundeswehr heute noch bei Großen Zapfenstreichen und bei der Begrüßung ausländischer Staatsgäste verwandte Schellenbaum. (Nach einer leider unbestätigten Meldung soll sich ein afrikanischer Staatsgast einmal statt vor der Fahne vor diesem mit Rossschweifen drapierten Schellenbaum verbeugt haben, weil er ihn für das deutsche Staatssymbol gehalten hat.) Türkische Musikinstrumente wurden ursprünglich nur innerhalb der ebenfalls von den Türken erfundenen Militärmusik gebraucht. Dann fanden sie jedoch auch Eingang in die ,zivilen‘ Opern. Und damit sind wir natürlich bei Mozarts Entführung aus dem Serail.
„Nie werd’ ich deine Huld verkennen“
Diese erstmals 1782 aufgeführte Oper spielt in der Türkei, sprich dem Osmanischen Reich (ungefähr des 16. Jahrhunderts) und handelt von Türken, die Belmontes Geliebte Konstanze entführen und „im Mohrenland gefangen“ halten. Aus den zunächst noch recht bösen werden dann einigermaßen gute Türken. Dies gilt selbst für den Sultan Selim, der am Schluss Konstanze und Belmonte (sowie ihren Bedienten Pedrillo und Blondchen) die Freiheit schenkt, was diese gerührt anerkennen: „Nie werd’ ich deine Huld verkennen.“
Keineswegs islam- oder orientfeindlich ist auch Mozarts im September 2006 ins Gerede gekommene und des Antiislamismus verdächtigte Oper Idomeneo.10 Schon deshalb nicht, weil sie nicht im Orient, sondern im mehr mythischen als realen Kreta spielt, weshalb natürlich auch keine Muslime auftreten. In der Idomeneo-Oper geht es wie in der Entführung aus dem Serail letztlich um Toleranz, für die der überzeugte Freimaurer Mozart plädierte. Tatsächlich sind die Anlehnungen an bestimmte freimaurerische Ideen in der „Entführung“ (sowie natürlich in der „Zauberflöte“) unverkennbar.
Dass sich Mozart dafür ausgerechnet den Orient ausgesucht hat, hatte ebenfalls etwas mit seiner freimaurerischen Zugehörigkeit zu tun. Haben sich doch viele Freimaurer durch eine gewisse schwärmerische Liebe für den Orient ausgezeichnet, aus dem sie wirklich das „Licht“ erwarteten. Ablesbar ist dies einmal an einigen ihrer geheimen Riten und Rituale, die sie aus dem Orient übernommen haben wollen, sowie an den Namen einiger ihrer Logen wie der berühmten „Loge vom Großen Orient“.11 Man könnte daher von einem freimaurerischen „Orientalismus“ reden, der aber einen keineswegs negativen Charakter hatte und eher zu dem zu rechnen ist, was Said die romantic presentations of the Orient nennt.12 Ein, wenn man will „romantisches“, auf jeden Fall aber äußerst positives Orientbild findet man auch bei dem wohl berühmtesten Freimaurer. Gemeint ist Johann Wolfgang Goethe.
„Herrlich ist der Orient“
Goethe ist in seinem dichterischen Werk mehrmals und in der Regel äußerst positiv auf den „Orient“ eingegangen. So vor allem im West-Östlichen Divan.13 Hier hat Goethe die kulturbringende Funktion des Orients mit folgenden, viel zitierten Worten gepriesen: „Herrlich ist der Orient / übers Meer gedrungen: / Nur wer Hafiz liebt und kennt, / weiß, was Calderon gesungen.“14 Dem politisch zerfallenen und zerberstenden Westen stellt er den „reinen Osten“ gegenüber: „Nord und West und Süd zersplittern, / Throne bersten, Reiche zittern, / Flüchte du, im reinen Osten / Patriarchenluft zu kosten.“15 In diesen „reinen“ und „rechten“ Ursprung aller Kultur solle man zurückkehren: „Dort, im Reinen und im Rechten / Will ich menschlichen Geschlechten / In des Ursprungs Tiefe dringen.“16 Nur in der Vereinigung von Orient und Okzident liege der Frieden: „Gottes ist der Orient! / Gottes ist der Okzident! / Nord und südliches Gelände / Ruht im Frieden seiner Hände.“17
Die Völker des Orients und des Okzidents sollten sich nicht länger gegenseitig verachten, sondern gemeinsam nach „demselben trachten“: „Und wo sich die Völker trennen, / Gegenseitig im Verachten, / Keins von beiden wird bekennen / Daß sie nach demselben trachten.“18
Goethe stand mit seiner Verehrung des „herrlichen Orients“ keineswegs allein da. Der Orient ist auch von anderen deutschen Dichtern gefeiert und als Ursprung aller Kultur angesehen worden. Ein ebenfalls vergleichsweise positives Orientbild vertraten auch die meisten deutschen Orientalisten. Insgesamt war das deutsche Bild des Orients im 19. Jahrhundert weitaus positiver als das französische und englische.
Erwähnung verdient in diesem Kontext noch ein anderer Deutscher, der zwar kein so positives Bild des Orients wie Goethe, dafür aber ein mit Sicherheit noch wirkungsvolleres als Goethe geschaffen und verbreitet hat. Wer kann das sein? Natürlich Karl May!
„Kara Ben Nemsi“ und der „kranke Mann am Bosporus“
In den insgesamt sechs Werken Karl Mays, die ausschließlich oder überwiegend im Orient spielen,19 wird der orientalische Raum insgesamt als rückständig und wild gekennzeichnet.20 Am ausgeprägtesten ist dies im Wilden Kurdistan der Fall. Unter den Orientalen gelten die Türken als schlecht und tückisch. Im negativen Sinne übertroffen werden sie nur noch von den (christlichen!) Armeniern.21 So heißt es in Karl Mays Erzählung Der Kys-Kaptschij: „Wo immer Heimtücke, eine Verräterei geplant ist, da ist sicher die Habichtsnase eines Armeniers im Spiele. Wenn selbst der gewissenlose Grieche sich weigert, eine Schurkerei auszuführen, findet sich ohne Zweifel ein Armenier, welcher bereit ist, den Sündenlohn zu verdienen.“22
Die Araber dagegen sind zwar auch räuberisch und rachedurstig, doch immerhin gastfreundlich und freiheitsliebend. Insofern ähneln sie etwas den Indianern, ohne jedoch den Rang der Apachen zu erreichen, die von Karl May als wild und edel charakterisiert werden. Vom edlen Winnetou ist Hadschi Halef Omar23 weit entfernt. Er wird niemals zum Freund, sondern bleibt in Abhängigkeit von seinem deutschen Herrn Karl Deutsch alias Kara Ben Nemsi, der ihn mit einer gewissen Herablassung behandelt, aber zugleich auch zu einem tapferen (Hilfs-)Krieger erzieht. Insofern ist Halef eine Verkörperung dessen, was der „kanke Mann am Bosporus“ für Deutschland werden sollte.24
Mit diesem vom russischen Zaren Nikolaus I. schon 1852 geprägten Stereroyp war das Osmanische Reich gemeint, dessen Erbe sowohl Russland wie England und Frankreich antreten wollten. Deutschland hielt sich wie vorher schon Preußen, das im Krimkrieg neutral blieb, zurück und begnügte sich mit der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit mit der Türkei. Im Unterschied zu England und Frankreich, die ihre imperialistischen Ansprüche auf große Teile des orientalischen Ostens mit gewissen „orientalistischen“ Feindbildern begründeten, wobei sich Frankreich selbst auf die mittelalterlichen Kreuzfahrerstaaten im „Morgenland“ berief,25 hat Deutschland wenigstens zunächst auf derartige antiislamische und antiorientalische Stereotype und Feindbilder verzichtet. Auch dies ist ein weiterer Beweis für die schon mehrfach betonte Tatsache, dass das westliche Bild des Orients weitaus schlechter war als das deutsche.
Harem, Zigaretten und Porzellan
Deutschen und westeuropäischen Männern gemein war jedoch im 19. Jahrhundert ein lüstern wirkendes Interesse an den orientalischen Frauen im Allgemeinen und den Haremsdamen im Besonderen. Davon zeugen zahlreiche Harems-Geschichten und noch mehr Harems-Bilder, die alle zwar ziemlich sexistisch sind, aber dennoch mehr Ausdruck einer Anziehung als Abscheu vor dem orientalischen Osten waren.26
Sehr geschätzt wurden im gleichen Zeitraum auch die orientalischen Zigaretten. Dafür sorgte schon die (damals nicht verbotene) Tabakwerbung, die mit exotisierenden Bildern des Orients den Kauf von Zigaretten anpries, die aus Tabak aus dem Orient hergestellt worden waren. Als Werbeträger dienten aber keine orientalischen Frauen, sondern türkisch oder arabisch aussehende Männer. Sie wurden erst im 20. Jahrhundert von Cowboys und anderen Marlboro-Men verdrängt.
Positiv konnotiert waren auch noch andere Produkte aus dem Orient. Dazu gehörte das ursprünglich aus dem Fernen Osten, nämlich aus China stammende Porzellan. Im 18. Jahrhundert war es das Luxusgut par excellence. Dies zeugt zugleich von der bis weit ins 19. Jahrhundert anhaltenden Bewunderung, die viele Europäer für China und die Chinesen hegten. Doch dann wurden aus den notorisch weisen Chinesen „gelbe Teufel“.27 Die in diesem Zusammenhang lancierten Warnungen vor der „gelben Gefahr“ dienten zur Legitimierung der imperialistischen Ansprüche der europäischen Mächte auf große Teile Chinas.28
Doch das gehört eigentlich nicht mehr zum Thema Orient und Orientalismus. Jedenfalls nicht in Deutschland, denn hier wurden – anders als in England und Frankreich – China und der gesamte Ferne Osten spätestens seit dem beginnenden 20. Jahrhundert nicht mehr zum Orient gerechnet. Mit dem Bild, das sich die Deutschen vom Osten gemacht haben, hatte all dies nur noch wenig zu tun. Mit Osten meinte und meint man bis heute meist den europäischen Osten. Mit seinem wandelnden und ambivalenten Bild wollen wir uns in den nächsten Kapiteln beschäftigen.