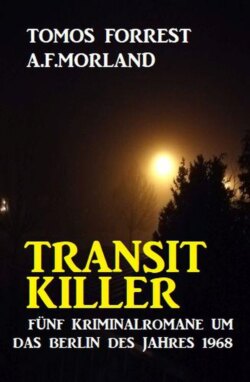Читать книгу Transit Killer: 5 Kriminalromane um das Berlin des Jahres 1968 - A. F. Morland - Страница 12
Оглавление5
Nach einer Flugzeit von etlichen Stunden traf Bernd Schuster in Honolulu ein. Es war ein kurzweiliger Flug gewesen, denn Bernd hatte die Bekanntschaft einer reizenden jungen Frau gemacht.
Sie war klein und zierlich und trug ein nettes, einfaches Strickkleid, das ihre gut proportionierten Körperformen wunderbar zur Geltung brachte.
Ihr Name war Isabella Karges. Sie hatte rabenschwarzes Haar. Es war in der Mitte gescheitelt und fiel zwanglos, aber wirkungsvoll auf die Schultern. Ihr Gesicht war ein wenig herzförmig, ihr Teint blass.
Die Frau konnte nicht älter als dreiundzwanzig sein, und ihre schiefergrauen Augen verrieten sehr viel Intelligenz.
Ihre Nase war klein und fein geformt, und der Mund war sorgfältig geschminkt.
Es stellte sich rasch heraus, dass Isabella auch aus Deutschland stammte und noch dazu Lehrerin in Berlin war. Eine Freude für die Schüler. Verstehend, verzeihend und obendrein auch noch nett anzusehen.
Sie wollte auf Hawaii ihren Urlaub verbringen. Allein.
Im Flugzeug hatte sie Bernd gestanden: „Eigentlich bezwecke ich mit dieser Reise nichts Anderes als vor meinen Problemen davonzulaufen.“
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie überhaupt Probleme haben“, hatte Bernd erwidert.
„Oh, doch. Doch, die habe ich“, hatte Isabella Karges geantwortet. Ihr Blick war daraufhin traurig geworden. Leise hatte sie fortgesetzt: „Vor zwei Wochen wurde meine Ehe geschieden.“
„Das tut mir leid.“
„Es braucht Ihnen nicht leid zu tun. Es war die Hölle. Wissen Sie, wie lange ich verheiratet war? Eineinhalb Jahre. Davon war ich einen ganzen Monat lang glücklich. Ist das nicht schon viel? Manche Frauen haben nicht einmal das. Nach vier Wochen ließ mein Mann dann die Maske fallen. Er sagte mir ganz offen ins Gesicht, dass er es satthabe, sich zu verstellen. Er zeigte sich mir von diesem Tag an nur noch, wie er wirklich war. Ich hätte es vor meiner Ehe nicht für möglich gehalten, dass es so etwas geben kann. Harald trank, kam nächtelang nicht nach Hause, er spielte, und er brachte billige Flittchen ins Haus. Wenn ich dagegen protestierte, verprügelte er mich ... Ich bin froh, dass dieser Alptraum ein Ende hat.“
„Das kann ich verstehen“, hatte Bernd geantwortet.
Nun trat er mit Isabella Karges aus der Halle des Honolulu International Airport.
Da sich herausgestellt hatte, dass Isabella im selben Hotel wie Bernd wohnen würde, fuhren sie in einem Taxi dorthin.
Die junge Lehrerin blickte aus dem Fenster. „Ist es nicht paradiesisch hier, Herr Schuster?“
„Wie lange werden Sie bleiben?“, fragte Bernd.
„Vierzehn Tage. Dann geht es wieder zurück ins triste Berlin. Aber bis dahin habe ich ein reichhaltiges Programm zu absolvieren. Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten, die ich mir unbedingt anschauen muss: den Lolani Palast, das Bishop Museum, den Kapiolani Park ... Ich werde Ausflüge nach Pearl Harbor und zum Oceanic Sea Life Park machen. Und ich werde selbstverständlich so oft wie möglich baden. Darauf freue ich mich schon sehr.“
„Die Zeit wird Ihnen bestimmt zu knapp werden“, meinte Bernd und schmunzelte.
„Umso besser. Wenigstens komme ich nicht dazu, nachzugrübeln, was ich in Berlin zurückgelassen habe.“
Sie erreichten das Hotel. Es war direkt am Strand gebaut worden. Der Ausblick von allen Zimmern war traumhaft. Das leise Rauschen der Palmen wurde vom lauteren Rauschen des Meeres übertönt.
Bevor sich Bernd von Isabella Karges verabschiedete, sagte er: „Sollten Sie sich wider Erwarten einsam fühlen ... Meine Zimmernummer ist einhundertelf.“
Die Frau nickte und dankte für die Einladung.
Auf seinem Zimmer duschte Bernd kurz. Danach zog er sich um, bestellte einen Leihwagen vor das Hotel, setzte sich in den schneeweißen Mustang und fuhr in Richtung Waikiki Beach, wo sich ein Bungalowdorf befand, in dem die Reichen und die Superreichen unter sich waren.
Eine prachtvolle Anlage, die alles das bot, was vom gut betuchten Feriengast verlangt wurde. Man konnte Golf und Tennis spielen. Es gab die Möglichkeit, zu reiten, zu tauchen, Wasserski zu fahren oder sich beim Windsurfen zu versuchen. Außerdem gab es in der riesigen Anlage einen großen Süßwasserpool, in dessen Mitte eine kleine Insel angelegt worden war.
Das Restaurant bot erlesene Gaumenfreuden an, und zu trinken gab es hier mehr als anderswo.
Auch hier gab es jede Menge Palmen. Dazwischen prachtvolle Tropengewächse mit phantasievollen Blüten in allen erdenklichen Farben.
In einem der zahlreichen Bungalows wohnte Karsten Wertheimer.
Bernd hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz vor dem Feriengelände abgestellt und war nun zu Fuß auf der Suche nach Wertheimer. Der Mann von der Information hatte den Weg zu Wertheimers Heim so umständlich erklärt, dass Bernd Schuster prompt falsch lief.
Er betrat eine schattige Terrasse. Im Haus kicherten zwei Mädchen. Bernd ging auf die offene Terrassentür zu. Er schlug den Vorhang zur Seite und betrat den großen Wohnraum.
Auf dem Teppichboden lag ein Mann, dessen Gesicht Bernd sofort wiedererkannte. Das war Ben Stentor. Eine Größe im Showgeschäft.
Es gab nichts, was Stentor nicht gekonnt hätte. Er war Tänzer, Sänger und Schauspieler. In Hollywood zahlte man ihm Supergagen.
Seine Filme spielten jedes Mal ein Vermögen ein. Und wenn er als Entertainer in Las Vegas auftrat, musste der Saal polizeilich umstellt werden.
Dieser Ben Stentor lag also auf dem Teppichboden, trug nur eine winzige Badehose und alberte mit zwei kurvigen Blondinen herum.
Bernd räusperte sich. Daraufhin schaute Ben Stentor ihn an. „Sie wünschen?“, fragte er, während er sich erhob. Er war muskulös und durchtrainiert. Und er sah verdammt gut aus. Das blonde Haar war etwas in Unordnung geraten, doch das störte nicht.
Die beiden Frauen, von denen die eine einen knallroten, die andere einen rabenschwarzen Tanga trug, standen ebenfalls auf.
Sie waren ein bisschen außer Atem.
„Entschuldigen Sie die Störung, Herr Stentor“, begann Bernd. Der Schauspieler war nicht erstaunt, dass Bernd Schuster ihn mit seinem Namen ansprach.
Jedes Kind in den Staaten wusste, wer Ben Stentor war.
„Sie haben sich wohl verlaufen, wie?“, fragte der Star. Es klang nicht spöttisch, sondern freundlich. Dahinter lag die Bereitschaft, zu helfen.
„Ich suche Herrn Wertheimer“, sagte Bernd.
Jetzt musterte Ben Stentor Bernd Schuster mit interessiertem Blick. „Dann sind Sie wohl der Privatdetektiv aus Berlin, Bernd Schuster.”
„Ganz recht. Sie sind gut informiert, Herr Stentor.“
„Wertheimer hat viel über Sie gesprochen.“
„Wo finde ich ihn?“, fragte er freundlich.
„Er wohnt in dem Bungalow nebenan. Machen Sie sich auf einiges gefasst, Herr Schuster.“
„Warum?“
„Wertheimer erwartet, dass Sie für ihn ein Wunder vollbringen.“ Stentor sah besorgt aus.
„Ich habe noch keine Ahnung, worum es geht. Würden Sie mir ...?“
Ben Stentor schüttelte entschieden den Kopf. „Ich möchte nicht vorgreifen. Im Übrigen ist es mir lieber, wenn ich mich aus dieser Sache heraushalten kann. Ich habe Ferien, und ich gedenke sie zu genießen.“ Der Star schlang seine Arme um die schmalen Taillen seiner gut gebauten Mädchen und sagte: „Ehrlich gesagt, ich beneide Sie nicht um Ihren Job.“
Bernd verließ den Bungalow.
Er begab sich nach nebenan und klopfte an die Eingangstür.
Vor zwei Jahren hatte Bernd den Multi-Millionär zum letzten Mal gesehen. Es schien, als wären seit damals zwanzig Jahre vergangen.
Karsten Wertheimer wirkte alt und resigniert. Von seiner einstigen Vitalität und Spannkraft schien nichts mehr übrig zu sein.
Seine Augen lagen in schattigen Höhlen. Die sonnengebräunte Haut wirkte faltig und fahl.
Bernd begab sich mit Wertheimer in den luxuriös ausgestatteten Wohnraum. Compact-Anlage, Farbfernseher, Hausbar - alles war vorhanden. Bernd setzte sich mitten in die silbergraue Wohnlandschaft aus Samtvelours.
„Was für ein Glück, dass Sie ausgerechnet jetzt Urlaub in New York machten. Und ich danke Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind, Herr Schuster“, begann Karsten Wertheimer. Er trug einen weißen Seidenanzug, der tadellos saß.
„Ihr Anruf hörte sich so an, als würde es hier brennen“, erwiderte Bernd Schuster.
„Möchten Sie etwas trinken?“
„Orangenjuice. Keinen Alkohol. Jedenfalls nicht vor dem Abend. Am Tag ist es hier zu warm dafür.“
Bernd bekam seinen Juice. Wertheimer blieb vor ihm stehen. Er schien zu nervös zu sein, um sitzen zu können.
Der Millionär seufzte schwer. „Es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden, Herr Schuster. Leider muss es sein: Meine Tochter Sylvia ... sie lebt nicht mehr. Jemand hat sie grausam umgebracht. Erwürgt.“
Bernd stellte das Glas weg. „Was sagen Sie da?“ Damit hatte Bernd Schuster nicht gerechnet.
„Der Mörder meiner Tochter war ganz in Schwarz gekleidet und trug eine schwarze Wollmaske über dem Kopf.“
„Woher wissen Sie das?“, fragte Bernd und steckte sich eine Roth Händle an.
Wertheimer berichtete, was er von Frank Köhler erfahren hatte. Die Polizei hatte dem Millionär versprochen, alles zu tun, um den geheimnisvollen Mörder schnellstens zu finden.
„Ich habe selbstverständlich Vertrauen zur hiesigen Polizei“, erklärte Wertheimer, „es sind wirklich tüchtige Leute. Aber ich möchte alle Möglichkeiten ausgeschöpft wissen, die zur Klärung dieses sinnlosen Verbrechens beitragen können, deshalb habe ich Sie, Herr Schuster, gebeten, hierherzukommen. Ich mache das mit Ihrer Tochter und Ihrer ... Freundin wieder gut.“
Der Millionär war den Tränen nahe. Aber er schämte sich deren nicht.
Bernd konnte dem Mann das nachfühlen. Bernd hatte Sylvia gekannt. Wenn sie auch mal von zu Hause ausgerückt war, das war nichts weiter als eine Jugendtorheit gewesen.
Sylvias Kern war gut gewesen. Ein solches Kind zu verlieren, war für einen Vater sehr schmerzlich. Zumal es das Liebste war, was er noch hatte.
Wertheimer wandte sich ab. Er wischte sich über die feuchten Augen. Dann holte er einen Plan, den er vor Bernd auf dem Couchtisch ausbreitete.
Er zeigte dem Detektiv, wo das Kapitalverbrechen verübt worden war. Bernd nahm sich vor, sich am Tatort bei der nächsten Gelegenheit umzusehen.
Karsten Wertheimer schüttelte den Kopf. „Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Sylvia nicht mehr lebt. Sie war ein so lebenslustiges Ding. Sie konnte vom Leben nicht genug kriegen. Am Nachmittag nahm sie noch ihre Tennisstunde. Und wie sie hinterher von ihrem Tennislehrer, geschwärmt hat ... abends war sie mit Frank Köhler, einem deutschstämmigen Amerikaner, tanzen. Sie war überall beliebt. Alle Jungs mochten sie. Dennoch konnte ich Sylvia voll vertrauen. Sie wusste stets, wie weit sie gehen durfte ... Und nun ... nun ist dieses fabelhafte Mädchen tot. Erwürgt von einem Unbekannten, dem sie bestimmt niemals etwas zuleide getan hat. Ich verstehe es nicht, Herr Schuster. Ich verstehe es einfach nicht...“
„Haben Sie Feinde, Herr Wertheimer? Vielleicht gibt es jemanden, der Ihnen Ihren Reichtum neidet.“
„Sehen Sie sich doch in diesem Feriendorf um, Herr Schuster. Ich bin bei Gott nicht der einzige, der viel Geld hat. Im Gegenteil. Es gibt noch wesentlich reichere Leute als mich.“
Bernd leerte sein Glas. Er steckte den Tatortplan mit Wertheimers Erlaubnis ein und erhob sich.
„Werden Sie diese maskierte Bestie, die mir so großes Leid zugefügt hat, finden, Herr Schuster?“, fragte Karsten Wertheimer heiser.
„Ich werde mir die größte Mühe geben“, erwiderte Bernd ernst. Das war ein Versprechen. Bernd Schuster würde jetzt alles versuchen, was in seiner Macht stand. Das wusste jeder, der ihn kannte.