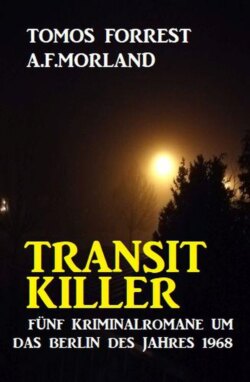Читать книгу Transit Killer: 5 Kriminalromane um das Berlin des Jahres 1968 - A. F. Morland - Страница 6
Mord auf der Transit-Strecke
ОглавлениеBerlin 1968 Kriminalroman Band 21
von Tomos Forrest & A. F. Morland
Das Unmögliche war passiert.
Man hatte zum dritten Mal einen LKW entführt, diesmal sogar auf der Transitstrecke nach West-Berlin. Und es hatte einen Toten gegeben. Genug Kosten für die Berliner Versicherung, nun Bernd Schuster einzuschalten, um diese Diebstähle aufzuklären. Der ehemalige Feldjäger aus Frankfurt und inzwischen sehr erfolgreiche Privatdetektiv erlebt wenig später lebensgefährliche Situationen, als er sich selbst als LKW-Fahrer probiert...
––––––––
1
„Darf ja wohl nicht wahr sein!“, stöhnte Fred Stettner und schaltete herunter.
„Was meinst du?“, erkundigte sich sein Beifahrer Hans Kersten verwundert.
„Vopos. Sie sind eben wie aus dem Nichts erschienen und fahren immer im gleichen Abstand hinter und her. Kannst davon ausgehen, dass die was von uns wollen!“
„Hast du die Geschwindigkeit eingehalten?“
„Überwiegend!“, antwortete Fred und musste doch grinsen. Die beiden fuhren die Transitstrecke nach West-Berlin schon lange, und Fred bildete sich ein, inzwischen jede noch so versteckte Radar-Kontrolle zu kennen.
„Na, das wird wieder lustig. Und ich dachte, wir kommen heute gut durch!“, stöhnte Hans.
„Mach dich startklar, mein Freund – sie schalten das Blaulicht an und kommen!“
Tatsächlich schoss der Wartburg mit dem Blaulicht an ihnen vorüber, der Beifahrer gab Zeichen mit der Handkelle, und langsam rollten die Fahrzeuge hintereinander auf dem Seitenstreifen aus.
Fred Stettner griff zu seiner Tasche mit den Papieren und kurbelte das Fenster herunter.
„Guten Tag!“, begrüßte sie der Beamte, der eben an den LKW trat. „Verkehrskontrolle. Die Fahrzeugpapiere, Führerschein, Transitvisum. Was haben Sie geladen?“
„22 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, Drei-Achser, 12 Meter Gesamtlänge, alles nach Vorschrift und Norm. Geladen haben wir Elektrogeräte und eine versiegelte Kiste von BASF. Meine Papiere, bitte!“, schnurrte Fred den üblichen Sermon herunter und beobachtete den zweiten Beamten, der mit kritischem Blick auf der Beifahrerseite den LKW inspizierte.
Der andere prüfte ungerührt und mit aller Gründlichkeit die ihm gereichten Papiere, gab sie zurück und erkundigte sich dann:
„Wissen Sie, warum wir Sie herausgewunken haben?“
Fred stellte fest, dass der Mann nur einen leichten Berliner Dialekt hatte und fühlte sich schon fast wieder heimisch. Aber hier war keine Frozzelei angebracht, und höflich erwiderte er: „Nein, das weiß ich nicht.“
„Sie haben vor etwa zwei Kilometern beim Fahrbahnwechsel nicht geblinkt.“
„Was habe ich nicht? Fahrbahnwechsel? Ich habe doch überhaupt nicht überholt!“, bemerkte Fred Stettner verblüfft.
„Es gab dort eine Baustelle, die Fahrbahn wurde auf eine Fahrspur verengt.“
„Und da muss ich blinken, wenn es nur noch eine Fahrspur gibt?“
„Selbstverständlich. Die Verwarnung für diesen Verstoß gegen unsere Verkehrsordnung beträgt 20,—DM“, führte der Beamte weiter aus und schrieb bereits einen Strafzettel aus.
„Zwanzig?“, echote Fred ungläubig, aber der Polizist sah noch nicht einmal auf.
Brummend zog der Fahrer seine Geldbörse hervor, entnahm einen Zwanzig-Mark-Schein und reichte ihn wortlos aus dem Fenster.
Der Volkspolizist steckte das Geld ebenfalls wortlos ein und reichte den Strafzettel hoch.
Dann wollte er sich abwenden, nachdem sein Kollege schon wieder neben dem Wartburg stand, drehte sich aber noch mal zur Fahrerkabine um.
„Nur ein kleiner Tipp für Sie. In etwa fünftausend Metern gibt es eine weitere Baustelle. Lastkraftwagen müssen dort die Transitstrecke verlassen und eine Umleitung fahren. Achten Sie aber darauf, dass Sie auf dieser Strecke nicht anhalten dürfen und die Geschwindigkeiten dort reduziert sind. Sie kommen dann bei Wollin wieder auf die Transitstrecke.“
„Vielen Dank!“, antwortete Fred durch die Zähne, sah zu, wie die Beamten in ihr Fahrzeug stiegen und startete dann den Motor wieder. Beim Wechsel auf die Fahrbahn blinkte er natürlich und fuhr langsam an, während der Wartburg vor ihm mit etwa 80 Stundenkilometern vorweg fuhr.
Keiner der beiden in der Fahrerkabine sprach etwas, bis sie in der Ferne die Warnbaken und die Umleitungsschilder für Kraftfahrzeuge über fünf Tonnen erkannten.
„Wenn diese blödsinnige Transitstrecke nicht wäre, könnte ich mir keinen anderen Job als diesen vorstellen“, sagte nach einer Pause Fred Stettner zu seinem Beifahrer. Hans Kersten zuckte nur mit den Schultern. Kein Kommentar zu diesem Thema. Was hätte er schon sagen sollen? Fred war ein Wahnsinniger. Wäre es in der Bundesrepublik erlaubt gewesen, könnte sein Fahrer 24 Stunden hinter dem Steuer sitzen, wurde nicht müde, und wenn er dann abgelöst wurde, freute er sich schon auf die nächste lange Tour hinterm Steuer. So einem Irren war einfach nicht zu helfen. Wozu also irgendein Wort verlieren, das ja doch bloß in den Wind gesprochen wäre.
„Hinter einem Schreibtisch würde ich eingehen wie ’ne Primel“, sagte Stettner. „Ich brauch ’nen 22-Tonner wie diesen unterm Hintern, um mich wohlzufühlen. Ich brauche eine Straße, auf der ich meinen Laster bewegen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hans, aber für mich ist jede Fahrt, als würde ich die Welt neu entdecken.“
‚Blödsinn‘, dachte Hans. ‚Er ist doch nun wirklich jede Strecke schon zigmal gefahren. Da gibt es nichts mehr zu entdecken. Nicht mal für einen Wirrkopf wie ihn!‘
Fred verlangsamte das Tempo und näherte sich der Umleitung. Gegen Umleitungen war Fred allergisch. Die mochte er nicht, denn sie führten zumeist über schlechte Straßen, zumal bei dem Zustand der Straßen in der DDR. Sein schwerer Mercedes-Benz mit den kantigen Formen war zwar nicht sonderlich anfällig. Aber Fred war schon mehrfach in der DDR unterwegs gewesen zum Verwandtenbesuch. Natürlich ohne Lastwagen. Bei diesen Straßenverhältnissen konnte durchaus eine Achse brechen oder ein Stoßdämpfer kaputtgehen, und das war dann bestimmt für Fred Stettner genauso schlimm wie für einen normalen Menschen ein Beinbruch.
Während Stettner mit grimmiger Miene an der Lenkung drehte, grinste Hans Kersten breit. „Jetzt kannst du die Welt tatsächlich mal neu entdecken, Fred.“
Ein missmutiges Knurren war Stettners Antwort. Er zog den LKW in eine enge Kurve und begann mit der Entdeckungsfahrt. Ein schmales S lag vor ihnen. Sie entfernten sich von der Transitstrecke. Kein weiteres Fahrzeug folgte ihnen und war auf der Straße zu erkennen. Büsche und Bäume deckten alsbald die Sicht nach hinten ab. Und plötzlich schrie Fred Stettner erschrocken auf. Er leckte sich nervös über die Lippen. Schnell leitete er die Notbremsung ein. Der LKW stand auf kürzeste Distanz.
‚Eines muss man ihm lassen‘, dachte Hans Kersten. ‚Sein Fahrzeug hat er prima in der Hand. Und er versteht wunderbar schnell zu reagieren.‘
Hätte Stettner nicht so schnell gebremst, dann hätte der 22-Tonner möglicherweise den Mann überrollt, der mit dem Gesicht nach unten auf der Umleitungsstrecke lag.
„Mensch, da liegt einer“, sagte Stettner erregt.
„Du merkst aber auch alles“, brummte Hans Kersten. Er schwang die Tür auf und sprang aus dem LKW.
Stettner hatte plötzlich ebenfalls Hummeln im Hintern.
„Warte! Ich komme mit!“, rief er und sprang auf der anderen Seite heraus. Die kräftige Maschine tuckerte im Leerlauf weiter. Kersten erreichte den Mann. Stettner kam heran und kniete sich auf den Boden. Plötzlich wurde der Beifahrer bleich. Der vermeintlich Hilfsbedürftige ließ sowohl Fahrer als auch Beifahrer in die Mündung einer Pistole blicken.
Und dann kam viel Leben in den Mann. Er rollte sich auf den Rücken und schwang den Körper hoch.
„Damit wir uns von Anfang an richtig verstehen, Kameraden: Dies hier ist ein Überfall.“
Kersten fletschte die Zähne. „Was denn, was denn! Du willst den LKW doch nicht etwa ganz alleine überfallen!“
Das Gesicht des Fremden war mit schwarzer Farbe beschmiert. Er trug eine riesige Sonnenbrille auf der Nase und hatte den Kragen seiner Windjacke hochgeschlagen.
„Du hast recht“, sagte der Unbekannte grinsend. „Allein wär’s ein bisschen zu riskant.“ Weiße Zähne blitzten in seinem Mund. Und das Zahnfleisch leuchtete in hellem Rosa. „Aber ihr habt es nicht nur mit mir zu tun.“
„Blödsinn!“ sagte Fred Stettner zornig. Er hatte sich erhoben und begann einzusehen, dass es ein Fehler war, hilfsbereit zu sein. Überrollen hätte er den Kerl sollen. Dann wäre es nicht zu dieser Situation gekommen.
„Schaut euch um!“, schlug der Gangster vor. „In diesem Augenblick zielen zwei halbautomatische Waffen auf Euch!“
„Dann seid ihr also zu dritt“, erwiderte Hans trocken.
Stettner schaute sich um und sah tatsächlich zwei Typen, die genau wie derjenige aussahen, der vor ihnen stand. Die drei hätten Brüder sein können. Vielleicht sogar Drillinge.
„Was habt ihr vor?“, fragte Stettner überflüssigerweise.
„Kannst du dir das mit deinem Spatzenhirn nicht denken?“, fragte der Gangster zurück.
„Sie wollen den LKW, Fred“, klärte der Beifahrer den Fahrer auf.
‚Den LKW!‘ Stettner fuhr ein Eissplitter ins Herz.
„Ihr habt sie wohl nicht alle!“, brüllte er aus Leibeskräften. Dass die anderen Männer näherkamen, schien ihn nicht einzuschüchtern.
„Den LKW kriegt ihr nie im Leben!“
„Spiel bloß nicht den Helden, Kamerad!“, schnauzte der Gangster. „Sonst kriegst du ein Loch in die Haut. Oder auch mehrere. Wir sind nicht kleinlich.“
„Ich reiß euch die Ohren ab, wenn ihr an meinen LKW geht!“
„Halt keine Volksreden! Dreh dich um!“, schnarrte der Gangster. Die beiden anderen standen nun dicht hinter ihm. Ihre Mienen waren verschlossen. Ihre Gesichter waren ebenfalls schwarz angeschmiert. Sie machten einen furchterregenden Eindruck - zumindest auf den Beifahrer, der wusste, wann eine Sache brenzlig war, und wann man die Schnauze halten musste. Ohne, dass der Verbrecher ihn dazu aufforderte, sich umzudrehen, wandte er sich um. Was jetzt kommen würde, ahnte er. Da er es aber nicht verhindern konnte, fand er sich damit ab. Es würde ein kurzer Schmerz sein. Und dann würde er umkippen. Eine Weile Ohnmacht. Und wenn er die Augen wieder aufschlug, würde alles vorbei sein.
Nicht so Stettner. Der stellte sich auf die Hinterbeine, und genau das war das Dümmste, was er tun konnte. Damit reizte er die Gangster, die ohnedies in Eile und nervös waren. Die beiden LKW-Fahrer dachten in diesem Augenblick auch noch an ihre besondere Lage. Man befand sich auf dem Gebiet der DDR. Da würden doch wohl auch diese Typen jederzeit mit einer Entdeckung rechnen müssen – und die würde kaum glimpflich für sie abgehen.
„Umdrehen!“, befahl der Gangster dem Fahrer.
„Ihr kriegt meinen LKW nicht!“, brüllte Fred Stettner. „Meinen LKW kriegt ihr nicht!“ Er ballte seine mächtigen Fäuste. Im nächsten Moment explodierte seine Rechte am Kinn des Verbrechers. Der Mann flog zurück und wurde von seinen Freunden aufgefangen.
Hans Kersten floss Eiswasser über den Rücken, als er sah, was Stettner machte.
‚Was ich von ihm immer dachte: Er ist verrückt! Er hat keinen Verstand!‘, hämmerte es im Kopf des Beifahrers.
Fred schnellte herum und eilte mit langen Sätzen zum LKW. Die Gangster ließen ihm nicht die geringste Chance. Ein Bein hatte er bereits auf dem Trittbrett, als die Schüsse fielen und ihn um die eigene Achse rissen. Gleich darauf stürzte der Fahrer schwer auf das Straßenpflaster.
Hans blieb das Herz stehen, als er sah, wie es mit seinem Kumpel zu Ende ging. Warum hatte er sich bloß so sehr für diesen verdammten LKW eingesetzt? Warum hatte er dem Tod keine kurze Ohnmacht vorgezogen?
Hans Kersten vernahm ein knirschendes Geräusch hinter sich. Instinktiv kniff er die Augen zusammen und wartete auf den Schlag, der in seinem Nacken oder am Hinterkopf landen würde.
Da kam er auch schon. Hart, und für keinen noch so kräftigen Mann durchzustehen. Ein riesiges schwarzes Loch tat sich vor dem Beifahrer auf. Er merkte, wie er darauf zufiel und sogleich darin verschwand ...
2
Am Abend des 21. November steuerte Bernd Schuster seinen silbergrauen Mercedes 450 SEL die restlichen Meter durch die Kurfürstenstraße, bog in die Parkstraße vor der alten Ladenzeile ein, in der er seine Detektei betrieb.
Sturmwolken, von einem böigen Wind getrieben, waren den ganzen Tag über den Himmel gezogen. Der Wind war jetzt abgeflaut, und Regen fiel grau wie ein Stahldraht im Licht der gelben Straßenlampen. Bernd Schuster stieg geschafft aus seinem Wagen, schloss ihn ab und ging hinüber, um noch einmal in seinem Büro nach dem Rechten zu sehen.
Auf seinem Schreibtisch hatte ihm Franziska Jahn, seine überaus attraktive Lebensgefährtin und Assistentin, eine kleine Überraschung aufgebaut.
Da stand der Kassettenrecorder, und auf einem weißen Kärtchen war der Befehl zu lesen: EINSCHALTEN!
Bernd fingerte die Roth Händle heraus, sank auf den Schreibtischsessel und brannte eine Zigarette an. Mit einer fahrigen Bewegung versuchte er sich den Schlaf aus den Augen zu wischen. Er drückte die Wiedergabetaste.
„Hallo, Bernd“, kam die aufgekratzte Stimme Franziskas aus dem Gerät. „Na, wie war die Blondine?“
„Oooch, ganz annehmbar - he! Moment, woher weißt du?“ Bernd drückte auf die Stopptaste und staunte erst mal richtig. Er hatte Franziska gegenüber mit keiner Silbe erwähnt, dass er sich mit einer blonden Mandantin treffen wollte. Wie hatte sie das bloß wieder herausbekommen?
Er ließ sie weiterreden.
„Hier war nicht allzu viel los. Horst Rogers und Ron Myers haben je einmal angerufen. Ja, und auch der alte Horsti Sielmann hat sich wieder mal gemeldet. Der Ärmste wähnt sich auf dem Abstellgleis, seit du dich nicht mehr zum Angeln bei ihm gemeldet hast.“
Bernd nickte gedankenverloren. Der gute Horsti. Er kannte alle Angelplätze, ob an der Spree, der Havel oder am Wannsee oder irgendeinem anderen Teich. Aber die Wochenenden, an denen Bernd tatsächlich dafür Luft hatte, waren in letzter Zeit immer spärlicher gesät. Er musste sich mal wieder dazu aufraffen und einfach zum Angeln hinauszufahren. Das war er seinem Körper und auch dem alten Horst einfach schuldig.
‚Schon notiert!‘, dachte Bernd und hörte sich an, was Franziska ihm weiter zu berichten hatte.
„Es ist jetzt 16.55 Uhr. Also gleich Betriebsschluss für mich. Ich will noch zu Keysers und ein paar Dinge für den Kühlschrank im Büro einkaufen, auch wenn wir weder kalte Getränke noch Eis in dieser Jahreszeit benötigen,“ sagte Franziska. „Doch bevor ich mich für heute empfehle, kann dich dir noch Grüße von Rudolf R. Reineke zu bestellen.“
RRR, dachte Bernd. Der Direktor der Berliner LKW Versicherung. Was will er?
„Du sollst ihn auf jeden Fall noch heute anrufen“, sagte Franziska, als hätte sie Bernds geistige Frage gehört. „Ganz gleich, wie spät es ist. Er sagte, er könne ohnedies kein Auge zu tun.“
„Ich auch nicht!“, maulte Bernd. Noch heute. Das war ihm gar nicht recht.
Franziska nannte die Privatnummer von RRR. Bernd kritzelte sie auf einen Zettel, dann stellte er den Kassettenrecorder ab, und das Kärtchen mit dem Befehl EINSCHALTEN warf er grimmig und demonstrativ in den Papierkorb.
Ohne den Eifer, mit dem er normalerweise seine Aufgaben anging, grapschte er sich den Telefonhörer. Ein letzter Zug noch von der Roth Händle, dann drückte er sie im Aschenbecher aus. Sobald er die Nummer gewählt hatte, vernahm er das Freizeichen. Wenige Sekunden später hob RRR bereits ab.
„Sagen Sie mal, schlafen Sie auf dem Hörer?“, fragte Bernd und unterdrückte ein neuerliches Gähnen.
„Wer spricht?“, fragte Reineke nervös.
„Oh - verzeihen Sie: Bernd Schuster.“
„Schuster!“, klang es erleichtert.
Bernd dachte: Was ein Name oft ausmacht.
„Endlich“, sagte RRR. Und das klang vorwurfsvoll.
„Ich war unterwegs. Bin eben erst nach Hause gekommen, Herr Direktor. Tut mir leid, dass ich mich nicht früher melden konnte. Womit kann Ihnen mein Büro für private Ermittlungen dienen?“
„Möchten Sie viel Geld machen, Schuster? Mit einem einzigen Fall?“
„Bitte keine Scherze, Herr Reineke. Nicht mehr um diese Stunde. Wie viel Geld ist für Sie viel Geld?“
„Zehn Prozent von 170.000 D-Mark.“
„Wie kommen Sie ausgerechnet auf 170.000?“
„Hören Sie zu, Bernd! Wir beide arbeiten nicht zum ersten Mal zusammen, und ich habe Sie immer eine schöne Stange Geld verdienen lassen.“
„Dafür habe ich aber auch Arbeit geleistet, die Ihre Versicherungsdetektive nicht zu leisten imstande waren.“
„Diesmal scheint das wieder mal der Fall zu sein.“
„Was ist passiert?“
„LKWs werden überfallen.“
„Davon habe ich gelesen“, sagte Bernd.
„Bisher hat es drei Überfälle gegeben. Diesmal jedoch sogar entlang der Transit-Strecke auf dem Gebiet der DDR. Die LKWs werden gestoppt, Fahrer und Beifahrer werden ausgeschaltet, die Gangster fahren mit den Lastern weiter, und wenn die Polizei sie dann wiederfindet, ist die Ladung verschwunden. Insgesamt macht der Schaden nun schon eine Höhe von 170 000 Mark aus.“
„Um was für Frachtgut handelt es sich hierbei?“, wollte Bernd wissen.
„Zwei Ladungen Haushaltsgeräte und einmal Rohstoffe für einen chemischen Betrieb hier in West-Berlin.“
„Und es werden immer nur LKWs überfallen, die bei der Berliner LKW Versicherung versichert sind?“
„Bisher ja. Übernehmen Sie den Fall, Bernd? Sie kriegen zehn Prozent Erfolgshonorar. Das heißt, Sie verdienen bei jedem Stück, das Sie wiederbeschaffen.“
Bernd dachte nicht lange nach. „Ja, geht in Ordnung, Herr Reineke. Aber ganz ehrlich: Nur, weil Sie es sind. Ich bin dermaßen überarbeitet...“
RRR antwortete schnell: „Dann erwarte ich Sie morgen um neun in meinem Haus.“
„Einverstanden“, sagte Bernd und legte auf. Und weil er gerade so in Schwung gekommen war, hörte er sich auch gleich an, was auf dem automatischen Anrufbeantworter drauf war.
Er erkannte die krächzende Stimme sofort. Das war Manfred Keller, einer seiner zuverlässigsten V-Leute.
„Tagchen, Schuster!“, sagte der Bursche, dessen Informationen hin und wieder Goldwert hatten. Er räusperte sich. Mit einem Anrufbeantworter umzugehen ist nicht jedermanns Sache. Es fehlt der Gesprächspartner.
„Hm. Tja - ich denke, jetzt kann ich einfach drauflosreden, was? Ist schon ein verdammter Dreck, dass Sie nicht persönlich an der Strippe sind, Schuster. Also, ich hätte da wieder mal was Heißes aufgeschnappt. Sie können’s von mir hören. Für ’nen Fünfziger spuck ich's Ihnen, wohin Sie wollen - ja. Wie weiß ich denn nun, ob Sie an der Sache interessiert sind oder nicht? Wenn doch keiner dran ist! Ach was. Ich plappere es mir einfach mal von der Seele. Also fünfzig Eier für eine Information, die für Sie von großer Wichtigkeit ist, Bernd Schuster. Ich schlage vor, Sie laden mich morgen zum Mittagessen ein. Sagen wir ins Fiesta, ist‘n mexikanisches Restaurant beim Nollendorfplatz, kennt man. Ich werde um zwölf da sein. Und Sie sollten mich nicht allzu lange dort im Trockenen hocken lassen, sonst würde man mich aus dem Lokal entfernen, weil ich die Zeche nicht bezahlen kann. Und das würde letzten Endes Ihnen leidtun. Diesmal ist’s nämlich verdammt wichtig für Sie, was ich zu erzählen habe! Hm - hoffentlich klappt das jetzt mit dem Apparat. Sonst ersitze ich mir morgen Schwielen beim Mex.“
Außer diesem Anruf war nichts mehr auf dem Band. Während Bernd mit dem Zeigefinger nachdenklich die Kanten des Geräts entlangstrich, überlegte er, was denn so „verdammt wichtig“ für ihn war. Er kam nicht dahinter, strengte sich aber auch nicht besonders mit dem Nachdenken an, denn die Müdigkeit kehrte zurück, und diesmal zwang sie ihn in die Knie. Er schloss die Räume sorgfältig ab, fuhr mit dem Fahrstuhl in den 14. Stock und war erstaunt, dass seine Tochter Lucy nicht anwesend war. Dann fiel ihm wieder ein, dass sie ja dieses Wochenende bei seiner Ex zubringen würde, duschte ausgiebig und legte sich bald darauf hin.
Der am Fenster vorbeirauschende Regen schläferte ihn ein.
Als er die Augen wieder aufschlug, schien die Sonne durchs Fenster herein. Franziska steckte ihren Kopf durch die Tür und rief: „Was ist denn hier los, Bernd? Kaum bin ich mal nicht über Nacht bei dir, da liegst du bis zum Mittagessen noch im Bett?“
Bernd schnellte hoch.
„Wie spät ist es, Franzi?“
„Es ist immerhin schon halb neun.“
„Gütiger Himmel!“, schrie Bernd erschrocken auf. Um neun sollte er bei Reineke sein. Mit Schwung schleuderte er die Decke fort.
Franziska zog sich zurück und bereitete in der Küche inzwischen den Kaffee. Bernd erledigte alles im Laufschritt. Franziska wollte ihn, während er den Kaffee in sich hineinschlürfte, über die Blondine von gestern Abend ausfragen. Sie machte das geschickt und dezent, aber Bernd merkte es trotzdem, und er führte seine Franzi mit seinen Antworten schlau im Kreis, bis sie es aufgab. Dafür und für den Kaffee erhielt sie einen Kuss. Dann war Schuster draußen aus seiner Wohnung. Er hatte nicht einmal Zeit gehabt, Franzis neues Kleid zu bewundern, und sie hatte es sich eigentlich nur für ihn gekauft.
Bernd verspätete sich um ganze fünf Minuten. Das war zu verschmerzen.
RRR residierte im Norden der Stadt. Sein Haus stand inmitten eines großzügig geschnittenen Grundstücks.
Der Versicherungsdirektor empfing Bernd persönlich, andere Besucher wurden zuerst von einem Angestellten aufgehalten. Ein Zeichen dafür, wie gern Schuster in diesem Haus gesehen war. Und ein Zeichen auch dafür, wie dringlich dem Leiter der Berliner LKW-Versicherung die Angelegenheit war.
Rudolf R. Reineke war ein großer, stämmiger Mann, etwa fünfzig Jahre alt und dick. Er machte keinen angenehmen Eindruck. Vielleicht lag das an seinen stechenden Augen. Es war seine Art, sich die Männer auszusuchen, die er mochte, und denen sagte er das auch. Den anderen sagte er, dass sie ihn ankotzten. So war RRR.
Ein schütterer Schnurrbart vegetierte auf seiner Oberlippe dahin. Vom rechten Auge lief eine Narbe bis fast zum Mundwinkel. Die Narbe zog das Augenlid etwas herunter, was dem Mann ein finsteres Aussehen gab. Reineke war noch in den letzten Kriegswochen eingezogen worden, obwohl er eine nie ausgeheilte Sportverletzung am Bein hatte.
Deshalb hielt er stets in der Rechten einen massiven Spazierstock mit dickem Gummipuffer an der Spitze.
„Wie auf Nadeln bin ich gesessen“, sagte Reineke einleitend. Er führte Bernd in sein Wohnzimmer, in dem es vor Kostbarkeiten nur so wimmelte. Natürlich warf allein seine Direktorentätigkeit bei der Berliner LKW-Versicherung nicht so viel für RRR ab. Aber wer einmal ziemlich hoch oben ist, der kriegt da und dort einen Aufsichtsratsposten zugeschanzt, es fallen da und dort Anerkennungshonorare ab - und dann kann man sich diesen Luxus eben leisten.
Zwei Cognac-Schwenker waren bereits angerichtet. Der Angestellte vom Empfang zeigte sich ganz kurz an der Tür.
„Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, Herr Reineke ...“
„Nichts. Gar nichts. Gehen Sie, ruhig. Ich brauche Sie nicht.“
Die Tür wurde so leise geschlossen, als bestünde sie aus Watte. Bernd setzte sich in einen der bequemen Sessel. Er trank etwas von dem Cognac. Dann bat er RRR, über die Vorfälle zu berichten.
„Alle drei LKWs waren bei uns versichert“, wiederholte der Versicherungsmann, während er sein Glas auf dem Tisch hin und her schob. Daneben lag eine Mappe. Vermutlich für Bernd vorbereitet.
„Und für welche Unternehmen waren die LKWs unterwegs?“, fragte Bernd.
„Sie fahren alle für dieselbe Spedition.“
„Für welche?“
„Für Carsten Fröhlichs Spedition.“ RRR klopfte auf die Mappe. „Hier drinnen finden Sie die Aufstellungen aller gestohlenen Waren, Schuster. Die Gangster haben, wie schon gesagt, im vergangenen Monat dreimal zugeschlagen. Aber diesmal übertrafen sie alles an Dreistigkeit. Es gab auf der Transitstrecke eine Baustelle, die von den Lastwagen weiträumig über das Gebiet der DDR umfahren werden musste. Dabei gab es einen Toten, der zweite Mann lag ohnmächtig am Straßenrand und wurde dort von der Volkspolizei entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach einigen Verwicklungen hat man dann die Spedition benachrichtigt.“
„Auf dem Gebiet der DDR? Ach, es geht um den Fall, der ja nun wirklich einigen Staub aufgewirbelt hat und sogar diplomatische Verwicklungen hervorrief, weil man den Mann festhalten wollte. Irgendetwas mit Verletzung der öffentlichen Sicherheit! Ein Witz, wenn man bedenkt, dass sein Fahrer erschossen wurde!“ Bernd Schuster, aber Reineke hielt sich damit nicht weiter auf.
„Seltsamerweise erwischten die Verbrecher immer die wertvollste LKW-Ladung. Wir sind der Meinung, dass ihnen das irgendjemand steckt, aber wer das ist, das entzieht sich unserer Kenntnis.“
Bernd schmunzelte. „Wenn Sie’s wüssten, würden Sie sich nicht an mich wenden, Herr Reineke.“
„Das ist richtig. Es muss sich um eine Person handeln, die Einblick in die Frachtbriefe der Firma Fröhlich hat.“
„Vielleicht sitzt die Person mitten in der Firma“, meinte Bernd. Er hatte den Zeitungsbericht des letzten Überfalls noch gut im Gedächtnis, schließlich war das für die Boulevardpresse ein gefundenes Fressen. Der LKW - mit Fred Stettner und Hans Kersten besetzt - war aus dem Ruhrgebiet kommend nach West-Berlin unterwegs gewesen. Stettner hatte den Helden gespielt und war von den Gangstern kurzerhand erschossen worden. Folglich war ein Fahrerposten bei der Firma Fröhlich nunmehr vakant. Bernd sagte das dem Versicherungsmann, und er fügte hinzu: „Ich werde mich um diesen Fahrerjob bemühen.“
„Was versprechen Sie sich davon?“, fragte RRR.
„Die Möglichkeit, meinen Finger an den Pulsschlag des Unternehmens legen zu können. Wenn dort etwas nicht richtig tickt, erfahre ich es so am schnellsten. Schließlich kann ich ja wohl schlecht zur Volkspolizei gehen und sie bitten, mir alle Einzelheiten mitzuteilen. Nein, da stecken wir in einer Sackgasse, ich denke mal, nur direkt vor Ort kann ich Erfolg haben.“ Schuster erhob sich, nahm von Reineke die Mappe entgegen und ließ sich hinausbegleiten, nachdem er dem mit sorgenvoller Miene zurückbleibenden Versicherungsdirektor versprochen hatte, sich gelegentlich wieder zu melden.
Von da an lief die Aktion.
Mit seinem Mercedes kehrte Bernd Schuster zu seinem Büro zurück. Hier, im Allerheiligsten, arbeitete er sorgfältig die Unterlagen durch. Die Überfälle waren detailliert geschildert. Es gab Skizzen, Fotografien von den beiden ersten Tatorten, Fotokopien der Aussagen, die die LKW-Besatzungen gegenüber der Polizei gemacht hatten. Und natürlich waren auch ellenlange Warenaufstellungen vorhanden, damit sich Bernd ein Bild davon machen konnte, was die LKWs geladen hatten. Erstaunlicherweise befand sich sogar ein Bericht der Volkspolizei an die West-Berliner Polizeibehörde darunter, in der es allerdings nur sehr wenige Details gab.
„Da ist wohl diesmal kein Einsatz für mich drin, Bernd“, sagte Franziska bedauernd.
„Willst du etwa einen LKW steuern?“, fragte Bernd grinsend.
„Warum nicht? In Russland tun das auch Frauen.“
„Zum Glück sind wir nicht in Russland.“
„Legst du Wert auf ein paar Informationen?“
„Worüber weißt du Bescheid, Franzi?“
„Über die Fröhlichs“, sagte Franziska. Sie zupfte an ihrem Kleid herum. Jetzt konnte es Bernd nicht mehr länger übersehen. Er lobte es gründlich genug und meinte, das Kleid allein wäre ein Anlass, sie zum Essen einzuladen, aber leider wäre er bereits mit Manfred Keller verabredet. Dann bat er sie, ihn über die Fröhlichs zu informieren.
Franziska berichtete: „Ich kenne ein Mädchen, das mit Daniela Fröhlich, der Tochter von Carsten Fröhlich, befreundet ist. Carsten Fröhlich soll ein wahrer Despot sein. Und Tobias Fröhlich, sein Sohn, ist ein elender Taugenichts. Mutter gibt es keine mehr. Die hat sich von Carsten vor vielen Jahren schon scheiden lassen. Die einzig Vernünftige in der Familie ist Daniela.“
Bernd nickte schmunzelnd.
„An die werde ich mich halten. Vielen Dank für deinen Tipp.“
Es ging auf zwölf zu. Manfred Keller war an der Reihe. Bernd griff nach Hut und Mantel den Kopf, legte die Mappe, die er von RRR bekommen hatte, in seine Schreibtischlade und machte sich zum zweiten Mal an diesem Tag auf den Weg.
Eigentlich hätte er die kurze Strecke zum Nollendorfplatz zu Fuß zurücklegen können. Aber einmal pfiff ein eisiger Novemberwind um die Ecken, und Bernd zögerte nicht lange, stieg in seinen Wagen und fuhr los. Glücklicherweise gab es einen Parkplatz, der hinter dem Restaurant lag. Er fuhr an den großen spiegelnden Fenstern vorbei und entdeckte Manfred Keller an einem der Tische. Er nagte unentwegt an der Unterlippe daran. Sein Blick war gehetzt. Er wirkte nervös, schaute sich mehrmals ängstlich um, als trüge er ein Geheimnis mit sich herum, das so gefährlich war wie eine Zeitbombet. Es roch herrlich nach mexikanischen Gewürzen, nach Tequila und Zigarillos. Aus verborgenen Lautsprechern plätscherten mexikanische Weisen. Die Wände waren mit Ponchos und Sombreros und vielerlei anderem Klimbim dekoriert.
Ein Mann im knallroten Kellnerfrack trat in diesem Moment an den Tisch, an dem Manfred Keller saß. Keller hatte bereits das Tischtuch zerknüllt. Vor ihm stand nichts weiter als die Gewürzbox. Er war nicht gut genug gekleidet für dieses Lokal, das wusste er, aber er hatte es noch niemals von innen gesehen, und diesmal war die beste Gelegenheit, das nachzuholen. Wenn Schuster bezahlte, konnte er sich auch das Steigenberger oder ein anderes Hotel mit Luxusrestaurant leisten.
Aus den Augenwinkeln sah Keller den knallroten Frack. Er wollte dem Mann sagen, dass er jemand erwarte und deshalb noch nichts bestellen wollte.
„Später!“, stieß Keller nervös hervor. Und plötzlich stockte ihm der Atem. Er kannte das Gesicht, das ihn feindselig anstarrte. Das war kein Kellner dieses Lokals. Der Mann hatte sich bloß irgendwo die Jacke „geliehen“. Ein weißes Serviertuch lag über dem rechten Arm des Mannes. Darunter ragte der klobige Aufsatz eines Schalldämpfers heraus. Keller hatte längst begriffen.
„Oh mein Gott!“, stöhnte er verstört.
Ein seltsames Geräusch, wie ein trockener Husten. Schon am Nachbartisch war dieses Geräusch kaum mehr zu hören, und wenn, dann verwechselte man es da gewiss mit dem Entkorken einer Weinflasche.
Keller zuckte entsetzt zusammen. Dann saß er still und regte sich nicht mehr. Der Kellner wandte sich ohne Eile um. Sein eiskalter Blick streifte durch das Lokal. Dann ging er in Richtung Küche davon.
Bernd Schuster orientierte sich nach dem Eintreten kurz, entdeckte Keller und den Kellner und ging auf die beiden zu. Sieben Tische befanden sich noch zwischen Bernd Schuster und Keller. Eben wandte sich der Kellner um und ging in Richtung Küche. Keller war plötzlich nicht mehr unruhig. Er saß da und schien ein ernstes Problem zu wälzen. Er war ein kleines, schmuddeliges Männchen. Und an diesem Tag trug er seinen besten Anzug. Bernd kannte ihn schon eine Ewigkeit. Er war vor Jahren im Verlauf eines Falles auf ihn gestoßen. Damals war Keller im Kreise der Verdächtigen gewesen, und die Polizei wollte ihn gern zum Sündenbock stempeln. Bernd hatte ihn mit vollem Einsatz aus der Klemme herausgehauen. Und das noch dazu ohne einen Pfennig zu verlangen. Das rührte den Burschen so sehr, dass er Bernd fortan mit heißen Informationen belieferte, die er an Spieltischen, schmuddeligen Bars oder in irgendwelchen Hinterhöfen aufschnappte. Keller war überall zu Hause. Klar, dass solche Leute ein gutes Ohr für wichtige Informationen kriegen.
Nun stand Bernd Schuster vor Keller. Aber Manfred würdigte ihn keines Blickes.
„Du kriegst die Tür nicht auf“, grinste Bernd. „Erst bestellt er mich hierher, und dann will er mich nicht kennen ...“
Auf einmal überlief ihn ein Schauder und hinterließ eine Gänsehaut. Bernd holte tief Luft. Er schaute Keller in die Augen. Sie waren gebrochen. Und nun sah er auch das Loch in der Brust. Schusters Kopfhaut zog sich schmerzhaft zusammen. Keller war vor seinen Augen ermordet worden. Und zwar von diesem Kellner.
Bernd wirbelte herum. Wo war der Kerl? Neben der Küche gab es einen Gang zu den Waschräumen. Diesen Weg musste der Mörder eingeschlagen haben. Bernd Schuster startete. Er eilte zwischen den Tischen hindurch. Als er den Anfang des Ganges erreichte, sah er einen roten Zipfel verschwinden. Er stürmte weiter. Da kam von links, aus den Damentoiletten, eine junge Straßenwalze. Sie schob sich mitten in den Gang. Bernd prallte gegen sie. Sie flog gegen die Toilettentür, stieß einen krächzenden Schrei aus und japste nach Luft.
„’tschuldigung!“, keuchte Bernd und wollte weiterrennen. Da begann die Fette mit ihren schwammigen Fäusten nach seinem Gesicht zu dreschen. Er hatte Glück, dass sie ihn zweimal verfehlte. Beim dritten Mal traf sie sein Kinn. Da wurde er böse. Er gab ihr einen Schubs. Nun war sie wieder in der Toilette, der Weg war frei.
Mit schnell hämmerndem Herzen erreichte Bernd die Tür, durch die der falsche Kellner entkommen war. Mit einem Sprung war er draußen. Hier lag der Garten, in dem die Gäste im Sommer saßen.
Keine Spur mehr von dem Mörder. Bernd eilte mit langen Sätzen über den geharkten Kies. Tische und Stühle waren beiseite geräumt. Atemlos erreichte er eine hohe Hecke, die den Restaurantgarten begrenzte. Mit einem federnden Satz warf er sich in das blattlose Gezweig. Etwas schrammte über sein Gesicht. Das brannte wie Feuer. Dann war er durch.
Eine schmale Straße lag vor ihm. Leer, wenn man von den geparkten Autos absah. Bernd schickte dem Mörder einen wüsten Fluch nach. Dann kehrte er ins Restaurant zurück. Auf dem Weg dorthin versuchte er sich das Gesicht des Mörders ins Gedächtnis zu rufen.
Plötzlich schlug in seinem Inneren ein Misston an. Es war ihm, als müsse er dieses Gesicht kennen. Der Mann war ihm irgendwie bekannt - gleichzeitig aber war er ihm auch fremd.
Grübelnd öffnete Bernd die Hintertür. Da kam die Fette erneut. In ihrem Schlepptau hing der unglückliche Geschäftsführer, der Ärger aller Art gern vermieden hätte.
„Da!“, schnaufte die Dicke. Sie stank nach Schweiß, nach hindustanischem Parfüm und nach billiger Seife. Ihre aufgerissenen Augen stachen wie Dolche. Ihr gewaltiger Busen quoll vor Erregung aus dem mit ganz und gar unpassend zierlichen Spitzen besetzten Dekolleté.
„Da ist der Mann!“
Der Geschäftsführer trat hinter der Fetten hervor. Seine schwarzen Brauen standen verlegen schräg.
„Was haben Sie angestellt, mein Herr?“
„Ja, was denn?“, fragte Bernd ärgerlich.
„Sie haben diese Dame in die Toilette gestoßen.“
„Gehört sie denn da nicht hin?“, erwiderte Schuster wenig galant.
„Sie!“, kreischte die Dicke und schwang wütend die Fäuste. Schuster bat den Geschäftsführer zur Seite, denn er wollte mit ihm unter vier Augen sprechen.
„Schicken Sie die Frau aus dem Lokal“, empfahl Bernd dem Mann mit dem sichelartigen Schnauzbart.
„Ich muss Sie bitten, sich bei der Dame zu entschuldigen.“
„Für solche Spielchen ist jetzt keine Zeit, Mann. In Ihrem Lokal wurde jemand ermordet!“
Der Geschäftsführer kniff misstrauisch und unmutig die Augen zusammen. „Ich mag keine makabren Scherze, Señor.“
Bernd reichte ihm seine Karte, um die Unterhaltung in eine seriöse Richtung zu lenken. Er erklärte: „Ich war hinter dem Mörder her. Diese Frau hat sich mir in den Weg gestellt. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich den Mörder vielleicht noch gekriegt. Also: Schicken Sie sie nach Hause! Sie haben jetzt genug Sorgen am Hals, Meister.“
„Was gibt es da so lange zu tuscheln?“, schrie die Dicke von hinten.
„Tun Sie uns den Gefallen und scheren Sie sich zum Teufel!“, sagte Bernd unfreundlich. Das war sonst nicht seine Art. Aber manche Menschen brauchen eine solche kalte Dusche, um zur Vernunft zu kommen.
Die Aufgeblasene erstickte daran beinahe. „Sie!“ gurgelte sie wieder. „Was ist das für ein Ton?! Muss ich mir das gefallen lassen? In Ihrem Lokal? Wo ich jeden Mittag ...“
„Tut mir leid, Señora. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit für Sie“, stöhnte der Geschäftsführer. Er schaute Bernd mit zusammengezogenen Brauen an.
„Dieses Lokal sieht mich nie mehr wieder!“, schrie die Dicke.
„Es wird deshalb nicht zu Grunde gehen“, sagte Bernd. Das gab ihr den Rest. So schnell es ihre hundertzwanzig Kilo Lebendgewicht zuließen, fuhr sie herum und stürmte davon.
„Wo ist der Tote?“, fragte der Geschäftsführer gepresst.
„Kommen Sie! Ich zeige ihn Ihnen.“
Sie begaben sich zu Keller. „Ein Glück, dass er nicht vom Stuhl gefallen ist“, sagte der Mexikaner. „So könnte man denken, er lebt noch.“
„Rufen Sie die Polizei an!“, riet ihm Bernd Schuster.
Ganz durcheinander war der Kleine. Bernd hatte Mitleid mit ihm. Der Geschäftsführer, dessen Name Rodriguez lautete, schaute nach den Gästen, die gleich nebenan dinierten. Es wäre ihm wohl am liebsten gewesen, wenn er den Toten per Knopfdruck zum Verschwinden bringen hätte können. Aber so einfach ist das mit Toten nun mal nicht.
„Ja“, sagte Rodriguez schließlich mit bröckeliger Stimme. „Natürlich, Herr Schuster. Ich werde die Polizei anrufen.“ Verzweifelt fuhr er sich durchs Haar. „In meinem Lokal! Madre de dios! Das hat es in den fünfzehn Jahren, die ich hier beschäftigt bin, noch nicht gegeben! Ein Toter in meinem Lokal!“ Kopfschüttelnd ging er.
Bernd durchstöberte inzwischen die Taschen des Toten. Würde es nun ewig ein Rätsel bleiben, was Keller ihm hatte mitteilen wollen? Nichts von Bedeutung fiel Schuster in die Hände. Eines dieser unbedeutenden Dinge war ein Zettel, auf den jemand, der Gicht in den Fingern zu haben schien, hingeschmiert hatte: Frühlings Gästepension Nr. 17.
In diesem Augenblick fiel der Tote vom Stuhl. Erst schrie nur eine Frau entsetzt auf. Dann eine zweite. Dann ein Mann. Und schließlich war die Panik nicht mehr aufzuhalten.
––––––––
3
Winfried Schack war so etwas wie eine Institution. Sein Alter war kaum zu erraten. Er konnte dreißig Jahre alt sein oder auch fünfundvierzig. Er war ein Fettkloß mit dem grünlich weißen Gesicht eines Grottenolms. Seine Augen, halb hinter den Lidern versteckt, waren schwarz und hart wie Ebenholzknöpfe. An Stelle des Haares schien sein Schädel mit einem Stück Teppich bezogen. Er hatte einen schwarzen Tatarenschnurrbart, dessen Enden herunterhingen wie Rattenschwänze.
Er hatte gelernt, sein Geld da zu verdienen, wo es auf der Straße lag. Das war in den heruntergekommenen Vierteln Berlins, zumeist in Mauernähe, gewesen. Zuerst hatte er als Ein-Mann-Unternehmen gearbeitet. Dann hatte er sich Handlanger zugelegt. Und heute war er soweit, dass er nicht mal mehr einen Revolver zu tragen brauchte, wenn er keine Lust dazu hatte. Heute war er ein Mann, zu dem die Ganoven, die es noch nicht geschafft hatten oder die es niemals schaffen würden, wie zu einem Heiligen aufschauten.
Er machte Geschäfte mit allen Größen dieser Stadt. Schwarze Geschäfte, das verstand sich von selbst. Die neue Masche, an der Winfried Schack gerade mithäkelte, hieß LKW-Raub. Die Sache ließ sich gut an. Natürlich konnte man sie nicht bis in alle Ewigkeit forthäkeln, denn die Bullen waren schließlich nicht ausnahmslos Holzköpfe, aber zwei, dreimal konnte dieselbe Tour gewiss noch geritten werden. Blöd nur, dass das letzte Ding ausgerechnet in der DDR abgezogen wurde. Schack tobte stundenlang, als er davon erfuhr und sich ausrechnete, was das für einen Wirbel verursachen würde. Da war die teure Ladung des LKWs nur ein schwacher Trost.
Schack saß an seinem Schreibtisch und führte wichtige Gespräche mit unwichtigen Leuten am Telefon, als jemand an die Tür seines Büros klopfte.
„Herein!“, plärrte er ziemlich unfein. Seine Füße lagen auf dem Tisch. Über die blankgeputzten Schuhspitzen visierte er die Tür an, die sich jetzt öffnete. Zwei normale Gesichter flankierten ein bleiches. Als Schack das leichenblasse Gesicht sah, nahm er die Füße vom Tisch und knurrte in die Membrane: „Also, ich muss jetzt Schluss machen, Freundchen. Ruf mich morgen wieder an! Vielleicht hast du für dein Problem inzwischen eine eigene Lösung gefunden. Wenn nicht, kann ich dir ja ein bisschen Feuer unter dem Arsch machen.“ Er knallte den Hörer in die Gabel und starrte den Eintretenden entgegen.
„Was bringt ihr mir da?“, fragte er die beiden großen Kerle, die den mittelgroßen Mann begleiteten. Der Bursche hatte seine Wäsche bereits durchgeschwitzt. Als nächstes würde er sich in die Hosen pinkeln, so sah er aus.
„Sie wollten doch Dieter ‚Diddy‘ Fleck sprechen, Boss“, antwortete einer der beiden. Winfried Schack nickte grimmig. Seine Augen wurden ganz schmal. Er erhob sich und kam um den Schreibtisch herum. Flecks Nerven vibrierten zum Zerreißen. Kein Wunder. Er hatte etwas geklaut, was Schack gehört hatte. Und sie hatten ihn dabei erwischt. Deshalb hatte ihn Schack sehen wollen. Die Konfrontation war nicht so sehr peinlich wie gefährlich. Wer Schack beklaute, konnte damit rechnen, dass ihm die Pfoten abgehackt wurden. Oder gleich die Rübe, das lag bei Schack. War er bei guter Laune, konnte die Sache mit einem scharfen Verweis und mit einem blauen Auge abgehen. Im anderen Fall ging’s über die Spree.
„Stehlen tut der Knabe!“, zischte Schack feindselig. Er hatte heute einen seiner bösesten Tage. Pech für Fleck, konnte man da nur sagen.
„Boss!“, stöhnte Fleck und leckte sich einen Schweißtropfen von der Oberlippe. Seine Zunge schnellte dabei heraus wie die eines Leguans, der sich eine Fliege sichert. „Boss - ich war in finanziellen Schwierigkeiten!“
„In finanziellen Schwierigkeiten?“, fragte Schack anscheinend teilnahmsvoll. „Wie denn dieses? Du kannst doch nicht behaupten, ich zahle so schlecht, dass einer meiner Leute in finanzielle Schwulitäten gerät, wenn er halbwegs vernünftig lebt.“
„Nein, Boss. Die Bezahlung ist schon okay ...“
„Glücksspiel?“, fragte Schack scharf. „Rauschgift? Was hat dich in die Enge getrieben?“
„Keins von beiden, Boss!“, beeilte sich Diddy.
„Junge, jetzt lüg mich nicht auch noch an!“
„Es ist meine Frau - meine Frau kostet mich so viel Geld, Boss!“
„Wirf sie raus! Sie taugt nichts.“
„Ich meine - die Krankheit meiner Frau, Boss.“
„Was fehlt ihr?“
„Krebs“, sagte Fleck und senkte traurig den Blick. „Die Ärzte haben sie monatelang gequält. Jetzt versuchen sie es mit Kobaltbestrahlungen, aber das kostet alles verflucht viel Geld. Ich war so verzweifelt. Ich hänge an ihr. Ich möchte sie nicht verlieren, verstehen Sie? Sie ist mein Leben, mein alles. Als der Arzt sagte, ich müsse fünftausend Mark auf den Tisch blättern, wenn ich möchte, dass er sie weiterbehandelt, da - da - ich muss den Verstand verloren haben, aber in diesem Moment sah ich nur einen einzigen Ausweg ...“
„Und das war der, mich zu bestehlen“, sagte Winfried Schack ärgerlich.
„Ich hab’s für meine Frau getan!“
„Verdammt noch mal, mir ist egal, für wen du das getan hast!“, brüllte Schack Fleck ins bleiche Gesicht. „Für mich zählt lediglich der Umstand, dass du es getan hast!“
„Ich werde den Betrag in Raten zurückzahlen, Boss!“
„Du hättest zu mir kommen müssen, Fleck. Bin ich denn ein Unmensch, oder was bin ich? Ich hätte dir das Geld gegeben, wenn du mich darum gebeten hättest. Mich zu bestehlen, das ist keine Lösung. Wenn dieses Beispiel Schule macht, muss ich nächstens in meinem Safe schlafen! Ich muss meinen Männern vertrauen können, Diddy. Dir kann ich nicht mehr vertrauen.“
Fleck erschrak. „Boss, geben Sie mir noch eine Chance!“ Er wimmerte und rang die Hände. „Ich schwöre Ihnen bei allem, was mir heilig ist, dass so etwas nicht mehr vorkommen wird!“
Winfried Schack kehrte hinter seinen Schreibtisch zurück. Für ihn war der Fall erledigt. Er stach mit dem Zeigefinger in Flecks Richtung.
„Ihr beide verpasst ihm draußen eine tüchtige Abreibung!“ Und zu Fleck gewandt, sagte Schack: „Und von dir kriege ich innerhalb von vierundzwanzig Stunden mein Geld zurück. Sonst erlebst du die fünfundzwanzigste Stunde nicht mehr!“
Fleck klappte beinahe zusammen. „Mein Gott, Boss, ich habe das Geld nicht mehr! Wie soll ich es in so kurzer Zeit wiederbeschaffen?“
„Ist mir egal. Es ist mein Geld. Ich will es wiederhaben.“
„Das geht nicht!“
„Dann krepierst du eben noch vor deiner krebskranken Frau!“, schrie Winfried Schack, dass ihm die Adern am Hals weit heraustraten. Und im gleichen Atemzug brüllte er seine beiden Leibwächter an: „Na los! Worauf wartet ihr denn noch? Schafft den Kerl endlich fort! Ich will ihn nicht mehr sehen!“
Da wuchtete sich Dieter Fleck vorwärts.
„Du Schwein!“, schrie er in seiner grenzenlosen Verzweiflung. „Du elendes, hartherziges Schwein!“
Er war unbewaffnet, dafür hatten die Leibwächter gesorgt, ehe sie ihn hier hereingebracht hatten. Doch nun bewaffnete sich Fleck mit dem schlanken metallenen Brieföffner, der auf Schacks Schreibtisch lag. Blitzend sauste die Klinge hoch. Die beiden Leibwächter standen wie gelähmt da. So etwas hatte es noch nie gegeben. Fleck stach sofort zu. Winfried Schack brachte seine Massen mit einem entsetzten Satz in Sicherheit. Er schnaufte erschrocken. So nahe war seit Jahren keiner mehr an ihn herangekommen, der ihm nach dem Leben trachtete. Der Brieföffner sauste herab und verfehlte Schack um Haaresbreite. Mit einem tackenden Geräusch fuhr die Spitze in den Tisch. Jetzt erst reagierten die beiden. Sie flogen auf Fleck zu, packten ihn, rissen ihn derb zurück, quetschten ihn zwischen sich ein und ließen ihn nicht mehr los.
„Lasst mich!“, brüllte Dieter Fleck wie von Sinnen. „Lasst mich los!“ Er wand sich zwischen den beiden Männern, die ihn umklammerten, als wäre ihr eigenes Leben bedroht.
„Ich bringe das Schwein um! Lasst mich los! Ich will die Sau killen!“
Schack stampfte um den Schreibtisch herum, in dessen Platte immer noch der Brieföffner einen Zentimeter tief steckte. Aschfahl war nun auch sein Gesicht. Er ballte die Hände und schlug auf Fleck ein. Als er sich abreagiert hatte, krümmte sich Dieter Fleck in schweren Leibkrämpfen und spie ihm auf den Teppich.
„Wer ist hier die Sau?“, fragte Schack grinsend. Er war schon wieder eiskalt. „Derjenige, der sich nicht bestehlen lässt, oder derjenige, der dem anderen auf den Teppich kotzt!“
Die Leibwächter standen stumm neben Diddy und erwarteten neue Anweisungen.
„Wir machen eine kleine Spazierfahrt mit ihm“, entschied Winfried Schack frostig. In seinen schwarzen Augen schimmerte Flecks Todesurteil. Noch niemand hatte Winfried Schack ungestraft nach dem Leben trachten dürfen. Sogar Bullen, die das getan hatten, standen heute in irgendeinem Betonpfeiler herum.
––––––––
4
„Raus!“, sagte Schack zu seinen Männern, als sie ihr Ziel erreicht hatten. Die Leibwächter stiegen aus. Noch immer wussten sie nicht, was der Boss vorhatte. Aber es war ganz gewiss eine Teufelei. Das erkannten sie am zufriedenen Grinsen Schacks.
Auch Fleck kletterte aus dem Landrover. Er war erstaunt, wie gut das ging. Nur die Angst machte ihm noch schwer zu schaffen. Die Schmerzen waren einigermaßen zu ertragen. Er atmete unregelmäßig und blinzelte gegen die kalte Novembersonne. Der Boden, auf dem er stand, war hart und steinig. Davon, dass es gestern geregnet hatte, war heute nichts mehr zu sehen.
„Sicher fragst du dich jetzt, was ich mit dir vorhabe“, sagte Schack halblaut.
Fleck schob trotzig das Kinn vor. Es war lächerlich. Gegen Schack und die beiden Kerle hatte er nichts zu bestellen. Trotzdem hatte er es satt, vor Schack zu kriechen.
„Ich werde dich jetzt fesseln lassen. Dann hänge ich dich an den Landrover und drehe hier eine Runde mit dir“, sagte Schack gelassen.
Eine froststarre Hand legte sich um Flecks Herz. Schack wollte ihn zu Tode schleifen. Ein schlimmeres Ende gibt es nicht für einen Menschen.
„Bindet ihn!“, sagte Schack ungeduldig.
Die beiden setzten sich in Bewegung. Da begann Diddy um sein Leben zu rennen. Der Start erfolgte völlig unerwartet. Er stürmte auf Schack zu, rempelte diesen zur Seite und jagte dann querfeldein davon.
„Ihm nach!“, brüllte Winfried Schack außer sich vor Wut. „Bringt ihn zurück! Aber bringt ihn lebend! Er soll nicht so billig davonkommen!“
Und die Bluthunde flogen hinter dem Opfer her. Sie waren kräftiger als Fleck. Ihnen hatte niemand den Magen kaputt getrommelt und die Kondition aus dem Leib gehämmert. Ihre langen Beine griffen weit aus. Sie holten auf. Fleck konnte noch so schnell rennen, sie liefen schneller als er. Fünfhundert Meter ließen sie ihn hoffen, doch dann waren sie bei ihm. Er hörte sie schnaufen, wirbelte herum, starrte sie mit fieberglänzenden Augen an. Sie rissen ihn zu Boden, traten ihn mit Füßen, warfen ihn herum, er kreischte und tobte, aber er war ihnen nicht gewachsen. Sie zwangen seine Arme auf seinen Rücken, dann banden sie ihn mit einem widerstandsfähigen Lederriemen.
Er hatte Schaum vor dem Mund und Tränen in den Augen, als sie ihn auf die Beine stellten. Sein Atem rasselte. Die Kehle war ausgedörrt, doch was zählte das jetzt noch, wenige Minuten vor einem qualvollen Ende.
Winfried Schack wartete mit dem Abschleppseil auf sie. Am Landrover hatte er es bereits festgebunden. Nun schlang er es Fleck um den Brustkorb.
„Gottverfluchte teuflische Kreatur!“, schrie ihm Fleck verzweifelt ins Gesicht, und dann spuckte er ihn voll Verachtung an. Was auf ihn zukam, konnte nicht mehr schlimmer werden.
Schack wischte sich mit einer hastigen Bewegung den Speichel aus dem Gesicht. Seine Augen funkelten böse.
„Na warte, Freund. Na warte!“, zischte er. Dann ging er zum Landrover vor und setzte sich ans Steuer. Zu den Leibwächtern sagte er: „Ihr wartet hier auf mich.“
„Okay, Boss!“, nickten die beiden.
Schack gab Gas. Der Landrover setzte sich in Bewegung. Das Abschleppseil spannte sich. Dieter Fleck torkelte hinter dem Wagen her. Doch nicht lange. Ein Stein ließ ihn stolpern. Gleich darauf fiel er. Verzweifelt versuchte er wieder auf die Beine zu kommen, und beinahe hätte er es geschafft, doch da gab Schack mehr Gas. Der Landrover schoss vorwärts ...
Winfried Schack drehte mit Vollgas eine riesige Runde. Als er zu seinen Männern zurückkehrte, lebte Fleck nicht mehr. Und was da am Abschleppseil hing, war nicht mehr als Dieter Fleck wiederzuerkennen.
Schack steckte sich gelassen eine Zigarette an. Seine Hände zitterten kein bisschen.
„Schneidet ihn ab!“, befahl er. Die Männer kamen der Aufforderung umgehend nach. Sie ließen Fleck einfach liegen. Er war so unwichtig für sie geworden wie irgendein Fremder, mit dem sie nichts zu schaffen hatten. Dann fuhren sie mit teilnahmslosen Mienen zurück. Winfried Schack setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Es war nichts geschehen.
Zwei Minuten später läutete das Telefon. Schack meldete sich kurz.
„Ja?“
Der Anrufer nannte seinen Namen. Schacks Züge hellten sich auf. Das war der Mann, mit dem er seit neuem gute Geschäfte machte.
„Hallo, Partner!“, rief er leutselig. „Alles in Ordnung?“
„Was sollte nicht in Ordnung sein?“, gab der Anrufer bissig zurück.
Schack grinste. „Man wird ja noch fragen dürfen.“
„Wie geht’s bei euch?“
„Bestens, Partner. Könnte gar nicht besser gehen. Vorhin hatte ich Trouble mit einem meiner Freunde. Aber das habe ich inzwischen erledigt.“
„Was war los?“, wollte der andere wissen.
„Dieter Fleck hat mich beklaut. Ich stellte ihn zur Rede, wollte ihn von meinen Männern verdreschen lassen und verlangte klarerweise mein Geld zurück. Da spielte der Knabe verrückt, wollte mich mit meinem eigenen Brieföffner erstechen. Hat es aber nicht geschafft. Und jetzt ist er selber hin.“
„Was haben Sie mit ihm gemacht, Schack?“
Winfried Schack sagte es dem Anrufer. Er schmückte jedes Detail aus und ergötzte sich an der Erzählung. Seine Augen funkelten begeistert. Er war stolz auf den Einfall, den er da gehabt hatte.
„Das tut doch kein normaler Mensch!“, rief der Anrufer angewidert aus.
Schack wurde distanziert.
„Sage ich Ihnen, wie Sie sich zu verhalten haben? Ich würde Ihnen in Ihre Angelegenheiten niemals dreinreden, weil ich kein Recht dazu habe. Und dasselbe verlange ich von Ihnen, Partner. Ich weiß, wie ich meine Kumpels zu behandeln habe, damit sie spuren. In den nächsten zehn Jahren vergreift sich ganz bestimmt keiner mehr an meinem Safe. Was Fleck passiert ist, macht im Kreise meiner Leute die Runde. Jeder wird sich daraufhin hüten, nach meinem Eigentum zu trachten. Damit habe ich erreicht, was ich erreichen wollte. Im Übrigen - vergessen Sie nicht, was das für Menschen sind. Verbrecher sind es. Wertlos bis zu einem gewissen Grad. Niemand trauert einem Dieter Fleck nach, ausgenommen seine Frau, die ihn um nicht viel überleben wird. Fleck hinterlässt kein großes Loch. Er kann spielend durch einen anderen Mann ersetzt werden.“
„Die Polizei wird ihn finden.“
„Wenn schon.“
„Sie hätten ihn wenigstens eingraben sollen.“
„Die Mühe war Fleck nicht wert. Wenn die Bullen zu mir kommen, weil Fleck irgendwann mal für mich gearbeitet hat, sage ich denen, dass ich ihn seit drei Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Dann sollen die mir mal das Gegenteil beweisen.“
„Sie sind unvorsichtig, Schack. Wenn die Bullen sich erst mal um Sie kümmern ...“
Schack lachte. „Angst wegen unserer Geschäfte, Partner? Brauchen Sie nicht zu haben. Winfried Schack steht Ihnen weiterhin zu Diensten. Die Sache mit Dieter Fleck braucht Sie nicht zu kümmern. Das ist allein mein Bier. Und ich werde damit unter Garantie allein fertig. Apropos Geschäfte. Ist schon wieder was Neues in Sicht?“
„Deshalb rufe ich an.“
„Was liegt denn diesmal an?“, erkundigte sich Schack und ergriff den Brieföffner, der immer noch im Schreibtisch steckte. Er riss ihn aus der Platte und musterte die Spitze nachdenklich, während er den Worten des Anrufers lauschte.
„Medizinische Geräte werden es diesmal sein.“
„Wertvoll?“, fragte Schack.
„Es sind hochentwickelte Präzisionsapparate.“
„Die kriegen wir doch nie los“, sagte Schack und rümpfte die Nase.
„Ich habe schon jemanden, der sich dafür interessiert.“
„Das ist natürlich etwas Anderes. Wie viel sind die Dinger denn wert?“
„110.000 Mark.“
„Das hört sich gut an. Wann soll die Sache steigen?“
„Das erfahren Sie noch rechtzeitig von mir.“
„Okay. Dann halte ich meine Männer inzwischen schon in Alarmbereitschaft, Partner. Ich hoffe, Sie melden sich bald wieder, damit wir die Einzelheiten der Aktion absprechen können.“
„Ich rufe an, sobald die Sache aktuell ist“, versprach der andere. Dann legten sie gleichzeitig auf. Schack betrachtete weiter den Brieföffner. Keine Waffe, dachte er, und doch kann er einem Menschen den Tod bringen. Achselzuckend legte er das Ding beiseite. Er entschloss sich, ein wenig im Papierkram zu wühlen, der im Eingangskorb lag. Seine Hand war noch unterwegs dorthin, da hämmerte jemand an die Tür. Ärgerlich schnaufte Schack: „Was ist denn?“
Die Leibwächter traten ein. Wieder hatten sie einen Mann zwischen sich. Und auch das Gesicht dieses Mannes war blass. Aber aus einem anderen Grund, als das bei Dieter Fleck der Fall gewesen war. Winfried Schack schaute den Fremden prüfend an. Von Kopf bis Fuß. Von Fuß bis Kopf. Er ließ sich mit der Musterung Zeit. Schließlich fragte er: „Wer ist das?“
„Der Bursche hat sich draußen herumgetrieben, Boss.“
Schacks Gesicht nahm einen misstrauischen Ausdruck an.
„So, so. Herumgetrieben. Und weshalb?“
„Das will er nur Ihnen verraten. Der denkt, er kann bei uns den Kaiser spielen.“
„Ist er sauber?“, fragte Schack.
„Nicht mal 'ne Nagelfeile trägt er bei sich, Boss.“
„Okay, Mann“, sagte Schack. „Nenn mir deinen Namen.“
„Simon Feuker heiße ich.“
„Woher kommst du?“
„Beinahe direkt aus Santa Fu“, sagte Feuker grinsend.
„Weshalb hineingekommen?“
„Schwerer Einbruch“, antwortete Feuker fast stolz. Er sah aus, als habe er soeben im Alleingang den letzten Krieg gewonnen und kehrte nun als Sieger heim. Er war groß und ohne ein Gramm Fett. Sein dichtes blondes Haar glänzte so seidig wie die frisch gereinigte Mähne eines Löwen. Die eisig blauen Augen in dem gefängnisbleichen Gesicht standen weit auseinander, ihr Funkeln enthüllte eine Art angeborener Grausamkeit. Unter dem starren Grinsen zeigte sich ein Raubtiergebiss. Der Anzug, den er trug, war altmodisch und wenig elegant.
„Was willst du von mir in Berlin? Habt ihr in Hamburg nichts mehr zu tun?“, fragte Winfried Schack lauernd.
„Einen Job“, erwiderte Feuker. Er fingerte in sein Jackett und brachte ein Foto zum Vorschein. Er hielt es so, dass Schack es sehen konnte. Das Bild zeigte einen Mann, dessen Gesicht schmal war, die Haarfarbe war dunkel, die Augen wirkten hell und durchdringend.
„Wer ist der Mann?“, fragte Schack neugierig.
„Ein Schnüffler. Bernd Schuster. Der Bursche hat mich nach Fuhlsbüttel in den Knast gebracht. Er lebt aber hier in Berlin. Dafür werde ich mich bei Gelegenheit revanchieren. Aber vorher muss ich ans Geldverdienen denken. In meinen Taschen herrscht Ebbe.“
Schack überlegte, was er mit Feuker anfangen sollte. Von seinem Äußeren her gefiel ihm der Bursche. Der Mann schien tüchtig zu sein.
„Okay, Simon. Ich will’s mit dir versuchen“, nickte Winfried Schack. Er dachte an Fleck und fuhr fort: „Du hast Glück. Erst heute wurde bei mir ein Job frei.“
Feuker grinste erfreut. „Tja. Wer kein Glück hat, bleibt ein Kriechtier, sein Leben lang. Was für Arbeit habe ich zu tun?“
„Die beiden werden dich einweihen. Solltest du nicht entsprechen, werfe ich dich nach ein paar Tagen wieder raus, das ist dir hoffentlich heute schon klar. Ich kann nur hundertprozentige Kerle brauchen. Alles andere wird abgebaut.“
Simon Feuker zog die Brauen hoch.
„Ich bin sogar einer von den Zweihundertprozentigen, Chef. Sie werden Ihre helle Freude an mir haben.“
„Na, hoffentlich nimmst du den Mund nicht zu voll.“
Feuker hatte Schusters Fotografie wieder eingesteckt. Seit seiner Verhaftung trug er sie bei sich. In der Zelle hatte er sie sich immer wieder angesehen. Er hatte seinen Hass gegen den Mann, der ihm den Knastaufenthalt eingebrockt hatte, an diesem Foto aufgerichtet. Schusters Bild hatte seinen Rücken gestärkt. Was sie ihm im Gefängnis auch angetan hatten, es war wirkungslos an ihm abgeprallt, denn er hatte Schuster vor Augen gehabt, Tag und Nacht. Und er hatte gedacht: Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Du musst stark bleiben. Stark für die Rache! Und mit diesem Vorsatz war er aus dem Gefängnis gekommen. Kein gebrochener Mann, sondern einer, der in sich eine gespannte Feder spürte, die ihn seinem Ziel entgegentrieb, einem Ziel, das Bernd Schuster hieß.
„Pass auf, Feuker!“, sagte Schack und wies ungefähr dorthin, wo Bernds Bild steckte. „Solange du für mich arbeitest, ruht dein privater Rachefeldzug gegen diesen Spürhund, klar? Du setzt deine Arbeitskraft voll für mich ein. Mit Schuster kannst du abrechnen, wenn du bei mir ausgestiegen bist. Ich erwarte, dass du dich an das hältst, was ich von dir verlange.“
Feuker schmunzelte hintergründig.
„Aber sicher, Chef. Schließlich bin ich froh, diesen Job gefunden zu haben.“
Nie im Traum dachte Simon Feuker daran, die Finger von Schuster zu lassen. Sobald sich eine günstige Gelegenheit bot, wollte er den verhassten Schnüffler abservieren. Er musste ihn töten. Es war wie ein Fieber, das in ihm brannte, das ihn nachts nicht schlafen ließ, das ihn quälte. Er wusste, dass er sich von dieser Krankheit nur mit einem Mittel kurieren konnte - und das war Schusters Tod. Dafür war er nach Berlin gekommen.
„Wo wohnst du im Augenblick?“, fragte Schack.
„Noch nichts gefunden“, sagte Feuker.
„Von nun an wirst du hier wohnen.“
„Hier?“
Schack wies mit dem Daumen über die Schulter. Da war die Wand, aber er tat so, als gäbe es sie nicht.
„Da hinten stehen ein paar Zimmer. Eines davon kannst du haben. Es ist besser, wenn wir auf Reichweite beisammen wohnen. Erstens - sind wir so jederzeit einsatzbereit, und zweitens - habe ich meine Schäfchen gern unter Kontrolle. Weitgehend, versteht sich. Das soll jetzt nicht heißen, dass du von einem Gefängnis in das andere kommst.“ Schack erhob sich. Er ging um den Schreibtisch herum und drückte dem neuen Mann die Hand. Damit war der Kontrakt besiegelt. Nun zeigte der Boss dem Neuen das Zimmer am Ende eines langen Flures.
Es war das Zimmer von Dieter Fleck, in dem der gewohnt hatte, wenn seine kranke Frau mal wieder für eine Weile ins Krankenhaus musste. Schack wies auf die Sachen von Fleck und meinte: „Der Krempel fliegt selbstverständlich raus. Du kannst dich ganz nach deinem Geschmack hier einrichten, Simon.“
Feuker schaute sich um. Es gab nur einen einzigen Raum. In dem war alles untergebracht: die Kochnische, die Duschnische, der Einbauschrank, die Schlafcouch. Das Ganze war ein Zimmer mit separatem Eingang.
„Gefällt‘s dir?“ fragte Schack.
„Kommt’s darauf an?“, fragte Feuker zurück. „Ich habe nicht vor, hier drinnen alt und runzelig zu werden.“
„Wenn du neue Tapeten haben möchtest ...“
Feuker grinste. „Warten wir lieber erst mal meine Probezeit ab. Dann kann ich mich immer noch nach neuen Tapeten umsehen.“
––––––––
5
Bernd hob den Kopf. Er befand sich in einer jener trübseligen Straßen, in denen heller Sonnenschein jede schmutzige Einzelheit mit erbarmungsloser Deutlichkeit enthüllt, angefangen von den Häuserfassaden mit dem abbröckelnden Verputz bis zu dem Ausdruck der Verlassenheit der Bewohner, die ziellos die Gehsteige entlang schlurften. Schuster stieg eine Holztreppe in den vierten Stock bis zum Dachboden hoch. Ein Freund von ihm wohnte da.
Der Dachboden hatte ein mit Schmutz verkrustetes Oberlicht, aber selbst das konnte das Eindringen der Sonne nicht verhindern. Vor Bernd lag ein langer, schmaler, unregelmäßig geformter Raum, der einen Mathematiker an den Rand des Wahnsinns gebracht hätte. Von hier gingen zwei Türen ab. An der einen stand: Wolfgang Greiner.
Bernd hatte Greiner vor fünf Jahren wegen einiger gefälschter Dokumente ins Kittchen gebracht. Greiner hatte sofort begriffen, dass das der richtige Moment war, sein Leben von Grund auf zu ändern, und er hatte diesen Gedanken in die Tat umgesetzt, sobald er wieder aus dem Gefängnis herausdurfte. Heute arbeitete Wolfgang Greiner zu Hause als Grafiker. Er illustrierte Kinderbücher, zeichnete Plakate für diverse Veranstaltungen, verdiente zwar keine Reichtümer, aber er lief nicht mehr Gefahr, wegen seiner Arbeit eingesperrt zu werden.
Bernd klopfte.
Der Mord an Manfred Keller hatte ihn lange Zeit beim Mexikaner festgenagelt. Die Polizei war mit voller Pracht angerückt gekommen. Dann hatte es endlose Verhöre gegeben, Protokolle waren angefertigt worden, und zu allem Überfluss war die dicke Nudel noch einmal in das Restaurant zurückgekehrt, die Bernd so sehr ins Herz geschlossen hatte. Als sie erfuhr, was passiert war, fiel sie vor Schreck beinahe in Ohnmacht. Dass ausgerechnet Bernd es war, der sie schließlich beruhigen konnte, war ein Hohn des Schicksals.
Schlurfende Schritte kamen an die Tür.
„Wer ist da?“, fragte drinnen Greiner.
„Ein Freund“, sagte Bernd grinsend.
„Ich habe keine Freunde.“
„Doch. Einen.“
„Welchen?“
„Bernd Schuster.“
Drinnen polterte es, als hätte die Freude den Mann umgeworfen. Dann rasselte eine Vorhängekette, ein Schlüssel wurde umgedreht, und schließlich tat sich die Tür auf. Ein dürrer Kerl begann, mit weit aufgerissenem Mund zu lachen. Er hatte Arme wie eine Spinne. Auf seiner Oberlippe wucherte ein Seehundsbart, gelblich vom Nikotin. Auf der langen spitzen Nase klemmte ein Nickelzwicker, über den er nun mit seinen listigen Falkenaugen hinwegsah.
„Bernd Schuster!“, rief der knöcherne Bursche erfreut aus. Er packte Bernd an der Schulter und zog ihn in seine Wohnung.
Mann, war das eine Bruchbude. Die Decke war mit Pfosten gestützt. Der Fußboden war eingesunken. An anderen Stellen gab es dafür dünenartige Gebilde. Ringsherum hatte die Mauer Risse, durch die der Wind pfiff. Und da, wo es, wenn’s regnete, durchs Dach tropfte, standen rostige Eimer. Vor dem schrägen Atelierfenster stand ein riesiger Schreibtisch. Das war Greiners Arbeitsplatz, und er sah weit weniger trostlos aus als alles andere. Skizzen lagen darauf. Tuschzeichnungen waren an eine Glasplatte geklebt.
Bernd holte die Weinbrandflasche hervor, die er hinter seinem Rücken versteckt hatte.
„Einer Frau bringt man Blumen mit. Einem Mann Weinbrand“, sagte Schuster.
„Richtig. Was sollte ein Mann mit Blumen anfangen“, sagte Hai Greiner. „Soll er sie fressen?“ Jetzt lachte er, und sein flacher Bauch wackelte vor und zurück. „Ich hätte nicht mal eine Vase für das Grünzeug.“
„Aber Gläser hast du.“
„Zwei Stück. Das eine gehört zum Zähneputzen. Das nehme ich. Das andere ist für liebe Gäste.“
„Kommen hin und wieder welche?“, fragte Bernd.
„Wer wagt sich hier schon rein?“, fragte Greiner zurück. „Aber ich gebe die Hoffnung nicht so schnell auf.“ Der Grafiker wies auf einen Stuhl. „Setzen Sie sich, Schuster!“
Bernd nahm Platz. Greiner drehte den Verschluss von der Flasche und goss die Gläser voll. Das Zahnglas behielt er für sich. Das andere reichte er Bernd. Sie stießen auf das erfreuliche Wiedersehen an. Hinterher setzte sich Greiner auf das unordentliche Bett, das gleich neben dem Schreibtisch stand.
„Schlafen und arbeiten, das ist mein Leben“, sagte er.
„Warum ziehst du nicht aus, Wolfgang? So wohnt doch heutzutage keiner mehr.“
„Ich schon. Und wissen Sie weshalb? Dieses Gebäude soll in einem halben Jahr abgerissen werden. Kommt ein Superhotel mit allen Schikanen her. Und ich krieg eine neue Atelierwohnung. Aber dazu ist es nötig, dass mich der Hauseigentümer delogiert. Wenn ich allein gehe, ist er zu nichts mehr verpflichtet.“ Greiner warf einen misstrauischen Blick zur Decke.
„Hoffentlich bleibt die noch so lange oben. Wäre schade, wenn sie mich jetzt noch erschlägt.“ Greiner lachte gern und laut. Er tat es wieder. Dann ließ er sich Schusters Weinbrand schmecken. Hinterher fragte er: „Was machen die Verbrecher?“
„Kein Mangel.“
„Und die Aufträge?“
„Ich kann mich nicht beklagen.“
„Wohnung und Büro in der Kurfürstenstraße?“
„Hat sich günstig ergeben.“
„Weshalb?“
„Der Anmarschweg von meiner ersten Wohnung in die Innenstadt war häufig sehr mühevoll. Und ich bin kein großer Freund von U- oder S-Bahn.“
Greiner zupfte sich ein Barthaar aus.
„Es führt Sie doch nicht etwa ein Fall hierher, Schuster? Mann, wenn Ihnen einer gesagt haben sollte, der alte Greiner hätte den Pfad der Tugend verlassen, dann hat Sie der Kumpel ganz schön angeschmiert. Ich bin so sauber wie ein frisch gewaschener Kinderpopo.“
„Mit dir ist alles in Butter, das weiß ich. Ich komme wegen deiner außergewöhnlichen Fähigkeiten zu dir. Du könntest mir entscheidend helfen, einen Fall zu lösen.“
Greiner horchte geschmeichelt auf.
„Jetzt nehmen Sie mich aber gehörig auf den Arm, Schuster“, sagte er dann, und er lachte wieder. „Lieber Himmel, und ich wäre fast darauf hereingefallen. Da sieht man, wie man langsam verkalkt.“
„Ich brauche wirklich etwas von dir, Wolfgang“, sagte Bernd ernst.
„Was denn?“
„Papiere.“
„Falsche?“, fragte Greiner erstaunt.
„Würde ich zu dir kommen, wenn ich echte brauchte?“, gab Bernd grinsend zurück.
„Teufel, treiben Sie nicht Scherz mit einem alten Mann, Schuster!“
„Es ist mein vollster Ernst. Ich brauche falsche Dokumente. Wofür, das möchte ich dir lieber nicht verraten. Auf jeden Fall dienen sie einem guten Zweck. Ich dachte kurz nach, an wen ich mich in meiner Not wenden könnte, und da bist mir auf Anhieb du eingefallen. Du hast mir doch schon einmal aus der Verlegenheit geholfen.“
Greiner kniff die Augen zusammen und rückte sich den Kneifer zurecht.
„Wenn ich’s mache, möchte ich auch wissen, wofür ich’s tue.“
„Erpresser“, sagte Bernd. Dann nickte er. „Okay. Ich bin hinter einer Verbrecherbande her. Die Kerle überfallen LKWs, schalten die Besatzung aus, fahren mit den Lastern irgendwohin, laden sie ab und lassen sie stehen. Bisher haben sie das dreimal getan.
Beim letzten Fall hat es einen Toten gegeben. Und das auf dem Gebiet der DDR. Na, da war vielleicht etwas los!“
„Stand in der Zeitung, richtig?“
„Mehrere Tage war das die Schlagzeile. Alle drei LKWs waren für dieselbe Firma unterwegs. Nun möchte ich mich um den Job als Fahrer bei dieser Firma bewerben. Mit falschen Papieren, unter falschem Namen. So habe ich die Möglichkeit, mich da völlig inkognito umzusehen. Vielleicht gelingt es mir auf diesem Weg, den Gangstern auf die Schliche zu kommen.“
Greiner holte tief Luft. „Hört sich nicht ungefährlich an, Schuster.“
„Ich verlange ja nicht, dass du es für mich machst“, schmunzelte Bernd Schuster. „Von dir brauche ich lediglich schöne Papiere.“
„Auf welchen Namen?“
„Wie gefällt dir Hannes Gerber?“
„Überhaupt nicht.“
Bernd nickte. „Dann ist es ein guter Name.“
Greiner begann sofort mit der Arbeit. Er zauberte einen kleinen Setzkasten hervor und baute aus Lettern mit flinken Fingern einen Briefkopf zusammen. Damit bedruckte er nach Bernds Angaben einen Briefbogen. Auf einer alten Schreibmaschine, an der das „n“ und das „s“ klemmten, tippte sich Schuster dann ein Zeugnis herunter. Inzwischen baute Greiner einen wunderschönen Firmenstempel. So ging es weiter. Hannes Gerber erhielt einen herrlichen Führerschein und sogar einen lichtechten Personalausweis. Greiner war bei der ganzen Angelegenheit nicht richtig wohl, aber Bernd versicherte ihm, dass er die Papiere sofort nach seinem Auftritt als Fernfahrer den Flammen überantworten würde. Und: Sollte es Schwierigkeiten mit der Polizei geben, so würde Bernd die Papiere voll und ganz auf seine Kappe nehmen. Das Versprechen ließ Greiner erleichtert aufseufzen. Bernd brachte seine Lichtbilder an. Greiner zeichnete den Behördenstempel.
„Wenn ich nicht wüsste, für wen ich’s mache, und dass es für eine gute Sache geschieht, würde ich die Finger davon lassen“, murmelte Greiner, während er am Schreibtisch den Führerschein fertigstellte.
„So, Herr Gerber“, sagte er anschließend. „Hiermit ermächtige ich Sie, einen LKW kreuz und quer durch die Bundesrepublik zu kutschieren.“ Er holte tief Luft. Bernd nahm ihm den Führerschein aus der Hand.
„Er sieht besser aus als mein echter“, sagte Schuster grinsend.
„Ich brauche jetzt einen kräftigen Schluck“, murmelte Greiner.
Bernd legte hundert Mark auf den Schreibtisch. Greiner wollte sie nicht nehmen. Erst als Bernd sagte: „Kauf dir ein Bild für die neue Wohnung dafür“, steckte er das Geld ein.
Von Greiner, der ihm Hals und Beinbruch gewünscht hatte, fuhr Bernd Schuster geradewegs zur Firma Fröhlich. Natürlich nicht bis vor den Firmeneingang. Niemand nimmt einem Mann, der aus einem Mercedes 450 SEL aussteigt, den LKW-Fahrer ab.
Bernd fand in einer schmalen Straße einen Platz. Dort machte er dann auch gleich ein wenig Maskerade. Er zog den Trenchcoat aus und legte den Hut ab, ging zum Kofferraum und entnahm eine Schirmmütze und eine Weste aus braunem, an den Ärmeln schon ein wenig abgewetztem Nappaleder. Solcherart zünftig gekleidet, mit einer Roth Händle im Mundwinkel, legte er den Rest des Weges zurück.
Die Firma Fröhlich bestand aus einem Bürotrakt, aus einem großen Innenhof, in den man durch ein riesiges Tor gelangte, und einer mächtigen Garage für etwa fünf LKWs.
Das Frachtbüro sah aus wie ein riesiges Aquarium, in dem sich einige Fische tummelten. Eine Blonde schaute Bernd kurz an. Er hatte gerade Zeit, sie mit einem Blinzeln zu betören, dann wandte sie sich abrupt um und zeigte ihm die kalte Schulter.
Und dann stand Bernd vor der Tür, hinter der Carsten Fröhlichs Büro lag.
‚Hoffentlich nimmt er mich‘, dachte Schuster und klopfte.
„Ja, bitte?“, rief eine Frauenstimme von drinnen. Schuster trat ein. Die Frau war fünfzig, rasselte mit Halsketten und Armbändern, trug auch ihre Brille an einer Kette, war beringt wie ein Zirkuspferd und machte einen halbwegs seriösen Eindruck. Bernd trug ihr sein Anliegen mit einer Miene vor, die ihr verriet, dass er den Job, um den er sich zu bewerben gedachte, dringend nötig hatte.
„Ich bin auch mit wenig Lohn zufrieden - das sollten Sie Herrn Fröhlich gegenüber nicht zu erwähnen vergessen.“
„Haben Sie Papiere?“
„Aber natürlich. Was ist der Mensch ohne Papiere? Eine Null ist er. Ein Nichts. Zum Krepieren verurteilt. Niemand stellt ihn ein ohne Papiere. Also kann er kein Geld verdienen. Ohne Geld kriegt er nichts zu futtern. Deshalb ist es für jeden Menschen wichtig, dass er vor allem gute Papiere hat.“
Bernd legte die prächtigen Dinger vor die Vorzimmerdame hin.
„Und das hier ist mein Zeugnis, ausgestellt von meinem letzten Chef. Das war in Gelsenkirchen. Der Ärmste hatte es mit dem Herz. Er musste leider den Laden dichtmachen und seine Leute entlassen.“
Die Vorzimmerdame hieß Bernd, Platz zu nehmen. Er setzte sich und blätterte in einer Illustrierten, während Dorothea Klein - der Name stand auf einem kleinen Holzklotz, der auf ihrem Schreibtisch stand - nach nebenan verschwand. Nun kam es darauf an, welchen Eindruck Bernd auf die Dame gemacht hatte. Sie konnte Bernd so oder so anmelden. Das hing nun ganz von ihr ab.
Schuster hatte die Illustrierte noch nicht einmal ganz durchgeblättert, da kam die Vorzimmerdame bereits wieder.
„Herr Fröhlich möchte Sie sehen, Herr Gerber.“
„Oh, das haben Sie wirklich für mich erwirkt? Ich kaufe Blumen von meinem ersten Lohn und schenke sie Ihnen!“, versprach Bernd und trat in einen hellen Raum, dessen Fenster bis auf den Boden reichten. Fröhlich saß an seinem Schreibtisch. Stumm. Fett. Unbeweglich. Sein Gesicht war eine breite Masse mit Zügen, die die Welt verachteten. Zwischen seinen Fingern steckte eine dicke Zigarre. Sie qualmte so vor sich hin.
Carsten Fröhlich war nicht allein. Ein bulliger Bursche war bei ihm. Untersetzt, mit fleischigen Schultern, einem breiten Nacken und mit der gleichen Weltverachtermiene. Vater und Sohn. Carsten und Fröhlich. Da hatte Bernd sie gleich auf einem Haufen beisammen.
Tobias Fröhlich stand neben dem Schreibtisch seines Vaters. Er musterte Bernd mit unverschämten Blicken.
„Meine Herren“, sagte Bernd und drehte die Schirmmütze in den Händen.
„Treten Sie näher, Gerber!“, verlangte Carsten Fröhlich.
„Gern, wenn ich darf.“
„Sie sind LKW-Fahrer.“
„Mit Leib und Seele, Herr Fröhlich.“
„Und Sie suchen einen Job?“
„Der Mensch muss schließlich von etwas leben, Herr Fröhlich.“
„Haben Sie Familie?“
„Nein, Herr Fröhlich. Ich wäre für Sie jederzeit verfügbar. Keine Familie, keine privaten Sorgen.“
„Wie sieht’s mit dem Trinken aus?“
„Ab und zu ein Bier - oder zwei.“
Tobias Fröhlich kam einen Schritt näher. Der Junge war gefährlich, das fühlte Bernd sofort. In diesen Augen schimmerte unverhohlene Feindseligkeit. Auch Misstrauen prägte den Blick des jungen Fröhlich.
„Wieso kommen Sie ausgerechnet zu uns, Gerber?“
„Wieso nicht?“, fragte Bernd unbekümmert.
„Das ist keine Antwort auf meine Frage!“, knurrte Tobias Fröhlich.
„Ich finde schon. Ich suche einen Job. Ich bin Fernfahrer. Sie haben ein Transportunternehmen. Wieso sollte ich nicht fragen, ob Sie einen LKW-Fahrer brauchen?“
Der junge Fröhlich kniff die Augen zusammen. „Wissen Sie nicht, was bei uns läuft?“
„Nein. Was denn?“
„Es ist ein verdammt hohes Risiko, für die Firma Fröhlich zu fahren.“
„Verstehe ich nicht.“
„Vielleicht werden Sie eines Tages erschossen ...“
Bernd hielt die Luft an und starrte auf den alten Fröhlich.
„Ist das wahr, Herr Fröhlich? Also, wenn das so ist, dann ziehe ich meine Bewerbung lieber zurück. Ich weiß zwar nicht, worum es hier geht, aber das interessiert mich auch gar nicht weiter. Ich bin ein einfacher Mensch mit geringen Ansprüchen. Für meinen Ex-Chef hätte ich mich glatt in Stücke reißen lassen, aber wenn die Gefahr besteht, dass ich erschossen ...“
„Unsinn, Gerber!“, sagte Carsten Fröhlich und schüttelte grimmig den Kopf. „Niemand wird Ihnen etwas tun.“
„Aber dieser junge Mann hat doch eben gesagt ...“
„Dieser junge Mann ist Tobias Fröhlich, mein Sohn. Und außerdem ist er ein Idiot, der anderen Leuten gern Angst macht.“
Den Blick, den die beiden daraufhin wechselten, musste man gesehen haben. Sie versuchten, einander mit den Augen zu erdolchen.
„Ich verbiete dir, mich in Gegenwart Fremder einen Idioten zu nennen, Vater!“, brüllte Tobias Fröhlich angriffslustig.
„In meiner Firma hast du mir gar nichts zu verbieten!“, schrie Carsten Fröhlich zurück. Und er drosch seine Faust kraftvoll auf den Tisch. „Du lebst von meinem Geld, also hast du dir von mir einiges gefallen zu lassen. Wenn dir das nicht passt, kannst du jederzeit gehen. Niemand hält dich zurück.“
Tobias platzte fast vor Wut. Er kochte und schäumte beinahe über.
„Oh nein, den Gefallen tu ich dir nicht, Vater! Ich bleibe. Und ich werde dir weiter auf der Tasche liegen, weil ich weiß, dass einen Geizhals wie dich nichts ärger als das trifft.“
„Hinaus!“, plärrte Fröhlich mit voller Lautstärke. Er wies mit ausgestrecktem Arm auf die Tür.
„Ich gehe, wenn es mir passt!“
„Verdammt, Tobias, treib es nicht zu bunt! Du gehst jetzt. Sonst lasse ich dich vom Firmengelände weisen.“ Wutschnaubend fegte Tobias an Bernd vorbei. Er knallte brutal die Tür zu. Fröhlich schwang die Faust.
„Dir werde ich zeigen, wer hier der Herr ist! Du bist mir noch zu grün, um mir meinen Platz streitig zu machen!“
Fröhlich schien auf Bernd ganz vergessen zu haben. Jetzt besann er sich seiner wieder. Dass Bernd Zeuge dieser Auseinandersetzung geworden war, störte den Transportunternehmer nicht. Solche Gefechte schienen im Hause Fröhlich anscheinend an der Tagesordnung zu sein.
„Okay, Gerber. Sie können bei mir als Fahrer anfangen.“
Bernd wies auf die Tür. „Warum wollte Ihr Sohn den Job unbedingt schlechtmachen, Herr Fröhlich?“
„Ach“, machte Fröhlich angewidert. „Hören sie nicht auf ihn! Ich sag’s ja nicht gern, weil er mein Sohn ist, aber der hat nicht alle Tassen im Schrank. Hören Sie, Gerber. Es wird Ihnen manches hier irgendwie komisch vorkommen. Zumeist ist Tobias daran schuld. Er wiegelt die Leute gegen mich auf. Er versucht immer wieder, mich zu übergehen, Anordnungen zu treffen, die ich dann widerrufe. Wenn Sie also Wert darauflegen, möglichst lange für mich zu fahren, dann tun Sie nicht das, was Ihnen Tobias sagt, sondern ausschließlich das, was ich Ihnen auftrage. Wenn Sie Sorgen haben, kommen Sie damit zu mir, klar? Auch wenn Tobias Ihnen irgendwann mal auf die Zehen tritt - das kommt ganz sicher, er schreckt vor keinem zurück, dann lassen Sie’s mich wissen. Ich weiß, wie ich ihn behandeln muss, und ich stutze ihn dann in Ihrer Gegenwart zurecht, das trifft ihn immer am schlimmsten. Was das Gerede vom Erschießen angeht ...“, meinte Fröhlich und rieb sich nachdenklich das Kinn. „Besser, Sie erfahren es gleich von mir als von irgendjemand anders. In letzter Zeit wurden drei LKWs meines Unternehmens überfallen und ausgeraubt. Einer unserer Fahrer, Fred Stettner hieß er, hat bei einem solchen Überfall das Leben eingebüßt. Pech. Er hat die Nerven verloren, sonst wäre ihm nichts geschehen. Der Beifahrer ist mit dem Schrecken und mit einer Beule davongekommen. Ich werde Sie in Stettners LKW setzen. Ich hoffe, das stört Sie nicht, Gerber.“
„Hauptsache, es ist ein LKW“, sagte Bernd.
Fröhlich fuhr sich durch das struppige Haar. „Drei Überfälle sollten reichen. Ich glaube kaum, dass es zu einem vierten kommt. Kann sein, dass sich diese Verbrecher zur Abwechslung mal um die Konkurrenz kümmern. Bei uns sollte die Serie jedenfalls zu Ende sein.“
„Das hoffe ich auch, Herr Fröhlich. Wann kann ich anfangen?“
„Jetzt“, sagte Fröhlich und erhob sich. Er war nicht so fett, wie er hinter dem Schreibtisch wirkte. Er war groß und stattlich. Nun reichte er Bernd die Hand und hieß ihn herzlich in seiner Firma willkommen. Dann sagte er: „Die Papiere bringen Sie gleich ins Personalbüro. Frau Klein wird Ihnen sagen, wo das ist. Anschließend gehen Sie in die Garage hinüber. Da fragen Sie nach Hans Kersten. Er war Fred Stettners Beifahrer. Nun wird er Ihrer sein. Ein patenter Bursche. Er wird Ihnen bestimmt gefallen, Gerber. Also dann. Auf gute Zusammenarbeit.“
„Ja, Chef. Auf gute Zusammenarbeit.“ Bernd nickte. Er brachte die Papiere ins Personalbüro, nachdem ihm die Klein den Weg dorthin erklärt hatte. Als er wieder herauskam, stieß er mit Tobias Fröhlich zusammen. Ein böses Feuer flackerte in den Augen des unsympathischen Mannes. Sein Grinsen war so vertraueneinflößend wie das Grinsen eines Krokodils.
„Na, Gerber? Gehören Sie jetzt zu uns?“
„Ja, Herr Fröhlich.“
„Was hat der Alte über mich gesagt?“
„Nichts, Herr Fröhlich.“
„Quatsch nicht doof! Der redet immer hinter meinem Rücken. Da legt er dann erst richtig los. Über eines musst du dir im Klaren sein, mein Junge. Wenn du hierbleiben möchtest, musst du dich an mich halten und nicht an den Alten. Der geht eines Tages. Es kann sich nur noch um ein paar Jährchen handeln. Dann übernehme ich hier den Saftladen. Und wer mir nicht zu Gesicht steht, den werfe ich dann nicht bloß raus, nein, Gerber, das wäre zu einfach. Ich sehe auch zu, dass der gefeuerte Kumpel in der ganzen Branche keinen Job mehr kriegt. Also, wie ist’s? Bist du auf meiner Seite, oder hältst du es mit dem Alten?“
Bernd setzte sich die Mütze auf und hob die Schultern.
„Ich glaube, ich halte mich da besser raus.“
Tobias griente unverschämt. „Grau gibt es nicht, Hannes Gerber. Es gibt nur weiß oder schwarz. Nun? Ich will wissen, wie ich mit dir dran bin, Kleiner. Entscheide dich schnell.“
Bernd wollte sich wortlos an Tobias vorbeidrücken. Doch Fröhlich legte ihm seine große Hand auf die Brust und zischte gefährlich: „Hiergeblieben, Kleiner. Ich warte immer noch auf deine Antwort. Außerdem: Nimm die Mütze ab, wenn du mit mir redest.“
„Ihr Vater hat mich zu Hans Kersten geschickt. Bitte lassen Sie mich durch, Herr Fröhlich.“
„Kersten kann warten, Gerber. Du nimmst jetzt die Mütze ab.“
„Das werde ich nicht tun!“
„Dann werde ich sie dir von deinem verdammten Dickschädel schlagen!“, fauchte Tobias und schlug auch schon zu. Die Mütze segelte davon. Bernd holte sie und setzte sie sich geduldig wieder auf den Kopf. Da sah Fröhlich rot.
„Dir werde ich Respekt beibringen!“, knurrte er und wollte Schuster die Faust ans Kinn setzen. Doch Bernd federte flink zur Seite. Der Schlag verpuffte wirkungslos. Das reizte Tobias Fröhlich. Normalerweise schien er mit solchen Angriffen mehr Erfolg zu haben. Er rammte Schuster die Faust in den Bauch. Bernd nahm dem Hieb die Wucht, indem er zurückschnellte.
Und dann schlug er seinerseits zu. Lange genug hatte er Geduld bewiesen. Der Junge wollte es nicht anders haben. Also sollte er seine Lektion bekommen.
Zuerst ließ Bernd Schuster einen rechten Schwinger an der Kinnlade des Jungen explodieren. Tobias raste zurück und knallte gegen die Wand. Mit einem Satz war Bernd bei ihm. Er grub ihm seine Linke in den Magen und zog sogleich einen rechten Haken hoch.
Tobias‘ Kopf pendelte hin und her. Ein dünner Blutfaden sickerte aus dem Mund des Kerls. Nun versetzte Bernd dem bulligen Burschen noch ein Dutzend demoralisierender Ohrfeigen. Damit war das Maß dann voll. Total ausgeflippt lehnte Tobias Fröhlich an der Wand. Sein Atem rasselte. Er leckte sich das Blut von den Lippen. Ein furchtbarer Hass glühte in seinen Augen.
„Na warte, Gerber. Das wirst du bereuen. Du wirst ein verdammt schweres Leben hier haben, das kann ich dir versichern, denn dafür werde ich persönlich sorgen.“
Bernd ließ den kochenden Mann stehen, verließ den Bürotrakt und begab sich zu den Garagen hinüber.
„Fräulein Fröhlich!“, rief jemand. „Fräulein Fröhlich!“
Bernd spitzte sofort die Ohren. Daniela Fröhlich drehte sich um. Sie hatte sehr viel Glück, dass sie ihrem Vater kein bisschen ähnlich sah. Ganz reizend war sie, was man weder von Carsten noch von Tobias Fröhlich behaupten konnte. Ihre Figur war perfekt, sie hatte blaue Augen, einen vollen, sinnlichen Mund, wohlproportionierte Brüste und lange, schlanke Beine. Ihr Gesicht war ausdrucksstark und verriet viel Intelligenz. Sie trug einen dicken Rollkragenpulli und Jeans. Der Mann, der sie gerufen hatte, lief auf sie zu. Die beiden wechselten wenige Worte. Dann wandte sich Daniela um und wollte aus der Halle gehen. In dem Augenblick trat ihr Bernd in den Weg.
„Guten Tag“, grüßte er mit einem beeindruckten Lächeln um die Lippen. „Ich wette, Sie sind Fräulein Daniela Fröhlich.“
„Und wer sind Sie?“, fragte das Mädchen mit einem aufgeweckten Blick.
„Gerber. Hannes Gerber. Der Mann, der aufpasst, dass von nun an nichts mehr geklaut wird!“, sagte Bernd großsprecherisch.
„Neu?“
„Superfrisch“, nickte Bernd. „Soeben von Ihrem Vater eingestellt. Ich hoffe, das findet Ihr Einverständnis, Fräulein Fröhlich.“
Daniela hob die Schultern. „Es ist Vaters Unternehmen, nicht meins. Haben Sie schon meinen Bruder kennengelernt?“
„Ja, das habe ich.“
„Wie steht er zu Ihnen?“
Bernd grinste. „Oh, Ihr Bruder ist begeistert von mir.“
Daniela ließ ihre Zunge hastig über die vollen Lippen huschen.
„Hören Sie, Hannes. Lassen Sie sich von Tobias nicht provozieren, das tut er nämlich ungemein gern. Er ist immer auf der Suche nach Streit. Er wartet stets auf einen Grund, zuschlagen zu können.“
Wieder grinste Schuster. „Dieses Stadium des Kennenlernens haben wir bereits hinter uns.“
Danielas Augen weiteten sich. Ihr ungläubiger Blick suchte eine Schramme in Bernds Gesicht.
„Tobias erholt sich gerade davon“, meinte Schuster leichthin.
„Wollen Sie damit etwa sagen, er hätte Sie angegriffen, Sie hätten nichts abbekommen, aber er wäre auf die Bretter gegangen?“
„Genauso ist es gewesen, Fräulein Fröhlich.“
Das Mädchen stieß hörbar die Luft aus. „Oh mein Gott, Hannes. Das kann schlimme Folgen für Sie haben.“
„Ich bin nicht ängstlich.“
„Tobias ist ungemein gehässig.“
„Ich werde ihn abblitzen lassen“, sagte Bernd.
Daniela lachte auf. „Sie gefallen mir, Hannes.“
„Sie gefallen mir auch.“
„Ehrlich gesagt, ich gönne Tobias diese Niederlage. Wenn Sie mal was von mir brauchen sollten, ich bin in der Buchhaltung zu finden, Herr Gerber.“
„Ich werde mich melden, das ist ein Versprechen“, sagte Bernd, dann fragte er sie noch schnell, wo er Hans Kersten finden könne. Sie sagte es ihm und lief zum Bürotrakt hinüber. Sie war weit und breit das einzige Wesen, bei dessen Anblick einem sich nicht der Magen umdrehte.
Der Beifahrer kroch gerade unter dem LKW hervor, als Bernd ihn erreichte. Kersten wischte sich die öligen Hände mit Krepppapier ab und schaute Bernd forschend an.
„Sind Sie Kersten?“
„Hm.“
„Ich bin Hannes Gerber.“
„Tja. So spielt das Leben. Wir können nicht alle Kersten heißen, nicht wahr?“
„Ich bin LKW-Fahrer“, fuhr Bernd Schuster fort. „Herr Fröhlich hat mich soeben eingestellt. Wir beide sollen ein neues Gespann bilden. Tut mir leid, was Ihrem Kumpel passiert ist.“
Hans Kersten musterte Bernd mit schmalen Augen. „Ach, hat der Chef mit Ihnen darüber gesprochen?“
„Er hat mir gesagt, was mit Fred Stettner geschehen ist. Ich hätt’s ja sowieso mal von jemandem erfahren. Vielleicht sogar von Ihnen.“
Kersten beschnüffelte Schuster. „Schon oft mit ’nem LKW unterwegs gewesen?“
Bernd grinste. „Ich bin in ’nem LKW auf die Welt gekommen. Kann mich ohne so was kaum fortbewegen.“
Kersten wies auf den 22-Tonner, hinter dem er vorhin hervorgekrochen war und sagte: „Das wird Ihre neue Heimat, Gerber.“
„Nennen Sie mich Hannes.“
„Okay. Hannes.“
Bernd reichte Kersten seine Roth-Händle-Packung. Sie setzten sich auf eine dreckige Holzbank, auf der eine Menge Werkzeug lag, und rauchten schweigend. Bernd erzählte über seine fiktive Vergangenheit, als Hans Kersten ihn danach fragte. Kersten selbst erwähnte mit einigen Sätzen, woher er kam, und dann schwenkte das Gespräch allmählich auf Fred Stettner ein.
„Ein Verrückter war der“, sagte Kersten kopfschüttelnd. „Bei dem drehte sich alles nur um den LKW. Das Fahren und der Laster, das waren seine Heiligtümer, an die keiner rühren durfte.“
„Wie war das, als ihr überfallen wurdet?“, fragte Bernd mit einer ganz natürlichen Neugier. Jeder andere neue Fahrer hätte das auch gefragt.
„Total blöde Geschichte. Wir wurden kurz vorher von den Vopos gestoppt. Fred musste einen Zwanziger abdrücken, weil er angeblich vor einer Baustelle beim Fahrbahnwechsel nicht geblinkt hatte. Dann haben uns die Burschen noch darauf hingewiesen, dass für LKWs an einer Baustelle die Transitstrecke verlassen werden musste, um über eine Umleitung weiterzukommen. Das wussten die Verbrecher und haben ‘nen ganz alten Trick angewandt. Und trotzdem sind Fred und ich darauf hereingefallen“, meinte Kersten. „Dabei war unser LKW schon insgesamt der dritte, der überfallen wurde. Manchmal hat man eben ein Brett vor dem Kopf. Fred fuhr von der Autobahn herunter. Plötzlich lag da ein Mann auf‘m Bauch. Fred stoppte den LKW. Wir wollten dem Mann helfen, aber der hatte keine Hilfe nötig. Wer Hilfe gebraucht hätte, das waren Fred und ich. Kaum waren wir bei dem Typ, hielt er uns seinen Ballermann unter die Nase und schwafelte von ’nem Überfall. Zuerst dachte ich, er wollte das Ding allein drehen, aber da waren noch zwei andere Kerle mit Pistolen. Fred drehte durch. Der wollte seinen LKW verteidigen. So was Hirnrissiges, aber er hatte das vor. Klar, dass das schiefging. Sie haben ihn kaltblütig umgelegt.“
„Wie sahen die Kerle denn aus?“, forschte Bernd weiter.
„Ihre Gesichter waren schwarz angeschmiert, mit irgend ’ner Farbe. Und sie trugen riesige Sonnenbrillen, die viel vom Gesicht verdeckten. Der Kragen ihrer Windjacken war hochgeklappt. Ich würde keinen von ihnen wiedererkennen.“
„Sie haben Sie niedergeschlagen?“
„Ja. Ich kriegte eins auf die Rübe, dann verdrückten sie sich mit dem LKW. Der Überfall war gelaufen. Als ich zu mir kam, bildete ich mir ein, Fred würde noch leben. Herrgott, was habe ich nicht alles mit ihm angestellt, aber da war nichts mehr zu machen. Ich wollte es nicht begreifen, aber für Fred war die letzte Fahrt eine Fahrt ins Jenseits geworden. Ich mochte ihn sehr, diesen verrückten Kerl. Er war mir wie ein Bruder.“
„Und dann war die Volkspolizei da?“
„Hör bloß auf mit denen! Die haben mich stundenlang verhört, und dann ins Krankenhaus gesteckt, wo ich bewacht wurde. Erst nach zwei Tagen konnte ich nach West-Berlin gelangen, weil mich der Chef aus der Zone abholen ließ. Armer Fred, ich werde ihn nicht so schnell vergessen.
„Vielleicht kann ich Fred ersetzen, Hans“, sagte Bernd.
Kersten zuckte mit den Schultern. Er nahm noch einen Zug von der Roth Händle. Dann warf er die Kippe auf den öligen Boden und trat sie mit seinen ausgelatschten Schuhen aus.
„Seit Fred tot ist, haben alle Fahrer Schiss“, sagte der Beifahrer ernst.
„Das kann ihnen keiner verdenken. Drei Überfälle in so kurzer Zeit. Und dann auch noch ein Toter.“
„Dreimal wurden jeweils jene LKWs überfallen, die die wertvollste Fracht geladen hatten“, sagte Kersten. „Zweimal Haushaltsgeräte - Wert je 50 000 Mark. Und einmal Rohstoffe für die chemische Industrie in Berlin noch dazu - Wert 70 000 Mark.“
„Woher wissen die Gangster, wo jeweils das Meiste zu holen ist?“, erkundigte sich Bernd.
Hans Kersten hob wieder seine fleischigen Schultern. „Keine Ahnung, Hannes.“
„Könnte es nicht sein, dass die Ganoven jemanden in der Frachtabteilung sitzen haben?“
Kerstens Augen weiteten sich. „In unserer Frachtabteilung? Verdammt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das wäre natürlich eine ausgezeichnete Möglichkeit für die Gangster, zu erfahren, was sie wissen wollen.“
„Leidet einer in der Frachtabteilung besonders arg an chronischem Geldmangel?“, bohrte Bernd Schuster vorsichtig weiter. Nun war auch seine Zigarette aufgeraucht. Er warf sie neben die von Kersten und trat sie ebenfalls aus.
„Wenn Sie mich so fragen“, sagte Kersten nachdenklich, „dann kann ich im Zusammenhang mit chronischem Geldmangel nur einen Namen nennen: Roger Müller.“
„Wer ist Roger Müller?“, erkundigte sich Bernd Schuster.
„Der Leiter der Frachtabteilung.“
„Wieso ist er immer blank?“
„Weibergeschichten“, sagte Kersten pulvertrocken. „Und was er mit den Frauen nicht durchbringt, das verliert er beim Zocken oder sonst wo.“
‚Solche Leute sind prädestiniert für eine handfeste Erpressung‘, dachte Bernd. ‚War Müller der Mann, der mit den Gangstern gemeinsame Sache machte? Der Leiter der Frachtabteilung persönlich?‘
„Könnte Müller ...“, begann Bernd, doch da schüttelte Kersten energisch den Kopf.
„Nein, Hannes. Nein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Zugegeben, Müller ist nicht gerade mein Fall, und ich würde ihm eine ganze Menge übler Dinge zutrauen, aber dass er mit den Gangstern unter einer Decke steckt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.“
Jedenfalls war Müller ein Anhaltspunkt für Schuster. Er beschloss, sich den Mann bei nächster Gelegenheit genauer anzusehen. Er versprach, morgen um neun Uhr wiederzukommen, nachdem Kersten ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sie um zehn den LKW zu fahren hätten, soviel hatte er aus dem Frachtbüro vernommen. Dann verabschiedete sich Schuster. Er hatte schließlich noch einen zweiten Fall am Hals, dem er nicht so einfach unter den Teppich gekehrt wissen wollte.
Manfred Keller hatte ihm etwas sagen wollen. Er war nicht mehr dazu gekommen, aber er hatte einen Zettel bei sich gehabt: Frühlings Gästepension Nr. 17.
Dort wollte sich Schuster jetzt gleich mal umsehen. Er lief zu seinem Mercedes zurück und machte aus Hannes Gerber wieder Bernd Schuster. Lederweste und Schirmmütze verstaute er im Kofferraum.
––––––––
6
Die Pension lag in einem Vorort
Von hier hätte es Bernd nicht weit zu seinem alten Freund Horsti gehabt.
Die Pension hatte keinen Pförtner und auch niemand am Empfangstresen sitzen, also ging er zum Treppenhaus und hinauf in die erste Etage, als eine Tür geöffnet wurde.
Zwei Männer kamen aus dem Zimmer mit der Nr. 17 und fesselten Bernds Aufmerksamkeit. Sie hatten Gepäckstücke dabei. Was hatte das zu bedeuten? Bernd holte den Zettel aus seiner Tasche. Er drehte und wendete ihn, doch mehr verriet das Papierchen nicht. Frühlings Gästepension Nr. 17. Manfred Keller hätte Bernd vielleicht eine Kurzgeschichte über die beiden Kerle erzählen können. Aber Manfred lebte nicht mehr. Etwa deshalb, weil er sich diese Adresse notiert hatte?
Die Männer sahen nicht wie seriöse Vertreter einer seriösen Firma aus. Die sahen eher wie ziemlich üble Burschen aus. Bernd ging auf der Treppe nach oben, verhielt dann aber dort und behielt die beiden im Auge. Durch das Treppenhausfenster konnte er sehen, wie die beiden das Gepäck im Kofferraum einer schwarzen Limousine verstauten. Wie Preisboxer in Frühpension wirkten die beiden. Mit steinernen Mienen setzten sie sich in ihren Wagen. Und - sie sahen sich kurz zuvor noch mal um, als hätten sie ein schlechtes Gewissen. Dann fuhr der Wagen los, und Bernd Schuster trat schon wieder auf die Straße, eilte zu seinem Mercedes und folgte dem schwarzen Wagen mit lodernder Neugier.
Sie fuhren in Richtung Norden. Bernd stellte sich geschickt an. Die Ganoven - für die er sie hielt - hatten immer noch keine Ahnung, dass er sie beschattete. Sie fuhren auf eine Tankstelle zu. Daneben gab es einen kleinen Ziegelbau: Büro, Wohnung, Café. Hinter der Tankstelle gab es eine schäbige Autoreparaturwerkstätte, aus der die Fahrzeuge vermutlich defekter herauskamen, als sie hineingeschoben wurden. Hinter der Werkstatt entdeckte Bernd einen stattlichen Autofriedhof. Die Männer schälten sich aus der Limousine, einem älteren BMW-Modell. Bernd beobachtete sie, wie sie auf ein kleines Haus neben dem Schrottplatz gingen. Mit dem Gepäck, das sie aus der Pension abgeholt hatten.
Der Sache wollte Bernd Schuster sofort weiter auf den Grund gehen. Er bog in die nächste Straße ein und erreichte die Rückfront des Autofriedhofs. Da kletterte er über einen rostigen Maschendrahtzaun. Die Schrottfahrzeuge warfen lange Schatten über das unkrautbestandene Gelände. Vehikel stand auf Vehikel. Traurige Pyramiden waren das. Aber sie boten Bernd den Schutz, den er brauchte.
Er kam schnell voran. Ab und zu knirschte ein Sandbrocken unter seinen Schuhen. Mehrmals blieb er kurz stehen, um zu lauschen. Aus der Reparaturwerkstatt hallten die üblichen Arbeitsgeräusche. Ein alter, klappriger Kompressor ratterte. Geduckt lief Schuster weiter. Er kam ziemlich nahe an das Haus heran. Da öffnete sich die Tür. Die Männer traten heraus, gingen zur Tankstelle vor und verschwanden in dem Ziegelbau, neben dem ein gut erhaltener Landrover stand.
Plötzlich stellten sich Schusters Nackenhaare auf. Sein scharfes Gehör hatte trotz des ratternden Kompressors ein Geräusch vernommen, das seine innere Alarmanlage sofort zum Schrillen veranlasste. Er spannte die Muskeln und fuhr herum. Was er sah, war nicht gerade ermutigend. In feindseliger Haltung stand da ein Mann, der sogar Cassius Clay in der Luft zerreißen konnte.
Der Bursche stellte keine Fragen. Vielleicht konnte er nicht einmal reden. Aber dreschen konnte er, und das bewies er augenblicklich. Bernd kassierte einen Treffer, der ihn mitten in den Blechhaufen hineinschleuderte. Schon war der Bursche über ihm. Er krallte ihm die sehnigen Finger in den Hals. Die Augen des Kerls waren blutunterlaufen. Für ihn schien es nichts Schöneres zu geben, als einen Menschen umzubringen. In Bernds Kopf brauste das Blut. Er bekam keine Luft, und es gelang ihm nicht, die Hände von seiner Gurgel zu kriegen.
Da trat er den Kerl dorthin, wo es am meisten wehtut. Ein Knurren war die erste Reaktion. Und die zweite war ein Lockern des mörderischen Griffs. Schuster warf sich sofort zur Seite. Die Eisenfinger glitten ab. Er japste gierig nach Luft und hackte mit seiner Handkante nach dem dicken Nacken des Gegners. Hinterher federte er hoch. Sein Gegner ließ seine mächtigen Fäuste auf und ab wippen. Schnaufend preschte er vorwärts. Bernd wich aus. Und wieder legte er in seinen Handkantenschlag alles, was er aufbieten konnte. Aber der Bursche fiel nicht. Der Mann war einfach zu widerstandsfähig für Fäuste und Handkanten. Deshalb bewaffnete sich Schuster blitzschnell mit einer Eisenstange. Als der nächste Angriff des Riesen kam, rammte Bernd ihm die Stange zuerst in den Bauch. Daraufhin klappte der Hüne zusammen. Und jetzt schlug Schuster mit der Stange schnell und präzise zu. Dem Eisen war der schwere Brocken nicht gewachsen. Er verdrehte die Augen und sank auf die Knie. Schnaufend wollte er sich sogleich wieder hochkämpfen, aber das schaffte er trotz seiner ungeheuren Kraft nicht. Er wurde bleich, seine Züge erschlafften, er kippte zur Seite und blieb für eine Weile liegen.
Bernd machte, dass er fortkam. Dass der Riese Radau schlug, war das Letzte, was Schuster brauchen konnte.
––––––––
7
Simon Feuker war froh, so schnell einen Job gefunden zu haben. Er hatte den Tipp von seinem Zellengenossen bekommen.
„Wenn du einen Job brauchst, wende dich zuerst an Winfried Schack“, hatte der ihm gesagt. „Der hat unter Garantie was für dich. Und wenn er nichts hat, dann weiß er bestimmt, wer ’nen tüchtigen Mann wie dich brauchen kann.“
Feuker saß in einer Cafeteria und dachte über seine Zukunft nach. Schuster war seine nahe Zukunft. Erst wenn er mit ihm abgerechnet hatte, würde er seinen inneren Frieden wiederfinden. Hart traten seine Wangenmuskeln hervor, als er an Manfred Keller dachte. Keller hatte ein Gespräch belauscht, das er, Feuker, mit einem guten Freund geführt hatte, und der verdammte Spitzel hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als sofort Schuster anzurufen.
Feuker grinste vor sich hin. Aber er hatte Keller noch rechtzeitig erwischt. Und nun war Schuster dran. Vielleicht morgen schon. Mal sehen. Zuerst musste er das Terrain sondieren. Schuster wohnte schließlich im 14. Stockwerk der Wohnanlange in der Kurfürstenstraße. Ein Nachteil? Ein Vorteil? Es würde sich herausstellen.
Ein Ruck ging durch Feukers Körper. ‚Warum willst du bis morgen damit warten? Warum besorgst du es dem verdammten Schnüffler nicht gleich in dieser Nacht?‘. fragte er sich. Unschlüssig zuckte er mit den Schultern. Er trank noch einen Kaffee und verließ das Lokal.
Seine Doris fiel ihm ein. Als sie ihn von ihr fortgeholt hatten, hatte sie ihm versprochen, auf ihn zu warten. Anfangs waren auch laufend heißglühende Briefe ins Gefängnis gekommen. Doch allmählich hatte die Schreibwut nachgelassen. Ein paar Briefchen waren noch eingetropft. Dann war es vorbei gewesen. Ein anderer Mann, hatte Feuker sofort gedacht. Ohne Grimm, denn er kannte Nelly. Man konnte mit ihr Pferde stehlen. Aber zwischendurch musste man es ihr tüchtig besorgen, denn das brauchte sie. Jahrelang ohne Mann, das konnte Doris nicht aushalten. Das wäre für sie die schlimmste Strafe gewesen, die man ihr antun konnte. Sie war damals ganz verrückt nach ihm gewesen. Weil er ihre hohen Ansprüche erfüllen konnte. Ob sie sich wieder für ihn interessieren würde, wenn er bei ihr vorbeischaute?
Grinsend kickte Feuker eine Konservendose in den Rinnstein. Dann machte er sich auf den Weg zu Doris. Sie wohnten damals beide in Berlin, und die Sache in Hamburg war ein vielversprechendes Ding, für das man ihn angeheuert hatte. Und das prompt schiefgegangen war. Dank diesem Privatschnüffler.
In einem Blumenladen kaufte er drei rote Rosen. Dann putzte er sich bei einem Automaten die Schuhe. Ein unerklärliches Gefühl beschlich ihn vor dem Haus, in dem Doris wohnte. Irgendwie kam er sich mit den Blumen dämlich vor. Früher hatte er es nicht nötig gehabt, Doris Blumen zu bringen. Er hatte ihr etwas Anderes gebracht, und damit hatte sie jedes Mal mehr Freude gehabt als mit irgendwelchem Grünzeug.
Feuker trat in das Haus und lief die Treppenschnecke hoch. Im dritten Stock machte er kurz Rast. Dann lief er zum vierten weiter. Zweifel kamen ihm, ob Doris überhaupt noch hier wohnte. Vielleicht war sie zu irgendeinem Glücksritter gezogen.
Sie war es nicht. Ihr Name prangte immer noch an der braunen Tür. Der Lack war rund um das Schloss abgekratzt. Monatelang hatte er einen Schlüssel zu diesem Schloss gehabt. Er hatte ihn liegengelassen, als die Bullen ihn abholten, in die Grüne Minna stopften und mit ihm ab nach Hamburg fuhren.
Mann, das war damals vielleicht ein elender Tag gewesen. Doris hatte geflennt. Er hatte eine Mordswut im Bauch gehabt. Und alles nur wegen dieses verdammten Bernd Schuster. Die Rechnung würde nun nicht mehr lange offenbleiben!
Feuker putzte seinen Anzug ab, obwohl er sauber war. Es war mehr eine Verlegenheitsgeste. Viereinhalb Jahre. In dieser Zeit kann eine Menge passieren. Er fragte sich, wie Doris jetzt wohl aussah. War sie noch dicker geworden? Unansehnlich? Einen kleinen Bauch hatte sie immer schon gehabt. Dafür war aber auch ihr Busen eine wahre Wonne gewesen.
Nervös schaute Feuker den Klingelknopf an. ‚Feigling!‘, schalt er sich. Irgendwie hatte er Angst vor der Wahrheit. Verlegen blickte er die drei roten Rosen an. Nur drei. Sie wird denken, du bist geizig.
Ärgerlich über sein Zögern drückte er auf den Klingelknopf. Auch der hatte sich in den viereinhalb Jahren verändert. Er funktionierte nicht mehr. Da hämmerte Feuker mit den Knöcheln gegen die Tür. Unwillkürlich tat er dies im gleichen schnellen Rhythmus, in dem sein Herz in seiner Brust schlug.
Endlich ging die Tür auf. Doris stand vor ihm. Ihr rötlich blondes Haar war zerzaust. Sie trug ein schwarzes Negligé, das sie sich ganz schnell übergeworfen zu haben schien. Sie hatte immer noch die gleichen schwammigen Hüften, den Bauch, der nicht größer geworden war, den Ansatz eines Doppelkinns. Eigentlich hatte sie sich kaum verändert. Darüber war Feuker froh. Mit weit aufgerissenen pulvergrauen Augen schaute sie ihn verwirrt und überrascht an. Ihm fiel auf, dass sie das Parfüm gewechselt hatte. Sie roch jetzt nach Maiglöckchen. Früher hatte sie nach Flieder geduftet. Das war aber eigentlich alles, was Simon Feuker an Veränderung feststellen konnte.
„Simon!“, drückte sie verblüfft hervor.
Er grinste. „Ich bin’s wirklich, Baby.“
„Simon!“
„Darf ich nicht reinkommen, Doris?“
Sie wollte fast den Kopf schütteln, tat es dann aber nicht, sondern gab die Tür frei. Er trat in die Wohnung. Fast jedes Möbelstück kannte er. Und da sie sich nicht die Mühe gemacht hatte, etwas am Stil der Einrichtung zu verändern, stand alles noch am selben Platz. Er war sofort wieder zu Hause. Im Wohnzimmer fand er blind die Bar und nahm sich ein Glas. Auch ihr goss er ein Glas ein, denn er wollte mit ihr auf seine Auferstehung trinken.
„Jetzt bist du sprachlos, was?“, lachte er und reichte ihr das Glas.
Sie warf einen verlegenen, vielleicht auch nervösen Blick zur Schlafzimmertür.
„Warum hast du nicht angerufen, Simon?“, fragte sie mit ihrer leicht aufgerauten Mädchenstimme.
„Wer ruft schon vorher an, wenn er nach Hause kommt?“, schmunzelte Feuker. „Du hast geschlafen?“
„Ja“, antwortete sie zögernd. Sie hielt ihm noch einmal das Glas hin. Auch er trank.
„Wie geht’s dir so?“, erkundigte er sich. Er schaute sich um, sein Blick fiel auf einen weichen Sessel. Er nahm Platz. Sie blieb erregt stehen, nagte an der Unterlippe, freute sich über das Wiedersehen, doch gleichzeitig schien es ihr auch unangenehm zu sein. Der Zeitpunkt war nicht ganz der richtige.
„Es geht mir gut“, antwortete sie auf seine Frage.
„Seit wann schläfst du am Nachmittag?“
„Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Kopfschmerzen. Die noblen Herrschaften nennen das Migräne.“
„Geht’s jetzt schon wieder besser?“
„Ich denke schon.“
„Dann gib mir einen dicken, fetten Kuss zum Wiedersehen. Ich war lange weg. Und ich habe oft von deinen Küssen geträumt, Doris. Viele Stunden lag ich wach und dachte an deinen Körper. Weich, weiß, zart ...“
Sie trank ihr Glas hastig wieder leer. „Warum hast du nicht angerufen und mich wissen lassen, dass du wieder aus dem Knast raus bist, Simon? Ich hätte eine Party für dich gegeben.“
„Du weißt, dass ich keine Partys mag. Ich bin am liebsten mit dir allein.“
„Hast du schon wieder einen Job?“
„Ja. Seit heute. Nichts Besonderes. Ich werde für einen Mann arbeiten, dem eine Autoreparaturwerkstatt gehört.“
„Als Automechaniker?“
„Das wird er mir hoffentlich nicht antun“, sagte Feuker grinsend. Bisher hatte er Doris‘ Nervosität der Wiedersehensfreude zugeschrieben. Doch nachdem sie zum zehnten Mal zur Schlafzimmertür hinübergeblickt hatte, wurde er misstrauisch. Ihr Negligé! Die in Unordnung geratene Frisur. Die angeblichen Kopfschmerzen. Und das Transistorradio, das auf dem Kaminsims stand. Das war ganz und gar nicht ihr Stil. „Du bist nicht allein“, sagte er ihr auf den Kopf zu. Sofort wurde sie unter der Schminke blass.
„Ich sagte doch, du hättest anrufen sollen“, meinte sie kleinlaut. Besorgt zog sie ihre Brauen hoch. Feuker schnellte hoch. Er kniff die Augen zusammen.
„Ist er im Schlafzimmer?“
Hätte es einen Sinn gehabt, zu leugnen? Doris hatte nicht den Mut, Feuker anzulügen, deshalb nickte sie zaghaft.
„Hör zu, Simon, mach keinen Mist! Der Junge da drinnen bedeutet mir nichts. Ich war bloß so einsam. Und dass du wieder draußen bist, davon hatte ich ja keine Ahnung. Er kam zu mir, ich habe ihn bei Freunden kennengelernt und habe ihm irrtümlich meine Adresse gegeben. Er kam zu mir, weil er dachte, ich hätte ihn dazu aufgefordert. Zuerst wollte ich ihn gleich wieder wegschicken. Ehrlich, das musst du mir glauben. Ich wollte ihn wieder nach Hause schicken, weil ich gar nicht in Stimmung war. Aber dann bat er mich, ich solle ihm wenigstens einen Asbach geben, damit er die weite Fahrt nicht ganz umsonst gemacht hätte. Naja. Du kennst mich. Ich habe ein gutes Herz. Also gab ich ihm den Schluck. Er wollte nicht allein trinken, deshalb kippte ich einen mit. Und wenn ich mal was getrunken habe - ich wollte es gar nicht. Es ist einfach passiert. Du darfst mir deshalb nicht böse sein. Wenn ich geahnt hätte, dass du schon wieder aus dem Gefängnis raus bist, hätte der Knabe da drinnen seine Show woanders abziehen können. Wenn du doch bloß angerufen hättest!“
Feuker nickte aggressiv. „Die Angelegenheit werde ich gleich mal in die Hand nehmen, Doris.“
„Versprich mir, dass du keinen Ärger machst.“
„Das kommt auf den Jungen an.“
„Simon, er ist noch ein halbes Kind.“
„Er hat mit dir geschlafen. Ich will ihm klarmachen, dass von nun an ich’s dir wieder besorge.“
Ehe Doris ihn aufhalten konnte, lief Feuker zur Schlafzimmertür und riss sie auf. Im Bett saß ein nackter Jüngling. Er hatte etwas Griechisches an sich, und er schien mächtig stolz auf die Eroberung zu sein, die er gemacht hatte. Doris war ein erfahrenes Mädchen. In seinem Alter bildet man sich auf solche Eroberungen noch einen Haufen ein.
„Hallo, Sportsfreund“, sagte er und winkte Feuker mit einem ungenierten Grinsen. Dass er nackt war, störte ihn nicht. Vor einem Mann brauchte er sich nicht zu schämen. Und Doris wusste sowieso bestens Bescheid.
„Raus!“, knurrte Feuker und wies mit dem Daumen auf die Tür, die aus der Wohnung führte.
Der Jüngling hob trotzig den Kopf.
„Ich denke nicht daran! Doris ist meine Freundin. Sie liebt mich. Ich lasse mir nicht von irgendeinem dahergelaufenen Gockel die Tür weisen. Wenn ich gehen soll, soll Doris es mir sagen.“
„Ja!“, rief Doris im Hintergrund. „Ja, geh! Bitte geh, bevor‘s ein Unglück gibt!“
Feuker grinste. „Hast du Doris gehört?“
„Sie sagt das bloß, weil sie Angst vor dir hat. Ich hingegen habe keine Angst vor dir, Sportsfreund.“
„Okay!“, schnaufte Feuker gereizt. „Du hattest deine Chance. Pech für dich, dass du sie nicht genützt hast.“ Er lief zum Bett und knallte dem Jüngling eine. Der Bursche konnte sich gar nicht schnell genug decken. Und schon langte er wieder zu.
Diesmal war der Junge aber auf der Hut. Er schnellte seinen Kopf zur Seite. Der Schlag ging daneben. Er federte nackt, wie er war, aus dem Bett und konterte mit einer gestochenen Geraden, die Feuker bis in die Ecke trieb. Es war ein Kampf, der ulkig anzusehen war. Der Nackte gegen den Angekleideten. Sie kämpften heftig und verbissen. Ein Nachttisch ging kaputt, auch die Lampe, die darauf stand. Doris raufte sich verzweifelt die Haare.
„Aufhören!“, kreischte sie. „Hört doch auf! Ihr benehmt euch wie die Idioten!“
Doch die beiden Kampfhähne hörten nicht auf sie. Der Jüngling machte keine schlechte Figur. Vom Boxen verstand er eine ganze Menge. Seine Muskeln lagen markant unter der braunen Haut. Er machte Feuker eine ganze Weile zu schaffen. Doch dann nahm er seinen Kopf vor einem Schwinger nicht schnell genug zurück. Feukers Faust krachte gegen seine Kinnlade. Der Bursche wurde aufs Bett geschleudert und war von diesem Augenblick an nur noch ein leichtes Fressen für Feuker. Er bearbeitete ihn mit seinen Fäusten so lange, bis die Niederlage deutlich im Gesicht des Gegners zu erkennen war. Dann warf er ihm seine Jeans, die Unterwäsche, und alles, was an Kleidungsstücken herumlag, zu und befahl ihm mit schneidender Stimme: „Anziehen! Und dann nichts wie raus aus diesem Tempel!“
Der Unterlegene zog sich keuchend an. Er leckte sich immer wieder das Blut von den Lippen. Sein Gesicht war verschwollen. Die Augen waren blau.
„Oh Simon, warum hast du das gemacht?“, jammerte Doris, als sie das Antlitz des Jungen erblickte. „Ich kann ihn gar nicht ansehen.“
„Das wollte ich damit erreichen“, sagte Feuker.
Der andere zog den Reißverschluss an seiner Hose hoch, stopfte sein Hemd in den Hosenbund, warf sich sein Jackett über die Schulter, stieg in die Slipper und eilte aus der Wohnung.
Feuker war stolz auf das, was er getan hatte. Sein Comeback hatte genau den richtigen Rahmen. Damit machte er großen Eindruck auf Doris. Und sie würde sich hüten, in nächster Zeit einen anderen Mann in ihre Wohnung einzulassen.
Grinsend genoss Feuker den Abzug des Jungen. Sein Blick fiel auf das Radio.
Er schaute Doris noch einmal anklagend an und verließ dann ihre Wohnung. Sie hob nur die Schultern. Es war seine Schuld, dass er so aussah. Warum hatte er sich nicht besser gewehrt?
Feuker rannte zum Transistorradio, ergriff es, lief zur Tür, riss sie auf. Feuker rief laut: „He, Kumpel! Du hast noch was vergessen!“ Er holte aus und schleuderte den Apparat hinaus. Das Ding flog dem Jungen am rechten Ohr vorbei und zerschellte an der Korridorwand. Laut lachend knallte Feuker die Tür zu. Jetzt war er der uneingeschränkte Herrscher in Doris Reich. Sie kam ihm wie eine Hündin entgegen, die Hiebe erwartete.
„Gewissensbisse?“, fragte er sie von oben herab.
„Ja, Simon.“
„Brauchst du nicht zu haben.“
„Du weißt, wie ich die Einsamkeit hasse.“
„Ich weiß es, und deshalb verzeihe ich dir diesen Fehltritt. Mach mir was zu trinken!“
„Ja, Simon. Ja.“ Sie eilte zur Bar und goss erneut von dem Weinbrand ein.
„Was geschehen ist, während ich nicht hier war, darüber kommt der große Schwamm, okay, Baby?“
„Okay“, sagte Doris sichtlich erleichtert, denn sie hatte es in dieser Zeit ziemlich verrückt getrieben.
––––––––
8
Immer noch nagte Bernd Schuster an dem Gedanken, was ihm Manfred Keller wohl hatte sagen wollen. Er versetzte sich zum xten Mal in das mexikanische Restaurant zurück, wo Keller den Tod gefunden hatte. Er war von einem Mann erschossen worden, der sich als Kellner verkleidet hatte. Und wieder hatte Bernd das Gesicht des Mörders vor sich. Bekannt und fremd war es ihm in gleichem Maße. Vielleicht hatte es vor Jahren anders ausgesehen. Plötzlich war da ein vager Verdacht: Simon Feuker. Mit einem Schlag konnte sich Bernd an den Fall Feuker wieder erinnern. Und nun wurde ihm auch klar, weshalb ihm Feukers Gesicht fremd vorgekommen war: Damals hatte der Ganove einen Kinnbart getragen. Auch sein Haar war wesentlich länger gewesen.
Simon Feuker?
Bernd begann sofort zu kombinieren. Manfred Keller wollte ihm etwas Wichtiges sagen. Er kam nicht dazu, weil Feuker es verhinderte - vorausgesetzt, dass der falsche Kellner tatsächlich Feuker gewesen war.
Bernd konnte sich noch genau an Feukers Verhaftung erinnern. Der Bursche hatte ihm mit den Augen und mit dem Mund tödliche Rache geschworen. Er hatte ein dickes Ding in Hamburg abgezogen und war danach wieder nach Berlin zurückgekehrt. Schuster hatte die Beweise zusammengetragen, die zu seiner Verhaftung führten.
Schuster griff nach dem Hörer des Autotelefons. Nachdem er den Hünen mit der Eisenstange bearbeitet hatte, war er zu seinem Mercedes zurückgeeilt und war erst mal drei Straßen weit weitergefahren. Wozu hatte er schließlich einen guten Freund bei der Polizei?
Er rief das Dezernat 11 in der Keithstraße an. Die nette Telefonistin, die er persönlich kannte, bat er, ihn mit dem Büro von Captain Horst Südermann zu verbinden. Sie tat es schnell, weil sie Bernd damit einen Gefallen erweisen wollte.
„Hier Inspektor Südermann!“, kam Horsts schnarrende Stimme durch die Leitung.
„Hier Bernd Schuster“, gab Bernd Schuster zurück.
„Etwa der Bernd Schuster, der mir seit der letzten Skatrunde zwanzig Mark schuldet?“
„Neunzehn Mark!“
„Ich bin für runde Summen.“
„Weil du selber rund bist.“
„Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich zwei Pfund abgenommen.“
„Nicht zu fassen. Wie schaffst du das bloß?“, sagte Bernd lachend.
„Kein Bier - außer es handelt sich um Freibier, keine Kartoffel, keine Teigwaren.“
„Armer Kerl“, sagte Bernd.
„Meinst du mich oder etwa meinen Kollegen?“
„Du hast doch sicher schlechte Laune, seit du Gewichtsverluste machst.“
„Schlechte Laune habe ich doch das ganze Jahr.“ Horst Südermann lachte scheppernd. „Was hast du auf dem Herzen, alter Freund?“
„Hör zu, Häuptling, heute Mittag wurde ein V-Mann namens Manfred Keller in einem Restaurant erschossen ...“
„Hast du deine Finger in der Geschichte drin?“
„Ja.“
„Also eines sage ich dir gleich, ich hau dich da nicht raus, Bernd. Wenn die Kugel, an der Keller gestorben ist, aus deiner Automatik kam, kann ich leider nichts für dich tun.“
„Ich will doch etwas ganz Anderes von dir“, sagte Bernd brummig.
„Und zwar?“
„Vor viereinhalb Jahren hat mir mal einer tödliche Rache geschworen. Ich nehme an, Keller wollte mich vor dem Mann warnen. Von dir möchte ich wissen, ob der Mann schon wieder aus dem Gefängnis raus ist.“
„Das kann ich machen. Wie heißt der Kerl?“
„Simon Feuker.“
„Bist du in deinem Büro?“
„Ich sitze in meinem Wagen“, erwiderte Bernd.
„Bleibst du da noch eine Weile?“
„Voraussichtlich ja.“
„Dann rufe ich dich da an, sobald ich habe, was du wissen willst.“
„Ein Jammer, dass ich mich dafür mit keiner Flasche Cognac revanchieren kann“, sagte Bernd amüsiert.
„Wieso kannst du nicht?“, fragte Südermann enttäuscht.
„Weil du doch nichts mehr trinkst.“
„Wer sagt denn das? Gratis Cognac und Bier sind doch ausgenommen. Und - Bernd, wenn du die Flasche bringst, vergiss auch meine zwanzig Mark nicht!“
„Neunzehn!“, stellte Bernd richtig.
„Wie kann man nur so geizig sein. Also gut. Neunzehn Mark.“
Bernd schob den Hörer in die Halterung, drehte den Startschlüssel herum und ließ die Maschine auf Touren kommen. Instinktiv fuhr er noch einmal zur Firma Fröhlich zurück. Während der Fahrt begann es rasch zu dämmern. Die Straßenbeleuchtung wurde eingeschaltet. Bernd knipste die Beleuchtung des Mercedes an. Wieder zog er seine Lederjacke an, und stülpte sich erneut die Schirmmütze auf den Kopf. Fahrer, Beifahrer und Mechaniker waren schon nach Hause gegangen. Auch im Bürotrakt brannte bis auf eine Ausnahme kein Licht mehr. Dass ausgerechnet das Frachtbüro noch erhellt war, machte Schuster stutzig.
Er stieg die Stufen hoch. Ein Mann war noch da. Er saß an einem Schreibtisch. Die Tür zu seinem Büro stand offen. Er blätterte in einem Wust von Papieren. Manche Mädchen fanden ihn bestimmt interessant. Er hatte graue Schläfen, ein dunkles Menjou-Bärtchen, metallblaue Augen, war groß und schlank. An der offenstehenden Tür stand sein Name: Roger Müller.
Bernd klopfte an die offene Tür. Müller zuckte wie unter einem Stromstoß zusammen. Sein Kopf ruckte hoch. In seinen Augen spiegelten sich die Neonröhren.
„Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe“, sagte Bernd.
„Wer sind Sie?“, fragte Müller ärgerlich. „Was wollen Sie?“
„Hannes Gerber ist mein Name. Ich bin neu hier.“
„So, so.“
„Ich bin LKW-Fahrer.“
„Und was wollen Sie im Frachtbüro?“
Bernd zuckte mit den Schultern. „Ich sah noch Licht.“
Müller nickte und seufzte. „So geht es einem Mann, der eine Abteilung zu leiten hat. Während die anderen längst zu Hause sind, sitze ich hier und ackere noch mal alle Frachtbriefe durch. Schließlich bleibt alles an mir hängen, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt.“
„Warum suchen Sie sich keinen anderen Job, wenn Ihnen dieser so zuwider ist?“
„Es gibt keinen anderen Job für mich, mein Lieber. Ich habe schon alle Jobs durch, die es in dieser Branche gibt. Dieser ist noch der Beste von allen.“
Bernd drehte seine Mütze in den Händen. „Was sagen Sie eigentlich zu dem Pech, von dem die Firma Fröhlich verfolgt ist, Herr Müller?“
Wieder ging ein Ruck durch den Mann. Er hörte zu blättern auf und schaute Bernd durchdringend an. „Warum interessiert Sie meine Meinung, Gerber?“
Bernd hob die Schultern. „Mich interessiert jedermanns Meinung.“
Roger Müller entspannte sich. Er steckte sich eine Zigarette an und lehnte sich zurück. Seine Augen huschten prüfend an Bernd auf und ab. Es schien so, als wollte er Schuster irgendwie einstufen.
„Pech ist genau das richtige Wort, Gerber“, nickte er schließlich. „Wenn drei LKWs von derselben Firma überfallen werden, dann ist das wirklich großes Pech.“
„Meinem Kollegen schlottert vor jeder neuen Fahrt die Hose.“
„Kann ich verstehen“, meinte Müller. Auf seinem Schreibtisch stand ein Bild von einem schwarzhaarigen Mädchen. Es steckte in einem Wechselrahmen. Praktisch für einen Mann, der ziemlich flatterhaft war.
„Meine Kollegen sind der Meinung, dass hier - im Frachtbüro - eine undichte Stelle sein muss“, schoss Bernd nun scharf.
Müller verlor sofort die Lust am Rauchen. Er zerdrückte die Zigarette im Aschenbecher und fragte erregt: „Was sagen Sie da?“
„Ich habe mich heute mit ein paar Firmenangehörigen unterhalten, verstehen Sie? Die Leute sind der Meinung, dass die Gangster, die die LKWs überfielen, von hier einen Tipp bekamen, auf welchen LKW sich der Überfall am meisten lohnt.“
Müller schüttelte energisch den Kopf. „Das ist doch Blödsinn, Gerber.“
„Fest steht, dass die Gangster dreimal den besten Griff getan haben.“
„Das kann Zufall sein.“
„Zweimal ja. Aber dreimal?“
„Das hieße doch, dass einer aus der Frachtabteilung mit diesen Banditen gemeinsame Sache machen würde!“, sagte Müller heiser.
„Ist das denn so abwegig?“, fragte Bernd lauernd.
„Ich würde für jeden meiner Mitarbeiter die Hand ins Feuer legen.“
„Wie viele sind es?“
„Sechs.“
„Und - würden Sie auch für sich selbst die Hand ins Feuer legen, Herr Müller?“, wollte Bernd Schuster geradeheraus wissen.
Dem Leiter der Frachtabteilung stockte für einen Moment der Atem. Er starrte Bernd mit seinen metallicblauen Augen gereizt an und sprang wütend auf. Atemlos vor Zorn kam er um seinen Schreibtisch herum. Bernd blieb gelassen stehen.
„Was sollte das eben heißen, Gerber?“, fauchte Müller gefährlich.
Bernd legte den Kopf schief. „Weibergeschichten, Spielschulden ...“
Müller wollte Bernd die Nase einschlagen. Schuster tauchte unter der Geraden geschickt weg, erhielt einen Schlag gegen die Schulter, konterte mit einer rechten Gestreckten.
„Verflucht, Gerber!“, röchelte Müller wütend.
„Ich mag nicht, wenn jemand darauf aus ist, mir das Nasenbein kaputtzuschlagen!“, gab Bernd eiskalt zurück.
„Sie werden nicht lange bei uns arbeiten, Gerber! Dafür werde ich sorgen!“
„Sie sollten sich lieber überlegen, was ich gesagt habe, Müller. Einer aus der Frachtabteilung ist nach Meinung meiner Kollegen undicht. Wenn Sie es sind, kriegen wir das früher oder später mal raus. Und dann möchte ich nicht in Ihrer verdammten Haut stecken.“
Bernd wandte sich auf den Absätzen um und verließ das Frachtbüro. Als er seinen Mercedes erreichte, blinkte das Telefonlicht.
Horst Südermann war dran. „Simon Feuker ist wieder draußen, Bernd.“
„Womit ich wieder mal ein gutes Näschen bewiesen habe“, erwiderte Bernd Schuster.
„Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?“, fragte Südermann mürrisch.
„Im Moment schon.“
„Wie wär’s mit Dankeschön?“
„Wenn du so großen Wert darauflegst, meinetwegen: Dankeschön.“
„Na also. Dir werde ich auch noch Manieren beibringen!“
„Wie willst du das denn anstellen, wo du doch selber keine hast?“
Es klackte im Hörer. Bernd grinste. Ab und zu tat es ihm ganz gut, dem Freund ein paar Grobheiten zu sagen.
Jetzt stand noch einmal die kleine Pension auf Schusters Programm. Da der Berufsverkehr schon vorüber war, kam er flott voran.
Jetzt war allerdings ein Nachtportier im Einsatz, ein nettes Kerlchen mit lustigen Augen und einem verständnisvollen Lächeln für jedes Problemchen. Seine Eckzähne waren fast so lang wie die des Grafen Dracula.
Bernd sagte dem Mann, dass ihn interessierte, wer im Zimmer 17 gewohnt hatte. Der Kleine schob den Zwanziger in die Hosentasche und blätterte hinterher mit seinen mageren Fingerchen im Empfangsbuch.
„Aha. Hier haben wir’s“, sagte er mit einer dünnen Sängerknabenstimme. „Nummer siebzehn sagten Sie, nicht wahr?“
„Ja“, nickte Schuster.
„Da hat ein Samuel Forster gewohnt. Zwei Freunde von ihm haben die Rechnung bezahlt und sein Gepäck abgeholt.“
Samuel Forster.
S. F. - Simon Feuker! Gab es überhaupt noch einen Zweifel? Bernd bedankte sich bei dem Hilfsbereiten, schwang sich in seinen 450 SEL und rief umgehend den Inspektor an.
„Jetzt kann zur Abwechslung mal ich etwas für dich tun“, meinte Bernd jovial. „Macht sich doch bestimmt recht gut, wenn du mit der linken Hand einen Fall klärst, der dich eigentlich gar nichts angeht.“
„Was für einen Fall denn?“, fragte der Inspektor brummig. Er hasste viele Anrufe, wenn er Nachtdienst schob.
„Du kannst den Mord an Keller klären“, sagte Bernd. „Kellers Mörder heißt Simon Feuker. Und ich kann dir auch gleich seine Anschrift mitliefern ...“ Er nannte die Tankstelle, hinter der das Haus stand. In einen davon hatten die „Freunde“ Feukers das Gepäck gebracht. Horst versprach sofort, dass er der Sache nachgehen würde.
„Ich höre nichts!“, rief Bernd in die Sprechmuschel.
„Was willst du denn noch hören?“
„Ein herzhaftes Dankeschön!“, sagte Schuster grinsend.
„Dankeschön“, scholl es markig aus dem Hörer. Dann lachten die Freunde und legten gleichzeitig auf.
Bernd machte sich auf den Heimweg. Er stellte das Autoradio an und ließ sich von einschmeichelnder Musik berieseln. Rias Berlin sendete Tanzmusik, aber das war für Schuster jetzt in Ordnung.
Es war ein arbeitsreicher Tag gewesen. Mit Tobias Fröhlich und Roger Müller hatte er sich schlagen müssen. Es hatte einen Toten gegeben. Aber zum Glück würde sein Mörder nicht mehr lange frei herumlaufen. Simon Feuker gehörte jetzt schon der Polizei, dafür hatte Bernd mit seinem Anruf gesorgt.
Er steuerte seinen Mercedes in die schmale Parkstraße auf seinen Platz. Da er außer Käse und ein paar Scheiben Wurst nichts im Kühlschrank hatte, weder Tochter Lucy noch Geliebte Franziska auf ihn warteten, fuhr er nicht mit dem Fahrstuhl zur 14. Etage hoch, sondern überquerte die Straße und setzte sich im Patzenhofer an der Ecke an seinen Stammtisch. Cisco der Barkeeper, nickte ihm blinzelnd zu und hieß ihn mit einem freundlichen Grinsen, das aus seinem Pferdegesicht eine lustige Grimasse machte, herzlich willkommen. Cisco hieß eigentlich Karl Eberhard Schulze, aber seine Vorliebe für Country-Musik, dazu sein ständig getragener Cowboy-Hut hatten ihm schon vor langer Zeit den Spitznamen eingebracht.
Zwei Minuten später erschien Elvis, der Besitzer. Und der hieß wirklich so – Elvis, ohne eine Leidenschaft für die Musik des bekannten Rock’n Rolers. In der Mitte des Lokals knallten im offenen Kamin die Buchenscheite. Funken stoben auseinander. Stimmengemurmel darum herum. Es war eine angenehme Atmosphäre bei Elvis.
Der Mann mit der Olivenhaut, der beharrlich über seine wahre Herkunft schwieg, strich sich über den rabenschwarzen Dschingis-Khan-Bart.
„Nett, Sie wieder einmal füttern zu dürfen, Bernd“, sagte der schmale Mann, der sowohl Armenier als auch Türke sein konnte. Vielleicht auch ein ägyptischer Elvis. Niemand wusste das so genau.
„Ich hätte beinahe den Reservereifen meines Wagens gefressen“, erwiderte Bernd schmunzelnd.
Elvis riss begeistert die dunklen Augen auf. „Ah, Sie sind hungrig.“
„Und wie!“
„Das hört man gern.“
„Was können Sie mir empfehlen?“
„Gegrillte Hammelkeulen. Dazu grusinischen Rotwein.“ Und das in einer Original Patzenhofer Eckkneipe. Aber das war nun einmal Berlin.
„Her damit!“, sagte Bernd. Und er wurde prompt bedient. Danach gab’s noch ein kleines Schwätzchen mit Elvis. Es war halb zehn, als Bernd den Heimweg antrat. Er ging über die Straße, stellte sich in den Fahrstuhl und fuhr nach oben.
Diesmal war kein Kassettenrecorder für ihn aufgebaut. Das war gut so, denn neben den beiden Fällen, die Bernd zur Zeit im Auge hatte, hätte er sich keinen dritten mehr aufladen wollen. Und solange Horst Südermann nicht anrief und ihm sagte, dass Feuker geschnappt war, blieb auch der Mord an Manfred Keller noch Bernds Fall.
Er betrat seine Wohnung und machte Licht.
Der Schreck war nicht so groß, dass er deshalb gleich an die Decke sprang, aber die Überraschung war Simon Feuker trotzdem sehr gut gelungen. Er saß an Schusters Esstisch. Sein Grinsen war eingefroren. Und das Ding, das er in seiner Rechten hielt, war unverkennbar eine Beretta mit Schalldämpfer. Damit hatte heute Mittag Manfred Keller schon Bekanntschaft gemacht.
Eine Gänsehaut überlief Bernd.
„So sieht man sich wieder!“, knurrte Feuker mit gefletschten Zähnen.
„Ich hätte keinen Wert darauf gelegt“, gab Bernd zurück.
„Aber ich!“
„Was wollen Sie?“
„Erkennen Sie mich wieder?“
„Natürlich. Sie sind Simon Feuker.“
„Früher trug ich einen Kinnbart.“
„Ich weiß noch sehr gut, wie Sie früher ausgesehen haben. Warum haben Sie Keller erschossen?“
„Er wollte Sie warnen. Das musste ich verhindern. Ich wollte doch nicht, dass er mich um meine Freude bringt. Verdammt, Schuster, Sie haben mich ins Gefängnis gebracht, und ich habe in diesen viereinhalb Jahren an nichts Anderes als an meine Rache gedacht. Jetzt ist es soweit. Ich kann mich für diese verfluchte Zeit revanchieren.“
Bernd schüttelte ärgerlich den Kopf. „Dass ihr dämlichen Verbrecher immer die Schuld bei den anderen suchen müsst. Wer hat denn das Gesetz verletzt? Ich etwa? Sie wurden eingelocht, weil Sie in Hamburg einen Einbruch verübt hatten. Deshalb brachte man sie in die Hansestadt zur Verhandlung. Deshalb sind Sie auch in Santa Fu eingefahren. Wenn Sie so wollen, dann haben Sie sich das Gefängnis durch Ihre eigene Arbeit verdient.“
„Die Bullen hätten mich nicht erwischt, Schuster, das wissen Sie ganz genau. Ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich viereinhalb Jahre meines Lebens hinter Gittern verbringen musste.“
„Das haben Sie sich selbst zu verdanken. Es ist mein Job, Verbrecher dahin zu bringen, wohin sie gehören.“
„Das sollte ausschließlich Sache der Polizei sein. Es sollte kein Dritter mitmischen dürfen.“
„Er tut es aber. Und sogar recht wirksam.“
„Und er tat es heute zum letzten Mal!“, zischte Feuker mit schmalen Augen. Bernd wusste, dass der Ganove nicht bloß hergekommen war, um ihm ein bisschen Angst zu machen. Er hatte Keller kaltblütig ermordet, nur, weil dieser ihn hatte warnen wollen. Der Mord an Keller war nur verübt worden, damit es zu dieser Situation kommen konnte. Folglich würde diese Begegnung mit einem schallgedämpften Schuss enden. Niemand würde den Knall hören. Und Franziska Jahn würde sich morgen früh zu Tode erschrecken, wenn sie Bernd hier auf dem Teppich liegend vorfand.
Die Beretta schwenkte auf Bernd.
Horst Südermann würde fluchen. Er war bestimmt mit Volldampf aus dem Dezernat geprescht, um sich Feuker zu holen, dabei saß Feuker hier, um sich seine Rachegelüste zu erfüllen.
„Viereinhalb Jahre, Schuster“, sagte Feuker verbittert. „Das sind 1642 Tage und ebenso viele Nächte. Sie können sich diese Nächte nicht vorstellen, Schuster. Das sind körperliche Qualen. Man ist umgeben von Gesichtern, die man nicht ausstehen kann. Es sind die Gesichter der Mithäftlinge. Man kann ihnen nicht entgehen. Auf Schritt und Tritt sind sie da. Und dann die Gesichter der Wärter. Hart. Brutal. Abgestumpft. Aber das alles ist noch zu ertragen. Schlimm wird es erst nachts. Da verschwinden die anderen Gesichter, und nur noch eines ist da: Jenes Gesicht, das dem Mann gehört, der einem das eingebrockt hat! In meinem Fall war es Ihr Gesicht, das mich Nacht für Nacht angestarrt hat. Ich habe es im Geist angespuckt und habe ihm 1642 Mal Rache geschworen. Was sind solche Foltern gegen eine schnelle Kugel in den Schädel? Ich bin human im Gegensatz zu Ihnen, Schuster. Jawohl, human ...“
Feukers Züge verkanteten.
‚Jetzt schießt er!‘, dachte Bernd.
Gleichzeitig federte Schuster vorwärts. Er duckte sich. Feuker feuerte. Plopp! Ein greller Mündungsblitz. Die Kugel strich haarscharf an Schusters Kopf vorbei. Bernd hatte seinen Esstisch gepackt und kippte ihn nun blitzartig in Feukers Richtung. Der schwere Tisch fiel dem Mörder auf die Oberschenkel. Feuker kippte mit dem Stuhl zurück und knallte gegen die Wand. Der Tisch donnerte im selben Augenblick zu Boden.
Schon hatte Bernd Schuster seine Automatik in der Faust. Da sprang Feuker mit hassverzerrtem Gesicht auf und schoss wild um sich. Bernd war gezwungen, das Feuer zu erwidern. Sein Schuss krachte ohrenbetäubend laut los. Feuker bekam die Kugel in die linke Schulter. Damit war er jedoch nicht zu stoppen. Er schoss weiter. Erst die nächste Kugel brachte ihn zur Vernunft. Sie drang ihm in die Brust. Sein Mund öffnete sich. Ein unartikulierter Laut drang über seine Lippen, und Blut schoss hinterher. Sein Pistolenarm fiel kraftlos herab. Die Beretta polterte zu Boden. Mit ungläubig geweiteten Augen tappte Feuker auf Bernd zu. Er ähnelte dabei auf merkwürdige Weise einer Marionette.
Und plötzlich wurden die Schnüre dieser Marionette gekappt. Wie vom Blitz getroffen, sackte Feuker zusammen. Der tüchtigste Arzt hätte nichts mehr für ihn tun können.
9
Die Bar war gerammelt voll. Auf einem Podium zog sich eine flachsblonde Frau gekonnt aus. Aus Lautsprechern tropfte die richtige schwüle Musik dazu auf die erhitzten Köpfe der Zuschauer. Am Tresen lungerten die Saufbolde, und in einer bequemen Nische hockte Winfried Schack. Links und rechts ein gut gebautes Mädchen. Hinten und vorn hatten sie Dekolletés, auf denen sie saßen. Schacks grünlich weißes Grottenolmgesicht glänzte vor Vergnügen. Seine schwarzen Ebenholzknopfaugen strahlten. Er war schon lange nicht mehr so guter Laune gewesen. Dazu trugen die beiden Frauen zu einem guten Teil bei.
Als er ans Telefon gerufen wurde, machte er eine grimmige Miene.
„Ausgerechnet jetzt, wo ich mich so köstlich unterhalte!“, maulte er.
„Der Mann sagte, es wäre wichtig, Winfried“, sagte der Barbesitzer.
„Nichts ist wichtiger als ein hübsches Mädchen. Wie wichtig sind dann erst zwei davon!“
Er meckerte zwar, aber er stand trotzdem auf. Wo das Telefon war, wusste er. Schließlich war er hier Stammgast.
„Ich komme gleich wieder, Mädchen“, sagte er zu den beiden.
„Schon gut, Winfried“, antworteten sie.
„Ihr bleibt artig sitzen, klar?“
„Klar, Winfried. Du kommst ja gleich wieder.“
„Das will ich meinen. Und dann machen wir einen drauf, dass sich die Balken biegen!“
Er verschwand in Richtung Telefon. Auf dem Weg dorthin spielte er mit seinem schwarzen Tatarenschnurrbart. Er war ein wenig beschwipst. Die Frauen animierten ihn ununterbrochen zum Trinken. Klar, das war ihr Geschäft, davon lebten sie.
Mürrisch schob Schack seine Massen in die enge Telefonzelle. Der Hörer hing an einem Haken für ihn bereit. Er griff ihn sich und knurrte: „Ja. Hier Schack.“
„Boss!“, kam es aufgeregt durch die Leitung. „Verflucht, Boss ...“
„Mann, fluchen kann ich selbst! Was ist passiert?“
„Bullen waren da, Boss!“, rief einer seiner beiden Leibwächter atemlos.
Bullen! Das war einem Keulenschlag auf den Schädel gleichzusetzen. Der Anruf erzielte denselben Erfolg.
„Bullen? Was wollten sie?“
„Sie wollten Feuker kassieren! Keine Ahnung, wieso sie wussten, dass sie ihn bei uns suchen müssen. Sie tauchten einfach auf. Wir hatten zum Glück noch die Zeit, Feukers Gepäck verschwinden zu lassen. Du liebe Güte, wenn sie die Koffer gefunden hätten, hätte es 'ne Katastrophe gegeben!“
„Weshalb sind die Bullen denn so scharf auf ihn? Was hat Feuker ausgefressen?“
„Einen Spitzel soll er umgelegt haben.“
Winfried Schack kratzte sich verärgert am Schädel. „Wo ist Feuker jetzt?“
„Weiß nicht, Boss.“
„Hm. War keine gute Idee, ihn einzustellen. Ich werde ihn morgen früh wieder hinausschmeißen.“
„Ist das nicht zu gefährlich, Boss?“
„Wieso gefährlich?“
„Er könnte zur Polizei rennen ...“
„Er weiß doch noch so gut wie gar nichts. Nein, nein. Der segelt morgen. Einen Typ, hinter dem die Polizei her ist, können wir nicht gebrauchen.“
––––––––
10
Am nächsten Morgen waren die Spuren von Schusters überstandenem Abenteuer immer noch deutlich zu sehen. Franziska kam mit einem neuen Boutique Hit zur Tür herein.
Sie war in Bernds Wohnung gekommen, um wie gewöhnlich mit ihm vor Arbeitsbeginn zu frühstücken. Als sie die Kreidestriche sah, wusste sie Bescheid. Bernd war gerade dabei, ein wenig Ordnung in seine Wohnung zu bringen.
„Wer war die Person, die hier gelegen hatte, Bernd?“, erkundigte sich Franzi.
Sie trug ihr hellblondes Haar zu einem lustigen Pferdeschwanz zusammengebunden. Er baumelte nervös hin und her, wenn sie den Kopf schnell bewegte.
„Simon Feuker“, sagte Bernd Schuster knapp.
„Was ging heute Nacht hier vor, Bernd?“, fragte die 24 jährige Detektiv-Volontärin neugierig.
„Feuker hat hier am Esstisch ganz gemütlich auf mich gewartet. Er wollte mich erschießen ...“
„Großer Gott!“, stöhnte Franziska und fuhr sich an die Lippen. „Was für ein Glück, dass weder Lucy noch ich anwesend waren!“
„Er hat sein Ziel ja nicht erreicht.“
„Stattdessen hast du ihn ...“
„Notwehr. Ich hatte keine andere Wahl. Hinterher rief ich die Polizei an. Der letzte Polizist ging lange nach Mitternacht nach Hause.“
„Weshalb wollte Feuker dich ...?“
„Ich habe ihm zu viereinhalb Jahren Gefängnis verholfen. Das konnte er mir nicht verzeihen.“
„Manche Menschen nehmen einem aber auch wirklich alles übel, was?“, sagte Franziska sarkastisch. „Heute ist dein erster LKW-Tag, nicht wahr?“
„Ja. Ich muss mich ohnedies schon beeilen.“
„Soll ich die Handwerker kommen lassen, die den Schaden wieder in Ordnung bringen?“
„Ich verlasse mich ganz auf dich, Franzi“, erwiderte Bernd.
Als er wieder ins Wohnzimmer trat, war er ganz auf Trucker getrimmt.
„Wie sehe ich aus?“, fragte er Franziska.
„Für ein Mädchen, das scharf auf Trucker ist - zum Verlieben.“
„Und für andere Mädchen?“
„Du siehst doch immer zum Verlieben aus, Bernd, das weißt du doch!“
Bernd schmunzelte. „Ich wollt’s nur wieder mal aus deinem Mund hören. He!“, rief er plötzlich aus. „Das ist doch nicht etwa schon wieder ein neues Kleid!“
„Doch, das ist es.“
„Bezahle ich das eigentlich alles?“
„Sagen wir so, ich verdien‘s bei dir“, lachte Franziska Jahn. „Kann ich, während du dich auf deinen LKW schwingst, irgendetwas für dich tun?“
Bernd nickte. „Ja, es wäre schön, wenn du inzwischen hier die Stellung hältst. Knut wird vorbeikommen, ich habe ihn informiert.“
„Hoffentlich ist dir bewusst, dass man dabei alt und schäbig wird.“
„Aber doch nicht du, Franzi, niemals!“
Ein rascher Kuss auf den Mund musste für eine Weile reichen. Bernd ließ seinen 450 SEL im Stall stehen. Er winkte ein Taxi heran und nannte dem Fahrer die Adresse von Fröhlichs Firma. Zwanzig Minuten später traf er da ein.
Hans Kersten war schon da. Er war gerade dabei, den LKW durchzuchecken.
„Morgen, Hans.“
„Morgen, Hannes.“
„Alles in Ordnung mit unserem Brummer?“, fragte Bernd.
„Komm gleich mal zur Seite, Kumpel“, sagte Kersten mit brüchiger Stimme. Er schaute sich um und zog Bernd dann hinter einen Betonpfeiler.
„Was ist los? Warum so geheimnisvoll?“. fragte Schuster grinsend.
„Hör zu, Hannes.“
„Schieß los! Was hast du auf dem Herzen, Hans?“
Kersten musterte Schuster gründlich. „Was hast du gestern mit Müller gehabt?“
„Nichts Besonderes. Eine kleine Meinungsverschiedenheit. Warum?“
„Vor einer halben Stunde hat Roger Müller versucht, mächtig Stimmung gegen dich zu machen. Und Tobias Fröhlich hat ihn dabei kräftig unterstützt.“
„Mit welchem Erfolg?“, fragte Bernd.
„Abgeblitzt sind sie. Alle beide!“, kicherte Kersten. „Sie wollten, dass wir alle zum alten Fröhlich gehen und ihn auffordern, er möge dich entlassen. Aber keiner von uns ist rübergegangen. Du hättest sehen sollen, wie die beiden Schaum gespuckt haben. Am liebsten hätten sie sich vor Wut selbst in den Boden gestampft. Sind überall unbeliebt, die beiden Knochen. Kannst dich darauf verlassen, dass es denen niemals gelingen wird, uns gegen dich aufzuwiegeln.“
„Ich kenne die anderen gar nicht“, sagte Bernd beeindruckt.
„Was macht das schon? Ich habe ihnen gesagt, was ich von dir halte, und das zählt mehr, als das, was Roger Müller und Tobias Fröhlich quasseln.“
„Dann habe ich es also dir zu verdanken ...“
„Quatsch!“, winkte Kersten sofort ab. „Was heißt hier verdanken. Wir müssen gegen diese Hurensöhne einfach eine Front bilden. Sonst wachsen sie uns eines Tages über den Kopf, verstehst du?“
Bernd nickte. Kersten überreichte ihm den Frachtbrief.
„Nun wirf mal einen Blick darauf“, verlangte er von Bernd. „Heute sind wir mal wieder mit Kostbarkeiten bis an den Rand beladen.“
Bernd stutzte. „Medizinische Geräte für ein staatliches Forschungsinstitut wo genau?“
„In Dortmund. Und ich wundere mich, dass es eine Adresse ist, wo wir sonst nur abholen.“
„Kann ja ein Umtausch sein. Oder eine Reklamation. Oder...“
„Mhm. Soll ich dir verraten, was der ganze Plunder wert ist, den wir dorthin bringen sollen?“
„Wie viel?“
„110.000 Eier.“
Als Bernd das hörte, rechnete er fest damit, dass dieser Transport überfallen werden würde. Hans Kersten schaute Bernd an und grinste dann.
„Ich weiß, was du jetzt denkst, Hannes. Und ich denke dasselbe. Aber das Eine sage ich dir: Wenn die mit mir dieses verdammte Spiel tatsächlich noch mal spielen sollten, schmeiße ich den ganzen Kram hin, das gebe ich dir schriftlich!“
Bernd ließ seinen besorgten Blick an der Seitenwand des vollbeladenen 22-Tonners entlangstreichen. Medizinische Geräte! Gab es dafür überhaupt einen Abnehmer? Und warum diesmal in umgekehrter Weise? Sonst kamen diese Geräte aus dem Ruhrgebiet nach Berlin. Jetzt ging die Sendung den umgekehrten Weg.
‚Mein Gott‘, dachte Bernd Schuster beunruhigt, ‚was kann auf der Strecke bis Dortmund alles schiefgehen!‘ Er schaute Hans Kersten an. Einen Überfall hatte der gut überstanden. Würde es beim zweiten Mal ebenso glimpflich abgehen? Bernd hoffte es. Und er hoffte trotz der Gefahr, die ein solcher Überfall in sich barg, dass es auf dieser Fahrt nach Dortmund dazu kommen würde, denn dazu hatte er ja schließlich diesen Job hier angenommen. Er wollte nicht bloß das Loch füllen, das Fred Stettners Tod im Personalstand der Firma Fröhlich gerissen hatte.
„Tja, Meister Kersten. Dann wollen wir uns mal den Bock schwingen“, meinte Bernd Schuster und kletterte ins Fahrerhaus.
Lucy Fröhlich stand am Fenster im ersten Stock. Als Bernd zu ihr hinaufschaute, winkte sie ihm mit jedem einzelnen Finger. Dann erschien Tobias Fröhlich mit grimmiger Miene. Grund genug für Bernd, sofort abzufahren.
––––––––
11
Sie nannten ihn Buster. Er war groß und kräftig, hatte das Gesicht von Frankensteins Monster, und ein Mörderherz schlug in seiner breiten Brust. Buster war der Mann, an den Bernd Schuster geraten war, als er sich uneingeladen auf dem Schrottplatz hinter der Autoreparaturwerkstatt befunden hatte. Der Schlag mit der Eisenstange hatte Buster nur vorübergehend geschadet.
Jetzt hatte er seine kärgliche Intelligenz schon wieder halbwegs beisammen. Natürlich hatte er Winfried Schack gleich erzählt, was vorgefallen war, sobald er sich einigermaßen aufrecht fortbewegen konnte, und Schack hatte auch gleich seine beiden bösen Bluthunde losgeschickt, um nach dem ungebetenen Gast zu suchen. Doch nachdem sie ihn nicht mehr finden konnten, schlief die ganze Aufregung rasch wieder ein. Man begnügte sich damit, den Neugierigen verjagt zu haben.
Für Buster war die Sache jedoch noch nicht so ganz abgeschlossen. Er ärgerte sich immer noch darüber, dass er diesmal unterlegen war. Um seinem allgemeinen Unmut ein wenig Luft zu machen, setzte er sich hin und begann aus dem Gedächtnis Schusters Gesicht zu zeichnen. Niemand hätte Buster diese Fertigkeit zugetraut. Er hatte Hände, die so groß wie Toilettendeckel waren. Aber er verstand den Zeichenstift zu führen wie ein zartfühlender Maler. Irgendein Talent hat schließlich jeder Mensch. Selbst dann, wenn er so aussieht wie Frankensteins Kreation.
Mit zwei Skizzen war Buster nicht einverstanden. Unwillig riss er das Blatt ab und warf es in den Papierkorb, der neben Winfried Schacks Schreibtisch stand. Dann begann er von neuem auf dem Zeichenblock Schusters Gesicht zu kritzeln. Nun hatte es bereits mehr Ähnlichkeit mit Bernd, aber es traf immer noch nicht den Kern.
Weder die Leibwächer, noch Winfried Schack beachteten Buster, der stumm und mit einem erstaunlichen Eifer an seiner Zeichnung arbeitete.
„Feuker?“, fragte Schack die beiden.
Synchron zuckten sie mit den Schultern.
„Er ist immer noch nicht aufgekreuzt, Boss.“
„Der fliegt, sobald er den Hintern hier hereinschwingt!“, kündigte Schack an.
Auf seinem Schreibtisch lag die Morgenpost. In großer Aufmachung wurde da von einem Leichenfund berichtet. Schack und seine Männer wussten, dass es sich bei dem noch nicht identifizierten Toten um Dieter Fleck handelte. Aber die Polizei wusste es noch nicht. Die rätselte noch herum, wer es sein könnte.
Buster zeichnete eifrig weiter. Zwischendurch schluckte er geräuschvoll, und sein Adamsapfel hüpfte auf und ab wie ein JoJo an der Kordel.
Das Telefon schlug an. Schack hob ab.
„Ach, Partner!“, rief er. „Zeit, dass ich wieder was von Ihnen höre. Ich denke, wir sollten uns eingehend über unser Geschäft unterhalten.“
„Der LKW ist abgefahren“, sagte der Anrufer.
„Na fein“, erwiderte Schack.
„Fahrer Hannes Gerber. Beifahrer Hans Kersten.“
„Ich muss Ihnen noch was sagen.“ Schack zögerte und kratzte sich am Kopf. „Gestern Nacht waren die Bullen hier. Sie haben einen Mann gesucht, zum Glück aber nicht gefunden.“
„Wer ist der Mann?“
„Ein Neuer, ich habe ihn gestern erst eingestellt.“
„Sie haben einen Mann eingestellt, der von der Polizei gesucht wird?“, fragte der Anrufer aufgeregt.
„Konnte ich das wissen?“, gab Schack aggressiv zurück. „Außerdem hat hier ein Kerl herumgeschnüffelt. Ich glaube, wir lassen den LKW lieber ungeschoren und warten, bis sich die Wogen ein bisschen geglättet haben.“
„Sind Sie wahnsinnig?“, schrie der Anrufer. „Der LKW ist schon unterwegs. Eine solche Gelegenheit kriegen wir nie wieder. Schicken Sie Ihre Leute sofort los!“
„Okay“, sagte Schack. „Wir ziehen die Sache genauso durch, wie wir sie besprochen haben.“
„Der Zeitplan ist haargenau von Ihren Leuten einzuhalten. Aber nicht wieder auf dem Transit, verstanden? Ich will keinen Ärger mit der verdammten Volkspolizei oder den Behörden der DDR! Und Sie, Schack, kommen zu mir ins Lagerhaus. Es gibt einiges zu besprechen.“
Winfried Schack hob die Schultern und meinte: „Meinetwegen.“ Dann legte er auf. Er schaute seine Leibwächter an.
„Wie steht's?“, fragte einer der beiden.
„Wir gehen an die Arbeit“, sagte Schack. „Ihr wisst, was ihr zu tun habt.“
„’türlich, Boss“, sagte der andere und nickte eifrig. Sie verließen Schacks Büro. Buster kritzelte immer noch. Schack warf einen ungewollten Blick auf die Zeichnung.
„Was soll denn das werden, wenn‘s fertig ist, Buster?“, fragte er amüsiert. „Sieht mir doch überhaupt nicht ähnlich.“
„Das sollen auch nicht Sie werden, Boss.“
„Wer denn?“
„So ungefähr hat der Kerl ausgesehen, von dem ich Ihnen gestern erzählt habe. Er hat sich auf dem Schrottplatz herumgetrieben und hat mich mit einer Eisenstange niedergeschlagen.“
„Ach der. Lass mal sehen, Buster!“ Buster drehte die Skizze so, dass Schack sie gut sehen konnte. Winfried Schacks Augen weiteten sich erstaunt „Mann, das ist ja ...“
„Kennen Sie den Kerl etwa?“, fragte Buster überrascht.
Schack nickte eifrig. „Und ob ich den kenne. Ich habe erst gestern ein Foto von ihm gesehen. Weißt du, wer das ist, Buster?“
„Nee.“
„Das ist ein Schnüffler namens Bernd Schuster. Simon Feuker, unser neues Sorgenkind, hat die Absicht, ihm das Lebenslicht auszupusten.“ Schack kniff die Augen zusammen. „Er kam hierher, weil er sich für Feuker interessiert. Und als du ihn zu verdreschen wolltest, ist er abgehauen, um uns die Polypen zu schicken. Schuster haben wir es also zu verdanken, dass die Bullen gestern Nacht hier aufgekreuzt sind.“ Schack knirschte zornig mit den Zähnen. Er erhob sich und nahm Buster die Skizze aus der Hand.
„Ich kann sie doch haben, oder?“, fragte er.
„Klar, Boss. Natürlich. Wozu brauchen Sie sie?“
„Weiß nicht. Jedenfalls möchte ich sie haben.“
„Sie können sie gern behalten“, nickte Buster, und wieder fuhr sein faustgroßer Adamsapfel auf und ab.
Schack führte noch zwei Telefonate, die er für wichtig hielt. Dann schickte er Buster hinaus. Der dritte Anruf war privater Natur und galt einer Frau, deren Figur es Schack angetan hatte. Das Gespräch dauerte eine Viertelstunde. Gesprochen wurde nur albernes Zeug. Ein Rendezvous wurde vereinbart. Dann setzte sich Schack in seinen alten Volkswagen und fuhr weg. Der Wagen passte so gar nicht zu einem großen Mann, für den sich Schack hielt. Aber als Tarnung war er ausgezeichnet. Nicht jeder musste ja sofort sehen, wer hier unterwegs war. Deshalb verzichtete er gern auf eines seiner teuren Fahrzeuge, wenn es um heikle Treffen ging.
Schließlich erreichte er das Lagerhaus, von dem Schacks Partner gesprochen hatte. Sobald der Gangsterboss das Gebäude erreicht hatte, tupfte er aufs Bremspedal. Der Volkswagen stand.
Es war ein sonniger, aber kühler Tag. Das Lagerhaus, in dem alles das aufbewahrt wurde, was an den Ganoven bei den drei LKW-Überfällen in die Hände gefallen war, war kein Neubau, sondern eine alte Hütte, die wohl nicht mehr viele Jahre hier stehen würde. Schacks Partner hatte sie vor einiger Zeit gemietet, hatte sie ruhen lassen, hatte sich nicht darum gekümmert. Es wurde erst auf den Schuppen zurückgegriffen, als es mit den Überfällen losging.
Schack schaute sich kurz um. Alles schien in Butter zu sein. Ein Blick auf seine Digitaluhr. Er hatte den Zeitplan genau im Kopf, und wusste, dass sich seine Männer strikt daran halten würden. Deshalb wusste er auch genau, was im Moment lief.
‚Hoffentlich trügt mich mein Instinkt‘, dachte er und trat auf eine mächtige Schiebetür zu. Er riss sie zur Seite und trat in die Halle. Drinnen brannte Licht, obwohl durch geputzte Fenster ohnedies die Sonne herein lachte. Ein Mann mit einem mageren Fuchsgesicht schien plötzlich aus der Wand zu wachsen. Er hatte eine Nagan - eine sowjetische Armeepistole, auf die er mächtig stolz war - in der Faust.
„Tag, Charly“, sagte Schack.
„Hallo, Schack“, sagte das Fuchsgesicht.
„Ist er schon da?“
„Er erwartet Sie bereits mit Ungeduld.“
„Er ist nervös, weil es diesmal gleich um 110.000 geht“, schmunzelte Winfried Schack.
Ein Lkw stand in der Halle. Links und rechts davon war das Diebesgut von drei Überfällen aufgestapelt. Schack schüttelte mürrisch den Kopf, während er die Beuteberge musterte. Dafür hat er immer noch keinen Abnehmer gefunden, dachte er. Oder will er wirklich bloß warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist?
Ein Scheusal tauchte zwischen zwei Kistenstapeln auf. Sein Gesicht war tief zerfurcht. Er hatte einen Buckel und hörte auf den klangvollen Namen Bodo. Das linke Auge funktionierte nicht so recht. Es machte, was es wollte, drehte sich im Kreis, oder das Lid fiel herab, als wäre es aus Blei.
„Ah, Mr. Schack“, sagte der Bursche und entspannte sich. Er lächelte auch, aber dabei lief es sogar Schack eiskalt über den Rücken. Auf seinem weiteren Weg begegnete Schack noch vier Männer, denen es oblag, die Ware zu bewachen.
Dann stand er vor einer Glastür, die in ein Büro führte. Am Schreibtisch saß Schacks Partner. Der Gangsterboss klopfte ans Glas und grinste hinein. Der Mann zuckte nervös herum. Eine Menge Zigarettenstummel lagen bereits im Aschenbecher. Dicke bläuliche Rauchwolken standen in dem von Glas umfangenen Raum. Der Mann winkte Schack aufgeregt herein.
„Na, Partner!“, sagte Schack, während er dem anderen die Hand auf die Schulter legte.
Ein unsicheres Augenflackern begegnete ihm.
„Sie haben doch Ihren Männern genau eingeschärft, was sie tun müssen, Schack.“
„Klar habe ich das getan, Partner. Ich verstehe Ihre Nervosität nicht. Auf meine Männer kann man sich verlassen.“
„Dann ist es ja gut.“
Schack setzte sich auf die Schreibtischkante. Dazu war es nötig, dass er zuvor den Telefonapparat ein wenig zur Seite schob. Nun holte er sein Zigarettenetui heraus und genehmigte sich eine Eckstein. Schlechter konnte die Luft hier drinnen davon auch nicht mehr werden.
Während er die Streichhölzer suchte, fanden seine Finger zuerst die Skizze, die Buster von Schuster angefertigt hatte.
„Ich habe Ihnen doch von dem Kerl erzählt, der bei uns herumgeschnüffelt hat, Partner.“
Der andere hob nervös den Blick. „Ja. Und?“
„Es handelt sich tatsächlich um einen Schnüffler.“
„Sie meinen einen Privatdetektiv?“
„So kann man diese Brut auch nennen.“
Schack legte die Skizze vor den Mann hin. Der holte erschrocken Luft und zuckte zurück, als läge auf der Skizze eine schwarze Mamba.
„So sieht der Knabe aus“, sagte Schack.
„Wer ist das?“, fragte der andere heiser.
„Bernd Schuster. Privatdetektiv.“
„Großer Gott!“
„Was ist? Was haben Sie? Kennen Sie den Vogel etwa, Partner?“
Der Mann nickte heftig. „Er nennt sich Hannes Gerber und sitzt in dem LKW, den Ihre Männer überfallen sollen!“ Schacks Partner schnellte bestürzt hoch. „Abblasen!“, schrie er nervös. „Wir müssen die ganze Aktion sofort abblasen!“
Da zuckte Schack gelassen mit den Schultern und meinte: „Dazu ist es jetzt leider schon zu spät. Ich habe keine Möglichkeit mehr, meine Männer zurückzupfeifen.“
––––––––
12
Sobald sie Dreilinden passiert hatten und auf der Transitstrecke waren, fand Bernd es nicht mehr fair, den Beifahrer zu belügen. Er sagte: „Hör zu, Hans, ich denke, ich sollte dir reinen Wein einschenken ...“
Kersten wandte sich ihm zu und schaute ihn mit lächelnden Augen an.
„Nun komm mir bloß nicht damit, du würdest mit den Gangstern unter einer Decke stecken, Hannes.“
„Ich bin nicht Hannes.“
„Ach. Auf einmal nicht mehr?“
„Ich war es nie.“
„Aber du hast doch Papiere ...“
„Gefälscht“, sagte Bernd ehrlich.
„Weshalb denn das?“
„Damit Carsten Fröhlich mich als Fahrer aufnimmt.“
Kersten wurde von einer Straßenwelle hochgeschaukelt. Als er wieder herunterkam, kniff er die Augen neugierig zusammen.
„Fahr fort mit deiner Beichte! Du heißt also nicht Hannes Gerber, bist auch kein LKW-Fahrer. Du kannst das zwar, aber du übst diesen Beruf nicht ständig aus.“
„Richtig, Hans. Mein Name ist Bernd Schuster. Ich bin Privatdetektiv und will die Frachthaie schnappen.“
„Du allein?“, fragte Kersten erstaunt.
Bernd grinste. „Wenn du willst, kannst du mir dabei ja helfen.“
„Ich bin doch bloß ein dämlicher kleiner Beifahrer.“
„In Notsituationen wachsen die Menschen über sich hinaus. Noch nie davon gehört?“
Hans Kersten schüttelte verblüfft den Kopf. Er lachte und schlug sich auf die Schenkel.
„Weißt du, dass du deine Rolle überzeugend echt spielst, Bernd? Keine Sekunde hätte ich daran gezweifelt, dass du’n LKW-Fahrer bist. Jetzt ist mir klar, weshalb Tobias Fröhlich und Roger Müller dich nicht mögen. Die wittern instinktiv, dass du’n Spannemann bist.“
Bernd holte seine Reserve-Automatik aus der Lederweste und reichte sie dem Beifahrer.
Kersten starrte die Pistole mit großen Augen an. „Was soll ich damit?“
„Keine Angst, die schießt nur, wenn du’s willst“, sagte Bernd schmunzelnd.
„Du erwartest, dass wir überfallen werden, nicht wahr?“
Bernd nickte. „Und da ist es besser, wenn du dich verteidigen kannst“
„Und du?“
„Ich habe natürlich auch so ein Ding.“
„Aber die anderen hatten beim letzten Mal so automatische Teufelsdinger, Bernd. Kenne mich ja nicht aus, aber ich denke mal, das waren Maschinenpistolen.“
„Dann müssen wir eben schneller schießen als sie.“
Hans Kersten wog die Waffe in der Hand. Er strich mit dem Zeigefinger am Lauf entlang, während er nervös die Zunge über seine trockenen Lippen huschen ließ. Er spürte, wie er zu schwitzen anfing. Noch einmal spulte sich der Film des ersten Überfalls vor seinem geistigen Auge ab. Sollte sich das alles tatsächlich wiederholen?
„Wer hat dich engagiert, Bernd?“, fragte Kersten mit belegter Stimme.
„Die Berliner LKW-Versicherung.“
„Die für den Schaden aufkommen muss?“
„Genau die.“
„Und wie viel kriegst du für diesen heißen Job?“
„Zehn Prozent vom Wert der wiederbeschafften Beute.“
„Lohnt sich das denn? Ich meine, du riskierst doch Kopf und Kragen dabei.“
Bernd schaltete in den nächsthöheren Gang, als sich die Straße etwas nach unten neigte.
„Ich riskiere bloß meinen Kragen“, sagte er. „Mein Kopf ist mir zu wertvoll.“
Kersten legte die Waffe in seinen Schoß und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Ich habe Fred Stettner sterben gesehen“, sagte er heiser. „Er tanzte regelrecht im Kugelhagel, Bernd. Es war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe.“
„Es wird sich nicht wiederholen“, sagte Bernd optimistisch. „Wir müssen nur Augen und Ohren offenhalten. Vielleicht mache ich dir auch ganz umsonst Angst. Wir wissen nicht, ob wir überfallen werden oder nicht.“
„Aber du befürchtest es.“
„Weil wir medizinische Geräte im Wert von 110.000 Mark geladen haben.“
Kersten presste die Kiefer zusammen und nickte. Durch die Zähne sagte er zischend: „Dann wird es wohl gut sein, wenn wir uns jede Umleitung haargenau ansehen.“
Bernd hob die Schultern. „Ich glaube nicht, dass sie es wieder damit versuchen werden. Nicht auf der Transitstrecke. Wer legt sich schon gern mit den Behörden in der DDR an? Wen die sich schnappen, kann sich gratulieren. Nein, wenn sie uns überfallen, dann lassen sie sich unter Garantie etwas Neues einfallen.“
Kersten blies nervös seine Backen auf und wiegte den Kopf.
„Na, denn Prost Mahlzeit!“
––––––––
13
Die Gangster kamen per Hubschrauber. Winfried Schack hatte ihnen gesagt, wo sie einen stehlen konnten. Es hatte dabei keine Schwierigkeiten gegeben. Flappernd flog der Helikopter über die Straße dahin. Die Sonne blitzte auf der Kanzel. Soeben wurde die Tür aufgerissen. Ein schmaler Bursche erschien. Er trug einen silbernen Overall. Ein Gurt lag um seinen Leib. Mit einem Haken hängte er sich an das dünne Seil der Winde. Der Pilot kümmerte sich nicht um ihn. Es war Fred, der ihn fragte: „Alles okay, Seiler?“
„Ja!“, schrie Seiler zurück.
„Ballermann?“
„Habe ich.“
„Ich will ihn sehen!“, verlangte Fred.
René riss den Overallverschluss auf und ließ Fred einen Blick auf die Luger werfen. Jetzt nickte Fred zufrieden, und René zog den Reißverschluss wieder nach oben. Unter ihnen brummte der 22-Tonner über die Landstraße. Sie hatten Hannover passiert und fuhren in Richtung Bielefeld-Dortmund. Es herrschte nur wenig Verkehr. Einen günstigeren Zeitpunkt als diesen gab es für den Überfall nicht.
„Du weißt, was du zu tun hast!“, schrie Fred in den Motorenlärm hinein.
„Klar“, nickte René. „Ich dirigiere den Wagen dorthin, wo die anderen auf ihn warten.“
„Na, dann! Hals und Beinbruch!“
„Wird schon schiefgehen!“, rief René und schwang sich aus dem Hubschrauber. Fred bediente sofort die Winde. René Seiler, der Mann mit dem passenden Nachnamen für diesen Job, sank schnell auf den LKW nieder. Als seine Beine das Dach berührten, klinkte er sich von der Leine. Er zeigte Fred beide Daumen. Der holte die Leine sofort wieder ein. Er schlug dem Piloten kurz auf die Schulter, und der Hubschrauber gewann bereits in der nächsten Sekunde merklich an Höhe. Unten agierte inzwischen René. Er war mal eine Zeitlang bei den Fallschirmspringern gewesen. Aktionen wie diese zauberte er im Schlaf hin.
Auf allen vieren kroch er über das Dach des LKW. Der Fahrtwind zerzauste sein dunkles volles Haar. Er kam schnell voran. Bald hatte er das Fahrergehäuse erreicht. Was nun kam, erforderte ein wenig Akrobatik, aber René hatte es an die hundert Mal geübt. Er war zuversichtlich, dass die Sache klappen würde. Oben flog der Hubschrauber als Beobachtungsposten mit.
Die Männer in der Fahrerkabine waren ahnungslos.
Hans Kersten und Bernd Schuster warfen immer wieder prüfende Blicke in den Rückspiegel. Ein Kombiwagen setzte zum Überholen an und zog mit hoher Geschwindigkeit vorbei. Dann kam ein Porsche Targa angefegt, als gelte es, irgendwelche Radaranlagen zu unterfliegen. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn war ein wenig mehr los. Da steuerten Möbelwagen und Tankfahrzeuge in Richtung Osten.
René Seiler zog seinen Overallreißverschluss auf und holte die Luger heraus. Er entsicherte die Waffe, krallte sich mit der Linken an einer Stange fest und schob sich langsam über den Rand des Daches hinaus. Er kam von oben und machte einen Kopfstand. Er rechnete damit, dass sein Erscheinen den Fahrer zu Tode erschrecken würde. Wenn der Fahrer dann auch noch die Luger sah, würde er an keinen Widerstand mehr denken und genau das tun, was von ihm verlangt wurde.
Bernd sah den Typ aus den Augenwinkeln. Natürlich erschrak er, schließlich war er nicht aus Blech. Aber er erschrak nicht so sehr, wie René das gern gehabt hätte.
Hans Kersten sah den roten Kopf ebenfalls. Seine Augen weiteten sich in grenzenlosem Schrecken.
„Bernd!,“ brüllte er verstört auf.
René schob die Luger zum Fenster herein. Bevor er sie Schuster aber ans Ohr setzen konnte, trat dieser blitzartig aufs Bremspedal. Die Wirkung war enorm. Renés Körper schien plötzlich das Zehnfache zu wiegen. Er vermochte sich mit der Linken nicht mehr festzuhalten, rutschte ab, flog vom Dach und knallte auf die Straße.
In der nächsten Sekunde stand der LKW. Bernd federte mit gezogener Pistole aus dem Fahrergehäuse. René hatte eine Platzwunde am Kopf. Das Blut lief ihm über das Gesicht. Der Aufprall hatte seinen Sinnen geschadet. Mühsam kam er auf die Beine. Er wankte und torkelte auf Bernd zu. Als er die Luger hochreißen wollte, die er trotz des schweren Sturzes nicht losgelassen hatte, schlug ihm Bernd Schuster die Waffe mit der Handkante weg. Dann schleppte Bernd den Mann zum Straßenrand. Bleich kroch Hans Kersten aus dem LKW. Mit unsicheren Schritten ging er auf Bernd zu.
„Sag mal, wie kommt der denn auf unser Dach?“, fragte er verdattert.
Bernd hob den Kopf. Er vernahm das ferne Knattern eines Hubschraubers und machte sich seinen Reim darauf.
René ging es nicht gut. Er schien eine Gehirnerschütterung abbekommen zu haben.
„Sie haben dich vom Hubschrauber aus abgesetzt, nicht wahr?“, zischte Bernd den Mann an.
René starrte ihn mit schmerzverzerrtem Gesicht geistesabwesend an. Immer mehr Blut quoll aus der Platzwunde. Die Verletzung sah schlimmer aus, als sie war. Renés Knie knickten ein. Bernd ließ ihn langsam zu Boden gleiten. Da hockte der Gangster nun und mühte sich ab, wieder einigermaßen klarzukommen.
„Für wen arbeitest du?“, fragte Bernd schneidend. „Wer ist euer Boss?“
René reagierte nicht.
Bernd tastete ihn ab. Er fand ein Springmesser und einen kleinen Browning im Wadenholster.
„Wie heißt du?“, wollte Bernd wissen.
„René“, gurgelte der Verbrecher. „René Seiler.“
„Was war dein Auftrag?“
„LKW stoppen.“
„Wo wären wir ausgeschaltet worden?“
„Zwei Kilometer von hier.“
„Dort hätten deine Komplizen auf uns gewartet?“
„Ja.“
„Bernd!“, schrie Hans Kersten plötzlich mit einer Stimme, die sich nach oben hin überschlug. Er hatte den Arm gehoben und wies zum Himmel. Da kam der Helikopter angeknattert. Wie ein mörderisches Rieseninsekt schwirrte er mit großer Geschwindigkeit heran. Bernd erkannte die Gefahr sofort. Aus dem Hubschrauber hing ein Mann heraus. Er war mit einem Gurt gesichert, damit er nicht aus der Maschine fiel. Und vor dem Bauch hatte er eine Maschinenpistole gestemmt.
„Unter den LKW!“, rief Schuster dem Beifahrer zu. „Schnell, Hans!“
Kersten hechtete unter den Laster, als die MPi oben am Himmel zu bellen anfing. Bernd packte René. Er wollte ihn ebenfalls in Deckung zerren. Da rasten die Einschüsse haargenau auf Renés Bauch zu. Sie hämmerten über den Leib des Gangsters hinweg. René zuckte zusammen und stieß einen heulenden Schrei aus.
Das hämmernde Stakkato hörte auf. Der Hubschrauber tanzte in der Luft herum und setzte zum zweiten Angriff an.
„Schnell, Hans!“, keuchte Bernd Schuster. „Hilf mir!“
Zu zweit zerrten sie René unter den LKW.
„Und jetzt Feuer frei auf die Libelle!“, schrie Bernd. Der Hubschrauber fegte heran. Die Maschinenpistole in Freds Händen spie erneut ihr Verderben herunter. Hans Kersten und Bernd Schuster erwiderten das Feuer mit ihren Pistolen. Zwei Kugeln durchschlugen die Glaskuppel. Sie trafen beide den Piloten. Der Hubschrauber begann sofort wild zu trudeln. Der angeschossene Pilot riss die Maschine verzweifelt hoch. Fred wurde trotz des Gurts, an dem er hing, hin und her geworfen.
„Bist du verrückt geworden?“, brüllte er mit wutverzerrtem Gesicht. „Was ist denn los mit dir?“ Dann sah er es. Der Pilot sackte blutüberströmt zur Seite. Der Helikopter fiel wie ein Stein vom Himmel. Mit dem Aufschlag gab es eine gewaltige Explosion, deren Druckwelle Bernd und Hans deutlich spürten. Eine rußgetupfte Flammensäule schoss steil nach oben. Die Hubschrauberbesatzung hatte keinerlei Hilfe mehr nötig.
„Bernd!“, presste Kersten mühsam hervor.
„Ja, Hans?“
„Der Mann hier stirbt.“
Autos blieben am Straßenrand stehen. Leute kamen gelaufen. Einige rannten zum brennenden Hubschrauberwrack, in der Meinung, noch helfen zu können. Andere kamen zu Kersten und Schuster. Im Nu waren sie von einer murmelnden, gaffenden Menschentraube umringt. Bernd verlangte, dass jemand Krankenwagen und Polizei rufen solle. Irgendjemand lief zur nächsten Notrufsäule. Schuster kümmerte sich um den sterbenden Gangster. Und er erfuhr von René Seiler alles, was er wissen musste ...
––––––––
14
Sechs Schritte. Mehr konnte Winfried Schacks Partner in dem kleinen Büro nicht machen, dann war er bei der gegenüberliegenden Glaswand, an der er sich fast die Nase plattdrückte. Aber sechs Schritte hin und zurück und hin und zurück - dabei kommen auch etliche Kilometer zusammen.
„Ich war von Anfang an dagegen, dass wir diesmal aktiv werden, Partner“, sagte Schack achselzuckend.
„Ja. Verdammt, ja. Ich konnte doch nicht wissen, dass sich ein Schnüffler einschleicht.“
„Wenn Sie auf mich gehört hätten, brauchten Sie jetzt nicht wie ein gereizter Löwe auf und ab zu rennen.“
„Sie verkennen anscheinend die Positionen, Schack. Ich habe mich mit Ihnen zusammengetan, weil ich einen Handlanger brauchte. Das heißt, dass nicht ich auf Sie zu hören habe, sondern dass Sie meine Anweisungen und Empfehlungen zu befolgen haben!“
Schack winkte gleichmütig ab. „Wir wollen uns deshalb jetzt nicht streiten. Fest steht jedenfalls, dass ich besser als Sie Bescheid weiß, wann eine Sache stinkt. Aber ich kann Sie beruhigen. Dieser Schuster kocht schließlich auch bloß mit Wasser. Also werden meine Männer mit ihm fertig werden.“
Der andere starrte das Telefon ungeduldig an.
„Weshalb rufen sie nicht an? Es war doch abgemacht, dass sie sich mit uns sofort in Verbindung setzen sollen, wenn der Coup beendet ist.“
„Er wird eben noch nicht beendet sein“, sagte Schack.
„Nach dem Zeitplan, den wir beide erstellt haben ...“
„Es kann unvorhergesehene Komplikationen gegeben haben.“
„Die uns alle ins Unglück stürzen!“, stöhnte Schacks Partner. Obwohl er noch eine Zigarette zwischen den Lippen klemmen hatte, fingerte er schon die nächste aus der Packung.
„Jetzt schwarz zu malen, hat wenig Sinn“, meinte Winfried Schack und spielte ruhig mit seinen herabhängenden Bartenden. „Wir können nur warten und hoffen, dass alles gut geht.“
„Ich werde nach Hause fahren“, sagte Schacks Partner aufgewühlt.
„Denken Sie, dass Sie zu Hause leichter mit Ihrer bohrenden Angst fertig werden?“, fragte der Gangster mit einem schiefen Grinsen. „Ich glaube, zu Hause, wenn Sie allein sind, wird es Sie noch schlimmer packen.“
„Ich kann Ihre Gesellschaft schon nicht mehr ertragen.“
„Aber Partner. Sie haben mich doch selbst hierhergebeten.“
Der andere riss sich den Hemdkragen auf. „Ich brauche Luft zum Atmen. Ich ersticke hier drinnen.“
„Ich schlage vor, wir warten noch fünfzehn Minuten“, sagte Schack. Er wies auf das Telefon. „Wenn sich bis dahin immer noch keiner gemeldet hat, fahren wir heim und packen unsere Koffer, denn dann ging die Sache in die Hose.“
Fünf Minuten vergingen. Wieder machte Schacks Partner seine sechs Schritte hin und zurück und hin und zurück. Zehn Minuten vergingen. Natürlich war auch Schack nervös. Seine Nerven vibrierten unter der dampfenden Haut. Aber er war stolz darauf, dass er sich besser in der Gewalt hatte als der andere. Wenn er sich unbeobachtet fühlte, biss er sich in die Unterlippe. Immer wieder schaute er auf seine Armbanduhr, durch die die Zeit viel zu schnell tropfte. Er schloss die Augen und holte tief Luft. ‚Warum ruft denn keiner an?‘, dachte er. ‚Warum beendet denn keiner diese Folter?‘
Das Ende der Folter kam, als die fünfzehnte Minute um war.
Die beiden Männer hatten Klarheit haben wollen. Nun hatten sie sie. Aber gerade diese Art von Klarheit hatten sie gefürchtet.
Eine gewaltig hallende Megaphonstimme plärrte dem Lagerhaus entgegen: „Hier spricht die Polizei!“
Schack hob senkrecht von seinem Stuhl ab. Sein Partner glotzte ihn ungläubig an.
„Polizei?“, presste er verdattert hervor.
„Polizei“, sagte Schack mit zuckenden Backenmuskeln.
„Hier spricht die Polizei!“, dröhnte die Megaphonstimme wie der Ruf des Herrn am Jüngsten Tag durch das Lagerhaus.
„Bullen!“, schrien die Männer, die sich hier aufhielten.
„Polizei!“
„Das Lagerhaus ist umstellt!“, rief die gewaltige Megaphonstimme. „Jeder Widerstand ist sinnlos. Kommen Sie unbewaffnet und mit erhobenen Händen heraus! Ich wiederhole: Jeder Widerstand ist sinnlos. Kommen Sie unbewaffnet und mit erhobenen Händen heraus!“
„Was nun?“, fragte Schacks Partner hysterisch.
Der Gangster grinste eiskalt. „Jetzt sind Sie mit Ihrem Latein am Ende, was? Wer hat denn zuvor die große Lippe riskiert - von wegen befehlen und gehorchen. Jetzt wären Sie froh, wenn ich Ihnen einen Befehl gäbe, der Sie unbeschadet hier herausbringt, habe ich recht, Partner?“
„Ja. Ja, verflucht noch mal, ja! Sagen Sie, was wir tun sollen, Schack. Sagen Sie es schnell! Wie kommen wir von hier weg? Ich will mich nicht ergeben. Das ist keine Lösung für mich.“
Schack zuckte mit den Schultern.
„Dann können wir es nur auf eine Kraftprobe ankommen lassen.“
„Mit der Polizei?“, fragte der andere schrill.
„Wissen Sie eine bessere Lösung?“
„Wir könnten versuchen, mit dem Lkw den Polizeiring zu durchbrechen!“
Schack schüttelte den Kopf. „Das gelingt nicht. Die Bullen würden uns den Wagen unter dem Hintern kaputtschießen.“
„Wir können doch nicht gegen die Polizei einen regelrechten Krieg anfangen!“, schrie Schacks Partner verzweifelt. „Das ist doch Wahnsinn.“
„Wir sind nicht die Ersten, die sich den Weg in die Freiheit freischießen, Partner.“
„Was ist, wenn wir es nicht schaffen?“
„Sagen Sie mal, wollen Sie mit mir diskutieren, oder sollen wir endlich handeln?“, schnauzte Schack seinen Partner zornig an. Die anderen Männer warteten auf Schacks Kommando. Jetzt war nur noch Schack der Boss. Was er befahl, geschah. Der andere hatte nichts mehr zu melden.
„Wollt ihr in den Knast gehen, Jungs?“, fragte der Gangster die Männer, die sich um ihn scharten.
„Nein“, knurrten sie.
„Dann setzt euch zur Wehr! Wie viele Bullen sind draußen?“
„Dreißig“, sagte Bodo.
„Das ist harte Arbeit, Freunde. Aber wir können es schaffen.“
„Sie werden Verstärkung anfordern!“, rief Schacks Partner im Hintergrund.
Der Gangster fuhr wütend herum. Seine schwarzen Augen funkelten leidenschaftlich.
„Verdammt noch mal, wir brauchen keinen, der nörgelt. Wir wissen selbst, wie beschissen unsere Lage ist, aber wir haben wenigstens den Mumm, das Beste für uns aus der Sache herauszuholen. Wenn Sie mitziehen wollen, okay. Wenn nicht, dann lassen Sie es eben bleiben!“
Waffen wurden ausgegeben. Schack griff sich eine UZI. Sein Partner bekam dasselbe Modell in die Hand gedrückt.
Draußen dröhnte die Megaphonstimme: „Wir geben euch drei Minuten Zeit! Wenn ihr bis dahin nicht herauskommt, holen wir euch!“
„Ja!“, grinste Winfried Schack mit gefletschten Zähnen. „Tut das nur. Ihr werdet Augen machen, womit wir euch empfangen!“
––––––––
15
Horst Südermann setzte das Megaphon ab. Neben ihm stand sein schlaksiger Stellvertreter Wilhelm Krone. Und neben Krone stand Bernd Schuster. Die Streifenwagen hatten so Aufstellung genommen, dass sich die Beamten dahinter verbergen konnten. Eine drückende Stille herrschte über dem hermetisch abgeriegelten Gelände. Der gewichtige Inspektor blickte mit hartem Gesicht auf seine Armbanduhr.
„Die drei Minuten Frist hättest du dir schenken können, Horst“, sagte Bernd.
„Du kennst die Vorschriften, Bernd.“
„Zwei Minuten noch“, sagte Wilhelm Krone. Auch er schaute auf seine Armbanduhr. Aufgeregt fuhr er sich über die mit Legionen von Sommersprossen besetzte Nase. „Eine Minute ...“
„Gasgranaten herrichten!“, befahl Horst mit ernster Miene. „Wir werden das Lagerhaus mit Tränengas vollpumpen, dass die Burschen heulend in unsere Arme fliegen.“
Krone gab den Befehl weiter. Die letzte Minute verging. Südermann setzte sein Megaphon wieder vor den Mund.
„Okay. Ihr hattet eure Chance. Nun holen wir euch!“
Auf ein Zeichen von Südermann begannen die Polizisten ihre Tränengasgranaten durch die Fenster in das Lagerhaus zu schießen. Glas klirrte. Dicke, grünlich weiße Nebelschwaden krochen aus dem Gebäude. Flüche wurden laut. Und dann begannen die Gangster wie verrückt zu schießen. Ihre Kugeln zerfetzten Windschutzscheiben von Streifenwagen.
„Noch mehr Tränengas!“, brüllte Horst Südermann.
Ein Polizist brach schwer verletzt zusammen. Sein Kollege sprang entsetzt auf.
„Runter!“, brüllte Bernd Schuster aufgeregt.
„Sie haben ihn erwischt!“
„In Deckung!“, schrie Bernd. Da war es schon zu spät. Der Beamte bog seinen Rücken weit durch, taumelte zwei Schritte weit und fiel dann auf den Bauch. Bernd wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Sag, was du willst, Horst. Ich sehe mir das Gemetzel nicht mehr länger an.“
„Was hast du vor?“, fragte der Inspektor erregt.“
„Ich sehe zu, wie ich ins Lagerhaus hineinkomme.“
„Das schaffst du nicht, Bernd.“
„Diese Gangster knallen einen nach dem anderen ab!“, schrie Bernd dem Freund ins Gesicht. „Es wird Zeit, dass ihnen einer das Handwerk legt!“
„Dann komme ich mit!“, entschied Inspektor Südermann.
„Ich auch!“ sagte Wilhelm Krone.
Sie liefen, hinter den Wagen geduckt, davon. Bernd fand einen toten Winkel. Hier konnte keiner der Gangster sie sehen. Er jagte auf das Lagerhaus zu. Atemlos erreichte er die Lagerhauswand. Vorsichtig richtete er sich daran auf. Rechts neben ihm befand sich ein Fenster. Der Lauf einer Maschinenpistole erschien. Dann begann die Waffe zu rattern. Bernd spannte die Muskeln und schlug den Waffenlauf nach oben. Gleichzeitig federte er vor das Fenster und feuerte vier Schüsse in das Lagerhaus. Der Schütze war ausgeschaltet. Bernd kletterte in das Gebäude. Horst und Wilhelm folgten ihm. Beißend legten sich die Tränengasschwaden auf ihre Schleimhäute.
Bernd presste sein Taschentuch vor Mund und Nase. Er hörte ein Fluchen und Husten.
Hastig griff er sich die UZI, die neben dem Fenster auf dem Boden lag.
Die Freunde eilten durch das Lagerhaus. Als sie entdeckt wurden, kam es zwischen ihnen und den Gangstern zu einem erbitterten Feuerwechsel.
Zwei Verbrecher fielen. Die anderen warfen ihre Waffen weg, als wären sie mit einem Mal zu heiß. Auch Winfried Schack hob die Hände. Er sah ein, dass es keinen Zweck mehr hatte, den Kampf fortzusetzen. Er wollte lieber im Gefängnis sitzen und leben, als hier zu sterben. Im Gefängnis konnte man sich’s richten, wenn man mit seinen Qualitäten ausgestattet war. Haft war nicht so schlimm wie der Tod.
Sein Partner dachte über diese Dinge jedoch ganz anders.
Bernd sah den Mann durch die Halle rennen und eilte hinter ihm her. Der Mann schwang sich in den ersten Lkw.
Inzwischen stürmten die Polizisten draußen auf das Lagerhaus zu. Kein Schuss fiel mehr. Südermann und Krone sammelten die Waffen der Gangster ein und legten sie auf einen Haufen zusammen.
Bernd war noch unterwegs, als Schacks Partner den LKW startete.
Horst Südermann wandte sich um und sah Schuster auf den Laster zu rennen. Jetzt knallte der Mann, der mit Winfried Schack gemeinsame Sache gemacht hatte, den ersten Gang ins Getriebe. Sein Gesicht war schweißüberströmt. Sein Herz klopfte bis in den Hals hinauf. Aufgeben kam für ihn nicht in Frage. Er wollte nichts unversucht lassen, um die Freiheit zu behalten.
Ein Druck aufs Gaspedal. Der Motor brüllte auf. Der Laster machte einen Sprung auf die geschlossene Schiebetür zu. Schuster biss die Zähne zusammen. Er verlangte seinem Körper das Letzte ab. Jetzt zeigte sich, wie gut ihm das tägliche Training tat.
Der Lkw brauste auf das Tor zu. Bernd hastete mit langen Sätzen hinter dem Fahrzeug her. Er schnellte sich vom Boden ab, warf die Arme vor und klammerte sich mit den Fingern an den Rand der Ladeklappe, dann zog er sich mit einem Klimmzug nach oben.
Da erreichte der Lkw das geschlossene Tor und prallte dagegen. Das Holztor knirschte und barst in derselben Sekunde. Holztrümmer flogen in hohem Bogen davon. Die anstürmenden Beamten stoben auseinander, brachten sich keuchend vor dem aus dem Lagerhaus brechenden Lastkraftwagen in Sicherheit. Und sie warfen sich gleichzeitig herum, um den Laster mit ihren Schüssen zu stoppen.
Dumpf ratterten die Projektile in die Motorhaube. Der Lenker des Lkws duckte sich. Aber er tat dies nicht schnell genug. Eine Kugel zerstörte seine linke Gesichtshälfte.
Noch war Leben in ihm, und solange dies der Fall war, gab er nicht auf. In mörderischem Zickzack donnerte der Laster zwischen zwei Streifenwagen hindurch. Dann kollidierte er mit drei Fahrzeugen. Der Laster schrammte an ihnen entlang, knickte zwei Peitschenlampen um und entwurzelte einen Hydranten.
Bernd arbeitete sich nach vorn. Er hatte die Absicht, in die Fahrerkabine zu klettern und den Laster zum Stehen zu bringen. Mit fiebernden Fingern löste er die Plane vom Gestänge. Da das Fahrzeug keinen geraden Kurs verfolgte, wurde er immer wieder hin und her geworfen. Endlich war die Öffnung so groß, dass Bernd hindurchschlüpfen konnte. Er war jetzt unmittelbar hinter dem Fahrerhaus.
Plötzlich stellten sich seine Haare auf.
Der Laster raste geradewegs auf einen Havel-Seitenkanal zu. Nicht einmal eine Notbremsung hätte jetzt noch verhindern können, dass der Lkw ins Wasser stürzte.
Kurz bevor es passierte, sprang Bernd mit einem weiten Satz ab. Er krümmte gleichzeitig den Körper und rollte sich geschickt ab, wobei er sich mehrmals überschlug. Ein paar blaue Flecken würde er davontragen - aber was machte das schon?
Als Bernd wieder auf den Beinen stand, sprang der Laster gerade mit dröhnendem Motor in das braune Kanalwasser. Ein Klatschen, Zischen und Gurgeln. Und langsam sank der schwere Koloss. Nur allmählich beruhigte sich das Wasser wieder.
Der Fahrer machte keine Anstalten, den Laster zu verlassen.
Bernd riss seine Lederjacke von den Schultern. Da kam Inspektor Südermann mit einem Streifenwagen angebraust.
„Ein Bad im November kann genauso schlimm sein wie ein Messerschnitt quer durch die Gurgel!“
„Der Mann ertrinkt, Horst!“, rief Bernd erregt.
„Ich bin sicher, dass er nicht mehr lebt. Willst du wegen eines Toten deine Gesundheit aufs Spiel setzen, Bernd?“
„Wie kannst du so sicher sein ...?“
„Der Mann, der ihm das Gesicht zerschossen hat, ist der Meinung, dass er diesen Schuss nicht überleben konnte.“
„Er ist noch bis hierhergefahren.“
„Die Tatsache, dass er nicht versucht hat, aus dem Wagen zu klettern, sollte dich davon überzeugen, dass er nicht mehr lebt, Bernd. Ich werde mich mit der Wasserpolizei in Verbindung setzen. Die sollen den Laster und den Toten heraufholen.“
Keine zehn Minuten vergingen, bis die Froschmänner eintrafen. Sie schnellten sich sofort ins Wasser.
Inzwischen traf ein Kranwagen ein. Südermann kommandierte die Männer herum. Dann trat er zu Bernd.
„Zigarette, Freund?“, fragte er mit gedämpfter Stimme.
Schuster stand gespannt da und schaute auf die quirlende Wasseroberfläche.
„Zigarette?“, fragte Horst noch einmal.
„Ja, danke“, sagte Bernd und steckte sich das Stäbchen zwischen die Lippen.
„Hast du gesehen, wer es ist?“, fragte Horst den Freund.
Bernd schüttelte nervös den Kopf. „Nein.“
„Schack hat es uns inzwischen verraten ...“
Die Froschmänner tauchten auf. Bernd trat ganz nahe an das Wasser heran. Die Männer in der schwarzen Taucherkombination mit den großen Gesichtsmasken schleppten einen Leichnam mit sich. Mühsam hievten sie ihn an Land.
Nun lag Winfried Schacks Partner vor Bernd. Bernd Schuster schluckte trocken, als er die zerschossene Gesichtshälfte anschaute. Horst hatte recht. Mit der Verletzung wird keiner alt.
Schusters Blick wanderte zur anderen Gesichtshälfte hinüber.
„Es ist Carsten Fröhlich, der Transportunternehmer“, sagte Inspektor Südermann neben ihm. Er hörte die Stimme des Freundes wie aus weiter Ferne.
„Fröhlich hat sich selbst bestohlen. Er wollte die Ware unter der Hand verhökern und die Versicherung zur Kasse bitten. Der Gewinn sollte mit Winfried Schack fifty-fifty geteilt werden ...“
Der Kranwagen holte den Laster aus dem Meer. Es gab nichts mehr für Bernd zu tun, deshalb wandte er sich um und ging einfach weg.
Bereits drei Tage später überwies die Berliner LKW-Versicherung das vereinbarte Erfolgshonorar auf Schusters Konto.
Franziska Jahn brachte die freudige Meldung. Bernd öffnete eine Flasche Sekt und schenkte ihnen zwei Gläser ein. Sie tranken auf den erfolgreichen Abschluss eines strapaziösen Falles.
Um elf kam Franziska noch mal. Bernd hatte die Beine auf dem Tisch liegen und spielte mit dem Gedanken einfach zum Angeln hinauszufahren und den Herrgott einen lieben Mann sein zu lassen.
„Bist du zu sprechen, Bernd?“
„Nein.“
. Auch nicht für einen Freund?“
„Südermann?“, fragte Schuster.
„Nein.“
„Krone?“
Auch nicht.“
„Mehr Freunde habe ich doch nicht.“
Franziska schmunzelte. „Wie wär's mit Hans Kersten?“
Bernd nahm blitzartig die Beine vom Tisch.
„Soll hereinkommen!“, rief er erfreut aus.
Kersten rollte mit den Augen, als er grinsend eintrat.
„Hallo, Hannes Gerber. Ich hatte in der Nähe zu tun, und da dachte ich mir, guck doch mal bei deinem neuen Freund rein. Ich war ja auf einiges an Pomp vorbereitet, aber das hier stellt meine Erwartungen bei weitem in den Schatten. Du bist ja ein richtiger Renommierdetektiv, Bernd.“
„Wusstest du das nicht?“, fragte Schuster grinsend.
„Du weißt, ich bin ein einfältiger Mensch.“
„Möchtest du meine Lebensgeschichte wirklich hören?“
„Aber natürlich, Bernd.“
„Okay. Dann erzähle ich sie dir. Aber nicht hier.“
„Wo denn sonst?“
„Drüben, in der Eckkneipe von Elvis. Du hast doch nichts dagegen, dass ich dich zum Mittagessen einlade?“
Hans Kersten fletschte amüsiert die Zähne. „Wie sollte ich?“
„Darf ich Franziska mitnehmen?“
„Die hübsche Blume aus deinem Vorzimmer? Aber klar.“
„Sie kennt die Geschichte zwar schon, aber sie hört immer noch so zu, als wäre sie neu für sie“, schmunzelte Bernd. „Franzi? Hast du Lust auf Currywurst und Bier bei Elvis?“
„Nach all dem asiatischen, türkischen und französischen Essen der letzten Wochen sage ich sehr gern und laut ‚ja, Bernd, gern‘!“
Er nahm Franziska in die Arme, küsste sie und ergänzte dann noch: „Wir müssten aber noch auf Lucy warten. Sie wird in einer halben Stunde aus der Schule sein und sich vergeblich fragen, weshalb wir wohl zur Mittagszeit die Detektei verschlossen haben. Hört sie dann auch noch, dass wir Currywurst gegessen haben, ist der Ärger vorprogrammiert.“
„Schon klar!“, erwiderte Bernd grinsend, schrieb eine Notiz auf einen Zettel und heftete ihn im Hinausgehen an die alte Ladentüre.
„So – das ist nicht zu übersehen!“, sagte er, hakte Franziska und Hans unter und wollte eben die Kurfürstenstraße überqueren, als er seinen Namen hörte. Erstaunt drehte er den Kopf und erkannte seinen zweiten Assistenten Knut.
„Ihr geht doch aber nicht etwa hinüber zu Elvis, oder? Ich habe da nämlich etwas für dich, Bernd!“
„Du bist auch eingeladen, und dann darfst du mir noch vor der Currywurst berichten, was dich zur Mittagszeit aus deiner Schrauberwerkstatt zu mir geführt hat!“
„Bin schon überredet!“, erwiderte Knut und schloss sich den drei Hungrigen an.
ENDE