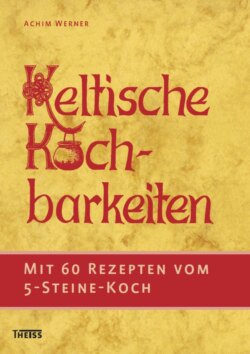Читать книгу Keltische Kochbarkeiten - Achim Werner - Страница 7
Vorwort
ОглавлениеDer derzeit deutlich zunehmende Marktanteil von Bio- und Naturkostläden sowie das damit verbundene wachsende Angebot an Produkten aus kontrolliert ökologischem Landbau ist bemerkenswert. Eine wachsende Zahl von Verbrauchern hat inzwischen festgestellt, dass dorther kommende Kultur- und auch Wildpflanzen sowie Tierprodukte gegenüber den industriell angebauten Kulturpflanzen und der entsprechenden Tierhaltung einfach eine bessere Qualität besitzen. Wenn sich also Achim Werner seit längerem experimentell mit Fragen prähistorischer Ernährung beschäftigt, so folgt er auch vorliegend einer Tendenz, „mögliche Kochrezepte der Kelten realitätsnah nachzuempfinden und für unsere heutige Küche praktikabel umzusetzen.“
Bei seinen Zutaten orientiert er sich an bislang archäologisch nachweisbaren und auch erhaltenen Pflanzen- und Tierresten, die Rückschlüsse auf die Ernährung der Kelten erlauben. Sie sind die einzige Quellenbasis, denn überlieferte keltische „Kochrezepte“ gibt es nicht. Immerhin lässt sich so viel sagen, dass die grundsätzlich auf Ackerbau und Viehzucht basierende Ernährungsgrundlage der Kelten regional und zeitlich unterschiedliche Schwerpunkte besaß.
So haben umfangreiche und fundierte Forschungen der letzten Jahrzehnte – etwa im Rheinland – ergeben, dass in der frühen und mittleren Eisenzeit (5.–2. Jh. v. Chr.) an Kulturpflanzen die Spelzgetreide (Gerste) gegenüber den Hirsearten zunahmen und auch die Hülsenfrüchte neben Lein und Leindotter häufiger angebaut wurden. Dagegen ist dann seit der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. eine Zunahme der Grünlandwirtschaft, also der Viehzucht erkennbar. Der Anbau der Hirsearten geht zurück, während Spelz- und Nacktgerste, Emmer, Dinkel, Nacktweizen und Hafer ebenso angebaut werden wie Erbsen, Bohnen, Lein, Leindotter und Schlafmohn. Ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. sollte dann der Dinkel das bevorzugt produzierte Getreide der römischen Landwirtschaft des Rheinlands werden. Auch ist beispielsweise für das hessische Gebiet in keltischer Zeit feststellbar, dass Spelzgetreide (Gerste), Hülsenfrüchte und Ölpflanzen (Lein und Leindotter) einen wesentlichen Anteil als Kulturpflanzen erlangten, wobei übrigens die Gerste auch im germanischen Raum der letzten vorchristlichen Jahrhunderte an Bedeutung zunahm. Die bodennahe Ernte des Getreides und somit des Strohs und die wohl fehlende Düngung der Felder mag übrigens einen Fruchtwechsel von Getreide und Hülsenfrüchten (mit ihren Stickstoffanreicherungen des Bodens) notwendig gemacht haben.
Dabei hat sich das Klima, das sich im Laufe des letzten Jahrtausends v. Chr. mehrfach änderte, kaum als bestimmender Faktor der Kulturpflanzenwahl im keltischen Raum ausgewirkt. Denn die typischen Kulturpflanzen Gerste, Hirse und Leindotter wurden in ganz unterschiedlichen Landschaften des keltischen Europas angebaut.
Zum regelmäßigen Verzehr hatten die Kelten also eine sehr ausgewogene Ernährungsgrundlage, die aus verschiedenen Arten von Getreide, Ölpflanzen, Hülsenfrüchten, Frischgemüse und Frischobst sowie tierischen Produkten bestand. Allein die Vielzahl der Kulturpflanzen garantierte den damaligen Menschen eine reichhaltige und sichere Lebensbasis. Dabei waren Linsen-Wicken, Erbsen, Linsen, Ackerbohnen, Dinkel und Hirse eher im mittleren und südlichen Mitteleuropa verbreitet. Die Hirse eignete sich wie auch die Gerste mehr als Breiprodukt, die Gerste vielleicht auch zur Bierherstellung.
Die kleberreichen Getreide Einkorn, Emmer und Dinkel sowie der Nacktweizen waren dagegen als Brotgetreide geeignet. Daneben wurden natürlich auch Nutz- und Haustiere wie Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen gehalten und besonders beliebte Fleischlieferanten waren die Schweine. Auch Hundefleisch wurde verzehrt und das Haushuhn war ein neues, seit der Hallstattzeit gezüchtetes Federvieh. Jagd und Fischfang spielten bei den Kelten dagegen keine besonders große Rolle, soweit wir es aus Funden wissen.
Da die Kelten keine Geschichtswerke besaßen, obwohl sie für gelegentliche Aufzeichnungen die griechische Schrift verwendeten, gingen alle mündlichen Traditionen verloren. Gäbe es beispielsweise nicht die von Caesar aus seiner Sicht als Feldherr und Staatsmann auf das linksrheinische Gebiet bezogenen Aussagen der Jahre 60–50 v. Chr., so wüssten wir über das Naturvolk der Kelten gewiss noch weitaus weniger. Wie ein Puzzlespiel überliefern eher die archäologischen Quellen ein halbwegs verlässliches, aber unvollständiges Lebensbild der Kelten. Die ebenfalls bruchstückhaft erhaltenen schriftlichen Zeugnisse zu den Kelten stimmen zumindest mit den archäologischen dahingehend überein, dass sich nordwärts der mittelmeerischen Kulturen ab dem späten 6. Jahrhundert v. Chr. und unter besonderem Einfluss vor allem der Etrusker zwischen Seine und Moldau, Alpenrand und deutschem Mittelgebirge in einer Art Kristallisationsprozess die „Kelten“ herausbildeten. Die Sozialstrukturen, das Totenbrauchtum, die Trachteigentümlichkeiten und die Stabilität der „Grenzen“ erzeugten jedenfalls ein eigenständiges Kulturgefüge, das aus der westlichen „Späthallstattkultur“ des 6. Jahrhunderts v. Chr. hervorging.
Es entsteht unter mittelmeerischer Anregung eine aufblühende gemeinsame keltische Kunst, die von einer aristokratischen bis feudal geprägten Stammesstruktur gefördert wird und die durch Ausbeutung hochwertiger Roteisenerze besonders im Rheinischen Schiefergebirge zu einem merkbaren Aufschwung führt.
Bereits 400 v. Chr. erfolgt jedoch ein radikaler, krisenhafter Umbruch, der diese feudale Gesellschaft beseitigt und Wanderungsbewegungen auslöst. Kelten besiedeln nun große Teile der Poebene bis zur mittleren Adriaküste und belagern Rom 387 v. Chr. Sie setzen als „Galater“ 278 v. Chr. sogar über den Hellespont und besiedeln Teile Kleinasiens. Diese expansive Phase dauerte allerdings nicht lange. Denn indem Rom zunehmend an Boden gewann und zudem in Osteuropa ausgelöste germanische Wanderungsbewegungen einsetzten, geriet das nie zu einem Staatsverband, sondern nur zu frühurbanen Strukturen gelangte keltische Stammland im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. unter zunehmen den Druck von außen. Die keltische Selbständigkeit endete spätestens 61 n. Chr. in Britannien und nur in Wales, Nordschottland, Irland und in der Bretagne blieben keltische Sprache und keltisches Volkstum bis heute erhalten.
Umso faszinierender bleibt die Erforschung der Kelten, deren mindestens fünf Jahrhunderte lang währende Geschichte auf dem europäischen Kontinent heute so gut wie vergessen ist. Und es ist sicherlich müßig zu fragen, was denn aus “Europa geworden wäre, wenn nicht die Römer und dann die Germanen den Weg bis in unsere Gegenwart bestimmt hätten.” So formulierte es jedenfalls 1980 einmal Ludwig Pauli, der zu früh verstorbene, ideenreiche Erforscher keltischer Zeiten.
Prof. Hans-Eckart Joachim, Bonn