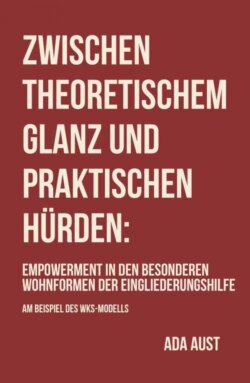Читать книгу Zwischen theoretischem Glanz und praktischen Hürden - Ada Aust - Страница 6
Begriffsbestimmungen Empowerment
ОглавлениеDie Ideen und Wurzeln von Empowerment reichen bis weit ins 19. Jahrhundert der US- amerikanischen Sozialgeschichte zurück. Die erste Veröffentlichung im Jahre 1976 zu Empowerment mit dem Titel Black Empowerment: Social Work in Oppressed Communities stammt von Barbara B. Solomon. Der Begriff als Handlungsanleitung ist somit eng mit der Bürgerrechtsbewegung in Amerika verbunden. In diesem Sinne wird Empowerment als „ein Prozess durch welchen Menschen Kontrolle über ihr Leben, demokratische Partizipation in ihrem Gemeinde-leben und ein kritisches Verständnis ihres Umfeldes erlangen“1 verstanden (eigene Übersetzung, Perkins & Zimmermann, 1995, S. 570). Der Begriff Empowerment kann ebenfalls in der Tradition des Feminismus, der Selbsthilfebewegung, der Community Action-Programme, der Gemeindepsychologie und in Kampagnen zur Bildung eines politischen Bewusstseins sowie in der psychosozialen Praxis wiedergefunden werden (Herriger, 2014, S. 23 ff.). Im Kontext der psychosozialen Praxis verbergen sich hinter Empowerment als Begriff „eine Philosophie, theoretische Annahmen und Leitideen wie aber auch Prozesse, Programme, Konzepte oder Ansätze“ (Theunissen, 2013, S. 27). Dies führt dazu, dass sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch in der psychosozialen Praxis derzeit kein einheitliches Verständnis von Empowerment existiert (Herriger, 2014, S. 13). In dieser Uneinigkeit können nach Herriger vier verschiedene Zugänge innerhalb der Definitionen unterschieden werden. Der Fokus auf das Individuum als aufbrechendes Subjekt ist allen vier Zugängen gemein. Dieses Individuum macht sich für sich und/oder andere auf den Weg zu mehr Eigenregie über die Parameter der eigenen Lebenswelt: sei es zur Umverteilung von Machtverhältnissen und als Widerstand gegen Unterdrückung (politischer Zugang); sei es mit Unterstützung der eigenen Ressourcen (lebensweltlicher Zugang); sei es in einem selbstinitiierten und eigen- gesteuerten Prozess zur Wiederherstellung der alltäglichen und politischen Lebenssouveränität (reflexiver Zugang); sei es im Rahmen eines Leistungskataloges der psychosozialen Praxis (transitiver Zugang) (ebd., S. 14 ff., S. 18). Außerdem nimmt Empowerment in Abhängigkeit des Kontextes unterschiedliche Formen und Bedeutungen an. So erfahren Kinder in Schulen andere Prozesse mit unterschiedlichen Ergebnissen als Menschen mit geistiger Behinderung (Theunissen, 2013, S. 32). Kurz gefasst kann Empowerment als „das Anstiften zur (Wieder-)Aneignung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Lebens“ definiert werden (Herriger, 2014, S. 8). Im Zentrum dabei stehen die „vorhandenen Stärken von Menschen in gesellschaftlich marginaler Position“ (Theunissen, 2013, S. 27). Ebenso ist Empowerment eng mit einem Perspektivenwechsel der professionell Handelnden verbunden. Nämlich jenem Wechsel von einem defizitären hinzu einem ressourcen- und stärken-orientierten Blickwinkel auf die Adressatinnen der psychosozialen Praxis (Herriger, 2014, S. 70). Denn das Empowerment-Konzept „ist getragen von dem festen Glauben an die Fähigkeiten des Individuums, in eigener Kraft ein Mehr an Autonomie, Selbstverwirklichung und Lebenssouveränität zu erstreiten – und dies auch dort wo das Lebensmanagement des Adressaten soziale Hilfe unter einer Schicht von Abhängigkeit, Resignation und ohnmächtiger Gegenwehr verschüttet ist“ (Herriger, 2014, S. 72). Insofern liegt dem Empowerment-Konzept ein optimistisches Menschenbild zugrunde. Zu den Grundwerten von Empowerment, die nicht losgelöst voneinander gedacht werden können, gehören nach Theunissen Selbstbestimmung, kollaborative und politische Partizipation, Verteilungsgerechtigkeit und emanzipatorisches Interesse (2013, S. 39 ff.). Der wesentliche Grundwert der Selbstbestimmung ist nicht mit Empowerment gleichzusetzen. Unter Selbstbestimmung ist das eigenverantwortliche Entscheiden und autonome Handeln des Ichs gemeint, das stets in Beziehung zum Du steht. So kann Selbstbestimmung auch ein konflikt-trächtiger Prozess sein: Es gilt dabei die Ich-Identität und das Konzept über das Selbst ins Verhältnis zu den zugeschriebenen Attributen und Eigenschaften des Du‘s zu setzten sowie die möglichen gegensätzlichen Ansätze miteinander auszubalancieren (ebd., S. 40, 43 f., nach Buber, 1967). In der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung ist dieser Grundwert der kollaborativen und politischen Partizipation eng mit Teilhabe verbunden. Teilhabe bezeichnet Prozesse, in denen Betroffene und ihre Angehörigen nicht nur als Bürgerinnen mit Rechten wahrgenommen werden, sondern auch Entscheidungen, die ihre Lebenswelt maßgeblich beeinflussen, im wesentlichen mitbestimmen (z.B. in Form von Bürgerbeteiligungen, Betroffenenbeiräte oder Arbeitskreise mit politischem Mandat, die ebenso in Parlamenten sichtbar sind) (ebd., S. 44 f.). Die Frage nach dem Grad einer fairen und gerechten Verteilung von Ressourcen und Lasten innerhalb einer Gesellschaft beinhaltet den Wert der Verteilungsgerechtigkeit. Dabei spielen neben Mitbestimmungsrechten, auch „die Verbreitung und der freie Zugang zu Informationen, um sachgerecht urteilen zu können“ sowie „staatliche Leistungen wie kostenlose Beschulung, der freie Zugang zu Bildungseinrichtungen und sozialen Diensten sowie eine Sozial- und Gesundheitsfürsorge für alle“ eine Rolle (ebd., S. 49). Durch das emanzipatorische Interesse kann durch Umsetzung des Empowerment-Konzepts keine Vereinnahmung der Zielgruppen beabsichtigt werden, hingegen trägt eine solche Umsetzung zu einer „emanzipatorischen Behindertenarbeit“ bei (ebd., S. 55, nach Wallerstein & Bernstein, 1988; Wienstroer 1999; Steiner, 1999). Ein Handeln im Sinne von Empowerment findet folglich auf vier verschiedenen Ebenen statt: Auf der subjekt-zentrierten Ebene geht es um die Stärke der Betroffenen ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu bewältigen. Die Förderung von bereits vorhandenen Netzwerken, der Aufbau von Gruppen zur Selbstvertretung der eigenen Interessen sowie die Vernetzung auf überregionaler Ebene liegen im Vordergrund der gruppenbezogenen Ebene. Auf institutioneller Ebene sind Entscheidungen gemeinsam mit den Betroffenen zu treffen und nicht über deren Köpfe hinweg. Um Empowerment auch auf sozialpolitischer und gesellschaftlicher Ebene zu leben, bedarf es zudem auf kommunaler Ebene Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen, deren Stimmen in politischen Entscheidungen nicht nur Gehör finden, sondern an denen sie auch beteiligt werden (Schwalb & Theunissen, 2018, S. 28 ff.). Für die vorliegende Arbeit wird Empowerment als ein ganzheitliches Konzept verstanden, das einen individuellen und kollektiven Selbstermächtigungsprozess beschreibt. Während dieses Prozesses gelangt das Individuum mit Unterstützung eigener Ressourcen und Stärken zu einer selbstbestimmten Lebensgestaltung sowie im Zusammenschluss mit anderen Betroffenen zur Verbesserung der mittelbaren Lebensumstände und zur Mitbestimmung auf institutioneller, sozialpolitischer und gesellschaftlicher Ebene. Zugleich impliziert dieser Prozess für die professionellen Akteurinnen der Behindertenhilfe einen Handlungsauftrag.