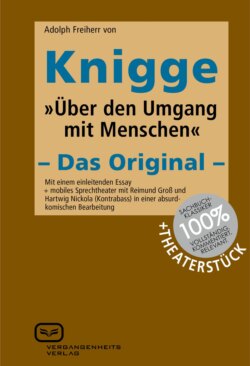Читать книгу Über den Umgang mit Menschen (Enhanced, +Theaterstück) - Adolph Freiherr von Knigge - Страница 4
Einleitendes Essay: Knigge – das Original und ein großes Missverständnis
ОглавлениеJeder kennt den Namen Knigge – kaum einer weiß jedoch, was sich genau dahinter verbirgt. Mit 'dem Knigge' verbindet sich im allgemeinen eine Gattungsbezeichnung für alle mögliche Benimm-, Etikette-, Ratgeber- und Lebenshilfe-Literatur. Vom Sex-Knigge bis zum Web-2.0-Knigge gibt es heute alle möglichen und unmöglichen Ratgeber auf dem Büchermarkt. Diese Literatur lebt von dem Bedürfnis vieler Menschen, sich „richtig“ zu benehmen und möglichst nicht durch „falsches“ Verhalten aufzufallen. Meist werden in solcher Ratgeberliteratur Tipps gegeben, wie man isst, wie man Konversation betreibt usw. Die moderne Knigge-Literatur spielt mit den Ängsten vieler Menschen, aus der Rolle zu fallen und sich „daneben zu benehmen“.
Der originale Knigge, 1752 auf dem Gut Bredenbeck bei Hannover geboren, stand erhaben über solchen Kleinigkeiten und wollte etwas ganz anderes als bloß formal gut erzogene Menschen. Das ursprüngliche Werk – sozusagen die Mutter aller Benimmbücher – heißt "Ueber den Umgang mit Menschen", sein Autor in der ersten Auflage von 1788 noch Adolph Freiherr von Knigge. Bis zu seinem Tod im Jahr 1796 hat er fünf Auflagen erlebt und im Zuge der Französischen Revolution das 'von' vor seinem Namen gestrichen. „Über den Umgang mit Menschen“ besteht aus drei Teilen, die ihrerseits in 26 Kapitel unterteilt sind, die jeweils mit einer gesonderten Einleitung beginnen. Die drei Kapitel des ersten Teils können als Einführung betrachtet werden. Es handelt sich um „Allgemeine Bemerkungen und Vorschriften über den Umgang mit Menschen“, „Über den Umgang mit sich selbst“ sowie „Über den Umgang mit Leuten von verschiedenen Gemütsarten, Temperamenten und Stimmungen des Geistes und Herzens“. Die zwölf Kapitel des zweiten Teils erweitern den Horizont unter anderem auf „Eltern, Kinder und Blutsverwandte“, „Eheleute“, „Verliebte“, „Hauswirte, Nachbarn“, „das Verhältnis zwischen Wirt und Gast“ oder auch „das Verhältnis zwischen Wohltätern und denen, welche Wohltaten empfangen“. Abgeschlossen wird das Werk mit Anmerkungen „über die Art, mit Tieren umzugehn“ sowie „über das Verhältnis zwischen Schriftsteller und Leser“. Das Buch wurde bis heute millionenfach gelesen und gilt als einer der großen Sachbuchklassiker der Literaturgeschichte. „Über den Umgang mit Menschen“ war schon zu Knigges Lebenszeit ein Erfolg. Als Knigge 1796 starb, wurde dessen Buch wiederholt von Herausgebern umgeschrieben und in neuer Gestalt publiziert. Im Laufe der Zeit wurde es so immer mehr zu einer Anstandsfibel. Der moderne Knigge war geboren – und damit zahlreiche Missverständnisse.
Was passiert ist? Gucken wir genauer hin: Knigge war ein Autor der deutschen Aufklärung des 18. Jahrhunderts und war zu seiner Zeit einer der meist gelesenen Aufklärungs- und Unterhaltungsschriftsteller. Neben "Ueber den Umgang mit Menschen" hat er Romane, Gedichte, Satiren geschrieben, komponiert und musiziert, Theaterstücke verfasst, war als Regisseur wie Schauspieler aktiv, und hat zahlreiche Übersetzungen und Rezensionen zu Papier gebracht.
In der Einleitung zu "Ueber den Umgang mit Menschen" gab Knigge ausdrücklich an, dass er kein "Complimentir-Buch" schreiben wollte. Vielmehr wandte er sich gerade gegen jegliches steife, konventionelle, bloß äußere Regelwerk der Etikette. So riet er zwar, "dass man bey Tische den abgeleckten Löffel, womit man gegessen, nicht wieder vor sich hinlegen" und einen benutzten Zahnstocher nicht weiterreichen soll; "dass, wenn man mit jemand in Einem Bette schlafen muss – (Zitat Knigge: "Ich kenne nichts eckelhafteres und unanständigers, als zu Zwey unter derselben Decke zu liegen") -, man dem anderen möglichst wenig Ungemächlichkeit verursachen dürfe. Aber all das verstand sich für Knigge von selbst und war eine Frage der guten Kinderstube.
Knigge wollte seinen Lesern "Bruchstücke, vielleicht nicht zu verwerfende Materialien, Stoff zu weiterm Nachdenken" liefern. Er riet nicht zu ehernen Verhaltensnormen aus einem festen Moralsystem, sondern beschrieb "Resultate aus den Erfahrungen", gesammelt "unter Menschen aller Arten und Stände". Grundlage der angewandten Menschenkenntnis, die auch als Anleitung zur Selbsthilfe zu verstehen ist, waren vor allem die Erfahrungen, die der Autor in den 1770er Jahren an deutschen Fürstenhöfen sowie in den 1780er Jahren als Cheforganisator des Illuminatenordens gemacht hatte. Knigge präsentierte Probleme und Lösungen für den "Umgange mit Menschen aller Gattung" angesichts der Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts. Denn Deutschland existierte damals nicht, war in zahlreiche Kleinstaaten zerfallen, unterschiedliche Staatsverfassungen, Nationalcharaktere und Stände, in "eine so große Mannigfaltigkeit des Conversationstons, der Erziehungsart, der Religions- und andrer Meinungen" zersplittert.
Angesichts dieser Ausgangslage war Knigges Umgangsbuch als eine pragmatische Anleitung auch unter widrigen Bedingungen gedacht. Unter diesen Bedingungen verstand er auch, dass sich die damaligen feudalen Gesellschaften in einem dramatischen Auflösungsprozess befanden. Das Großereignis der Zeit war die französische Revolution 1789, die nur ein Jahr nach der Erstpublikation von Knigges Hauptwerk alle Regeln des Umgangs zwischen den Menschen, dem Oben und Unten, Aristokraten und einfachen Leuten über den Haufen warf – und langsam aber sicher in den Jahren zuvor heraufgezogen war. Wo sich Gesellschaften derart verändern, ist es nicht verwunderlich, dass man sich neue Gedanken über das Miteinander macht. Im Grunde ist Knigges Buch deshalb eine frühe soziologische Beschreibung der sozialen Regelwerke in einer Zeit des Umbruchs und der sozialen Desintegration.
Dabei ging es Knigge nicht nur um politische Ereignisse, sondern um ein grundlegenderes Phänomen, das Antrieb der Aufklärung des 18. Jahrhunderts war: Die Entdeckung des eigenen Ichs. Wo Menschen nicht mehr ganz so feste Statuszuschreibungen als Handwerker, Bauer, Aristokrat erleben, sind sie zunehmend auf sich selbst geworfen zu entscheiden, wer sie sind und welchen Platz sie in der Gesellschaft haben. Ganz praktisch betrachtet wirft diese Entwicklung auch die Frage auf, wie die Menschen dann noch miteinander kommunizieren.
Aber – und das stand für Knigge fest – der Mensch braucht trotz aller gesellschaftlichen Auflösungserscheinungen Konventionen für sein Verhalten. Und so entwarf er ein Gebäude von praktischen Höflichkeits- und Anstandsregeln: für die Freundschaft, für die Beziehung zwischen den Geschlechtern, zwischen Angehörigen verschiedener Stände und Generationen. Knigges Lehren propagierten Vernunft – das große Schlagwort seiner Zeit. Erstaunlich modern war seine fast psychologische Perspektive auf das Leben mit sich selbst: „Sei dir selber ein angenehmer Gesellschafter. Mache dir keine Langeweile, das heißt: Sei nie ganz müßig. Lerne dich selbst nicht zu sehr auswendig, sondern sammle aus Büchern und Menschen neue Ideen. Der langweiligste Gesellschafter für sich selber ist man ohne Zweifel dann, wenn man mit seinem Herzen, mit seinem Gewissen in nachteiliger Abrechnung steht.“
Knigge war ein moderner Denker seiner Zeit, ein Revolutionär in Gedanken, der die großen Umwälzungen auf der Ebene persönlichen Verhaltens untersuchte und beispielsweise riet:
Der einzelne habe sich zwar mit den noch geltenden höfischen "Übereinstimmungs-Gesetzen im Umgange" bekannt zu machen, ohne jedoch seine "innere Würde" und die "Eigenthümlichkeit des Characters" zu verleugnen. Von Würde und eigenem Charakter eines jeden Menschen zu sprechen, war für damalige Verhältnisse neu, vielleicht revolutionär. Auf jeden Fall war eine solche Perspektive auf die Menschen ein Angriff auf die feudalen Herrschaftsverhältnisse, in denen Individualität keine Rolle spielte, zumindest nicht für die Untergebenen der Feudalherren.
Knigges Empfehlungen zur "Kunst des Umgangs mit Menschen" lassen sich insgesamt beschreiben als eine Synthese aus aristokratisch-höfischen und bürgerlichen Lebensauffassungen und Umgangsformen, die zwar heftige polemisch-antifeudalistische Tendenzen enthält, aber ein modernes bürgerliches Selbstbewusstsein vorstellt. Knigge als eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vertritt als Repräsentant der deutschen Aufklärung dabei auch deren Dialektik: Das Programm der 'relativen Aufklärung' meint bei Knigge weniger Auflehnung im Großen als Resignation im Kleinen: "Die beste Aufklärung des Verstandes ist die, welche uns lehrt, mit unsrer Lage zufrieden und in unsern Verhältnissen brauchbar, nützlich und zweckmäßig tätig zu sein."
Wer so argumentiert, war kein wirklicher Umstürzler der Verhältnisse, vielmehr wird in seiner Argumentation deutlich, dass er ausgleichend und moderierend tätig sein wollte. So argumentierte er in seinem Hauptwerk im Kapitel "Ueber den Umgang mit den Großen der Erde, Fürsten, Vornehmen und Reichen", dass man auf damaliger verfassungsrechtlicher Grundlage bleiben müsse. Er weist seine Leser darauf hin, dass jene, "was sie sind und was sie haben, nur durch Übereinkunft des Volks sind und haben; dass man ihnen diese Vorrechte wieder nehmen kann, wenn sie Missbrauch davon machen; [...] endlich, dass in diesen Zeiten der Aufklärung bald kein Mensch mehr daran glauben wird, dass ein Einziger [...] ein angeerbtes Recht haben könne, hundert tausend weisern und bessern Menschen das Fell über die Ohren zu ziehn".
Knigges „Ueber den Umgang mit Menschen“ ist ein Zeitdokument, das vor allem auch als historische Quelle gelesen werden sollte. Gehen Sie mit Knigge also auf eine Zeit- und Entdeckungsreise ins 18. Jahrhundert, in der die „normalen“ Menschen anfangen, sich selbst als Akteure zu verstehen, die in den vorgefundenen und sich ändernden Verhältnissen sich orientieren, sprich neu „benehmen“ müssen.